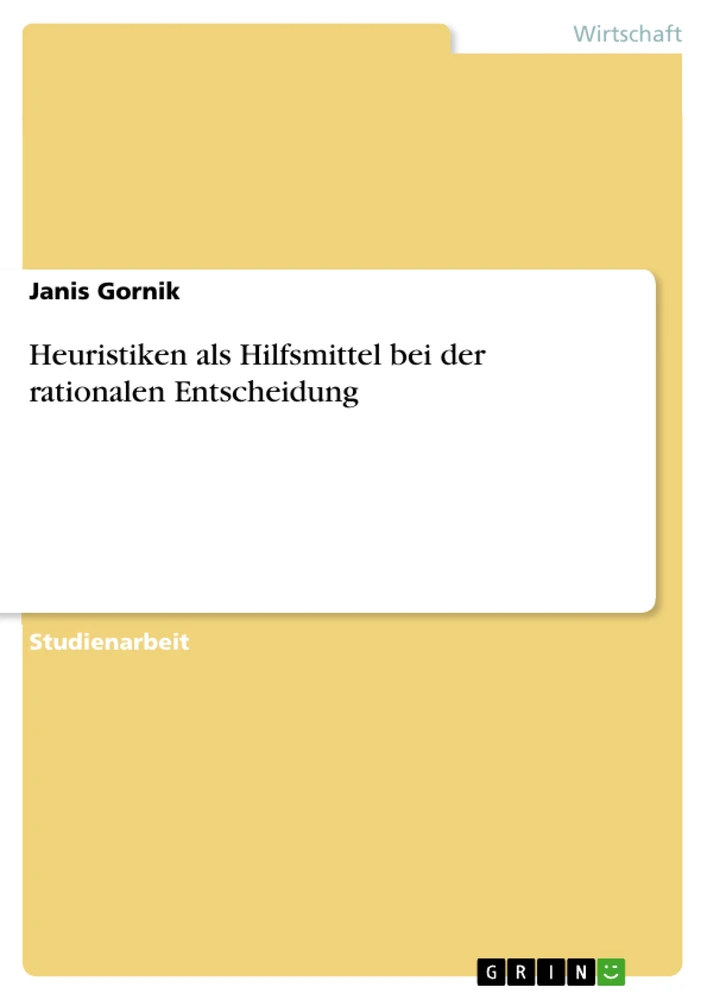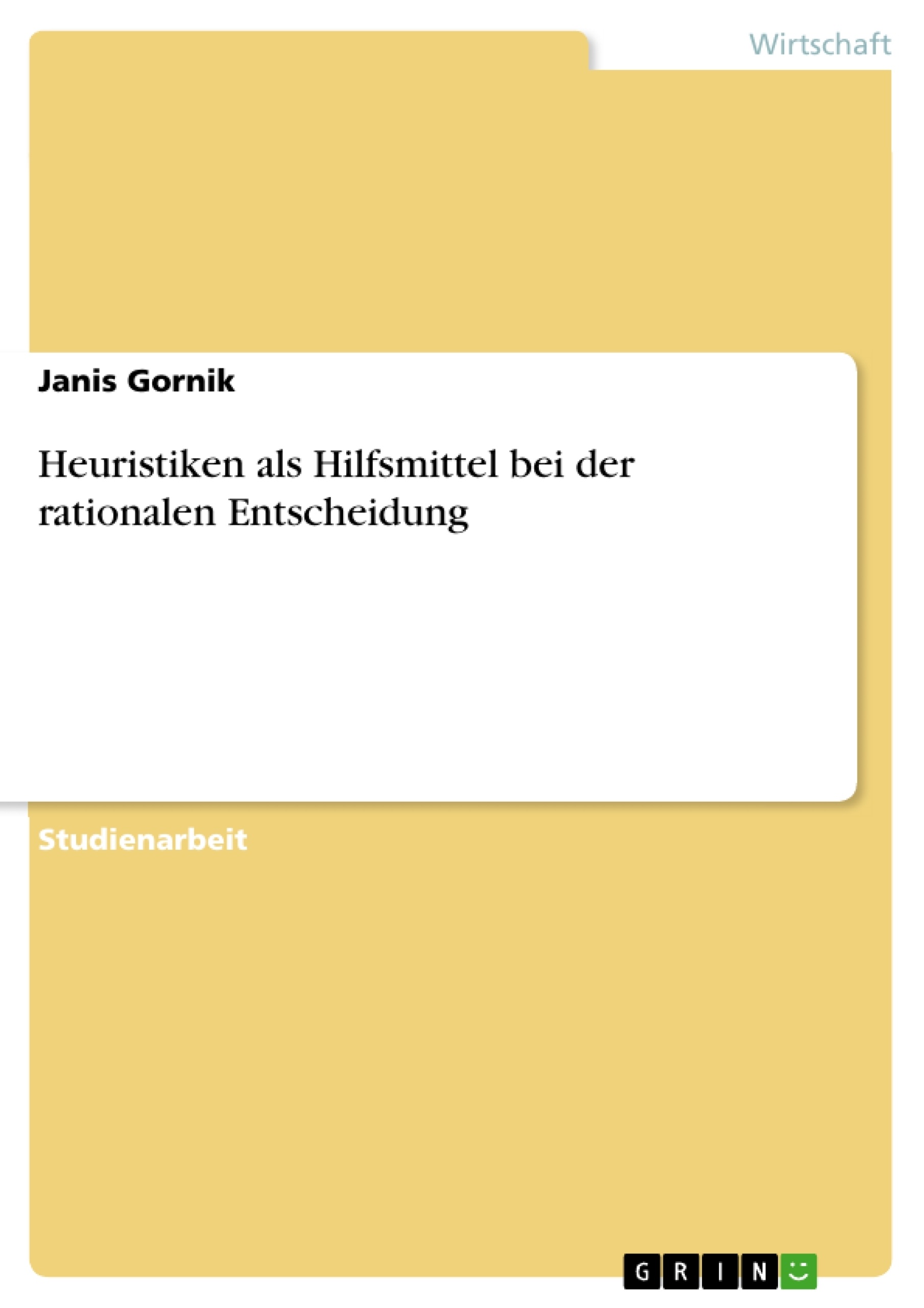Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen rationaler Entscheidungen, als deren Mustermodell in der Ökonomie lange Zeit der "homo oeconomicus" galt. Doch es ist fraglich, ob solch rationale Entscheidungen in der Realität überhaupt möglich sind, oder ob das Individuum Entscheidungen nur mit Hilfe anderer „Hilfsmittel“, wie beispielsweise Heuristiken treffen kann.
Dies soll in der Arbeit ebenfalls geklärt werden, nachdem zunächst darauf eingegangen werden soll, welche Aspekte für eine rationale Entscheidung nach dem klassischen Modell gegeben sein müssen. Die Heuristiken als alternatives Konzept zu rationalen Entscheidungen des ökonomischen Modells des homo oeconomicus sollen erklärt werden.
Zusätzlich zu der Abstufung nach ihrer Wichtigkeit lassen sich Entscheidungen in bewusste und unbewusste Entscheidungen abgrenzen. Neben den bewussten Entscheidungen, die in dieser Arbeit angesprochen werden sollen, trifft der Mensch jeden Tag zahlreiche unbewusste Entscheidungen. Wie diese Entscheidungen getroffen werden, soll in dieser Arbeit aus Platzgründen aber nicht näher angesprochen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rationale Entscheidungen
- 2.1 Das Entscheidungsmodell rationaler Entscheidungen
- 2.2 Der homo oeconomicus und rationale Entscheidungen
- 2.3 Zeitliche Aspekte und Personenkonstellationen
- 2.4 Rationale Entscheidungen im Alltag
- 3. Heuristiken
- 3.1 „Recognition heuristic“
- 3.2 „Fluency heuristic“
- 3.3 „One reason Decision making“
- 3.4 „Take the best heuristic“
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle von Heuristiken bei der Entscheidungsfindung. Sie untersucht, ob es eine einheitliche Entscheidungsregel für das Individuum gibt und welche Faktoren Einfluss auf Entscheidungen nehmen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen dem klassischen Modell der rationalen Entscheidung des homo oeconomicus und dem Einsatz von Heuristiken als Entscheidungswerkzeuge.
- Rationale Entscheidungsmodelle im Vergleich zu Heuristiken
- Die Rolle des homo oeconomicus in der Entscheidungstheorie
- Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung
- Bedeutung von Zeit und Personenkonstellationen für Entscheidungen
- Beispiele für Heuristiken im Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor, ob eine allgemeine Entscheidungsregel für das Individuum existiert und welche Faktoren auf Entscheidungen einwirken. Kapitel 2 fokussiert auf das klassische Entscheidungsmodell rationaler Entscheidungen, das auf dem Konzept des homo oeconomicus basiert. Es werden die relevanten Faktoren und das Entscheidungsmodell im Detail erläutert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Heuristiken als alternativen Entscheidungswerkzeugen. Verschiedene Heuristiken, wie die „Recognition heuristic“ und die „Take the best heuristic“, werden vorgestellt und analysiert. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Rationale Entscheidung, homo oeconomicus, Entscheidungsmodelle, Heuristiken, „Recognition heuristic“, „Take the best heuristic“, Entscheidungsfindung, Zeitliche Aspekte, Personenkonstellationen, Einflussfaktoren
- Quote paper
- Janis Gornik (Author), 2015, Heuristiken als Hilfsmittel bei der rationalen Entscheidung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307597