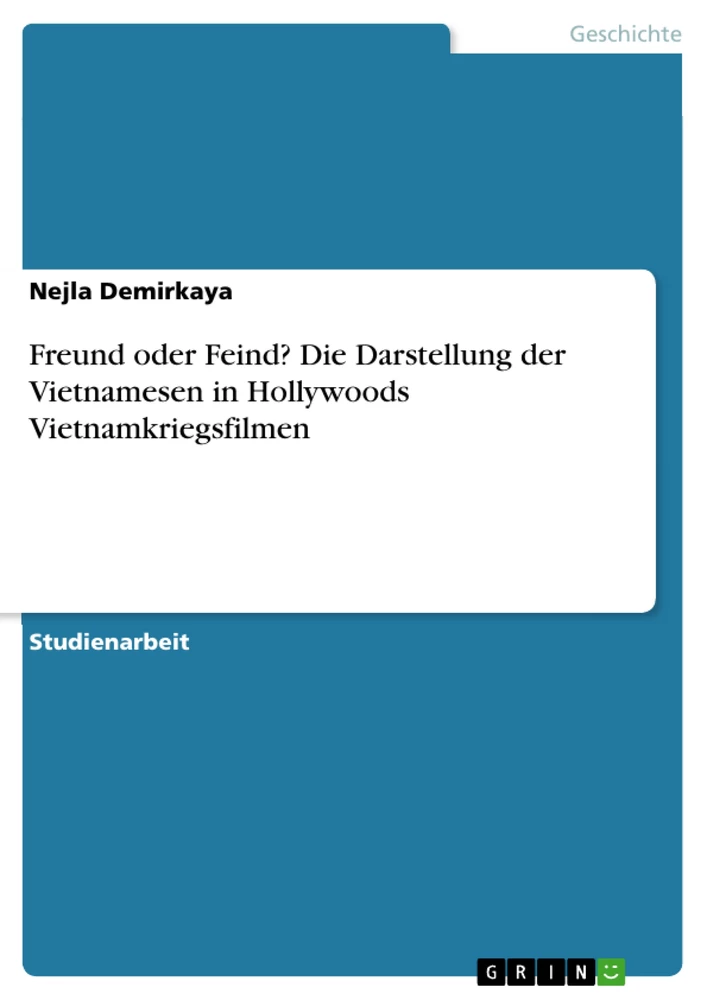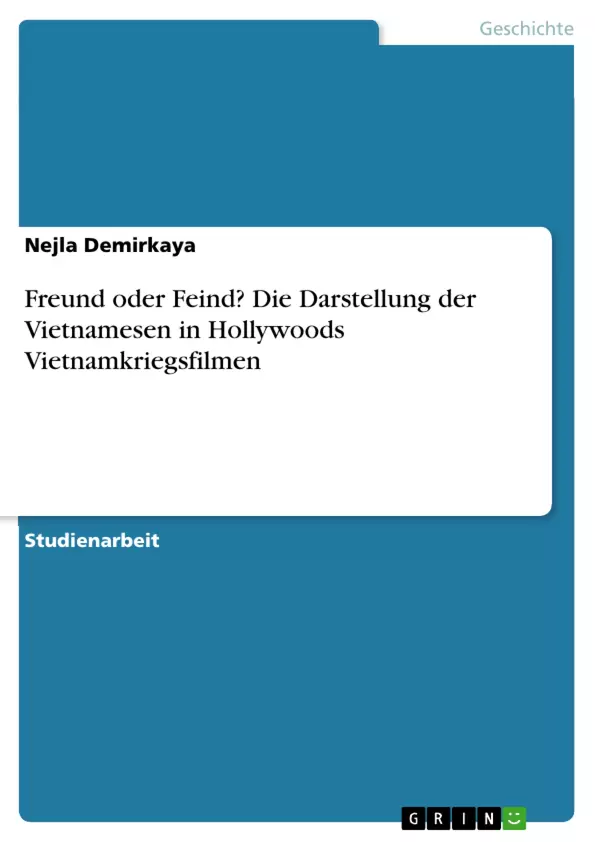Anhand einer Auswahl exemplarischer Vietnamfilme soll in dieser Hausarbeit im Hinblick auf ihren historischen Kontext die Darstellung der Vietnamesen beschrieben und analysiert werden.
Das Medium Spielfilm ist besonders geeignet, „vorhandene Ängste, kollektive Bedürfnisse und Phantasien“ einer Gesellschaft zu reflektieren, zu verarbeiten und sogar zu beeinflussen. Bekanntermaßen bieten gerade Feindbilder eine hervorragende Projektionsfläche für die Ängste und Aggressionen einer Gesellschaft. Inwiefern könnte sich also in Hollywoods Vietnamfilmen die US-amerikanische Grundhaltung zum Vietnamkrieg in der Darstellung der Vietnamesen niedergeschlagen haben?
Interessant ist dabei die Frage, ob zwischen Freund und Feind, also z.B. unter Mitgliedern der Nordvietnamesischen Armee (NVA) sowie des Vietcong (VC) und Zivilisten klar unterschieden wurde. Dass dies in der Realität des Krieges nicht der Fall war, ist hinlänglich bekannt. Da der Kriegsfilm ungeachtet seiner ideologischen Stellung allgemein ein eher „maskulines“ Genre ist, wäre zudem der Blick auf die vietnamesische Frau möglicherweise besonders erhellend: Bestehen Unterschiede in der Repräsentation männlicher und weiblicher Vietnamesen und wenn ja, worin könnten sie begründet sein?
Die analysierten Filme sind "The Green Berets", "Rambo: First Blood Part II", "The Deer Hunter", "Apocalypse Now", "Platoon", "Full Metal Jacket" und "Good Morning Vietnam".
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Machwerke der Propaganda: „The Green Berets“ und „Rambo: First Blood Part II”
- 2.1. Geschichtlicher Hintergrund
- 2.2. Cowboys vs. Indians: The Green Berets (1968)
- 2.3. Die Hierarchie des Verbrechertums: Rambo: First Blood Part II (1985)
- 3. Die Filme der Carter-Ära: „The Deer Hunter\" und „Apocalypse Now”
- 3.1. Geschichtlicher Hintergrund
- 3.2. Vom Täter zum Opfer: The Deer Hunter (1978)
- 3.3. Der Feind als „super-soldier\": Apocalypse Now (1979)
- 4. Das Ende der Reagan-Ära: „Platoon“, „Full Metal Jacket\" und „Good Morning, Vietnam”
- 4.1. Geschichtlicher Hintergrund
- 4.2. „,...the enemy was in us“: Platoon (1986)
- 4.3. „Charlie\" als „Charlene“: Full Metal Jacket (1987)
- 4.4. Aus Freund wird Feind?: Good Morning, Vietnam (1987)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung der Vietnamesen in Hollywoods Vietnamkriegsfilmen und untersucht, wie die US-amerikanische Grundhaltung zum Vietnamkrieg in der Darstellung der Vietnamesen zum Ausdruck kam. Die Arbeit untersucht, ob zwischen Freund und Feind, also beispielsweise zwischen Mitgliedern der Nordvietnamesischen Armee (NVA) und des Vietcong (VC) sowie Zivilisten, eine klare Unterscheidung gezogen wurde und welche Rolle die vietnamesische Frau in der Filmwelt spielte.
- Die Darstellung der Vietnamesen in Hollywoods Vietnamkriegsfilmen.
- Die Beziehung zwischen der US-amerikanischen Grundhaltung zum Vietnamkrieg und der Darstellung der Vietnamesen.
- Die Unterscheidung zwischen Freund und Feind in den Filmen.
- Die Rolle der vietnamesischen Frau in der Filmwelt.
- Der Einfluss des historischen Kontextes auf die Darstellung der Vietnamesen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das zweite Kapitel analysiert die beiden Propagandafilme „The Green Berets“ und „Rambo: First Blood Part II“ und untersucht, wie sie die US-amerikanische Intervention in Vietnam rechtfertigen. Dabei wird insbesondere auf die Darstellung der Südvietnamesen und der Nordvietnamesen eingegangen.
Das dritte Kapitel behandelt die Filme „The Deer Hunter“ und „Apocalypse Now“ und analysiert, wie die Darstellung der Vietnamesen in diesen Filmen von der politischen Situation der Carter-Ära beeinflusst wurde. Es wird die Frage behandelt, ob und wie sich die Darstellung des Vietnamesen vom Täter zum Opfer entwickelt hat.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Filme „Platoon“, „Full Metal Jacket“ und „Good Morning, Vietnam“ und untersucht die Darstellung der Vietnamesen in der Reagan-Ära. Es wird insbesondere auf die Frage eingegangen, wie die Darstellung des Vietnamesen vom Feind zum Freund oder umgekehrt erfolgt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Vietnamkrieg, Hollywood, Vietnam, Vietnamesen, Darstellung, Feindbild, Propaganda, „super-soldier“, „Vietnam-Syndrom“, „Ramboism“, „John Wayneism“.
- Citation du texte
- Nejla Demirkaya (Auteur), 2013, Freund oder Feind? Die Darstellung der Vietnamesen in Hollywoods Vietnamkriegsfilmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307610