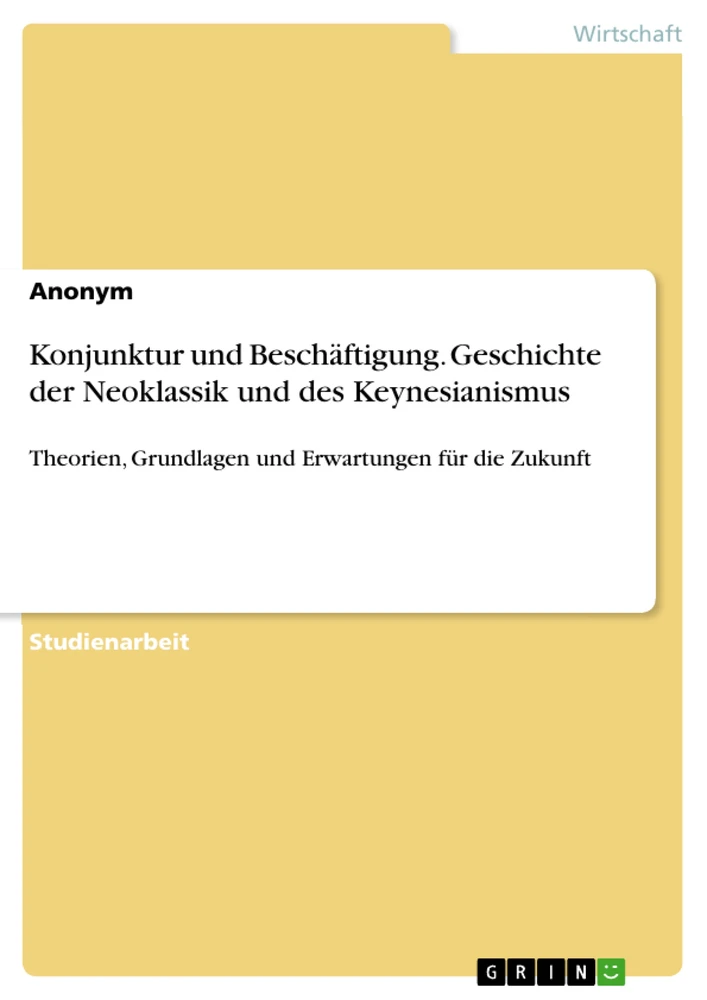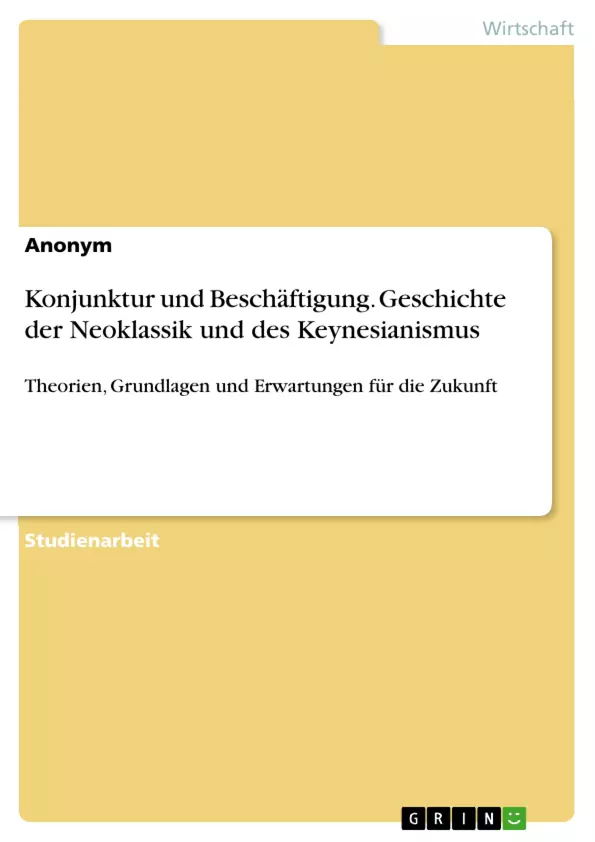Diese Arbeit beschäftigt sich mit den in der Geschichte dominantesten Ökonomien, nämlich der Neoklassik und dem Keynesianismus.
Im ersten Teil der Hausarbeit wird speziell auf die Theorien der Paradigmen eingegangen. Vor allem der Arbeitsmarkt, seine Steuerung und entstehende Phänomene werden veranschaulicht. Der zweite Abschnitt reflektiert die Grundlagen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und ihre Kennzahlen. In diesem Zusammenhang wird auch die Mengentheorie erläutert und welche Erkenntnisse aus ihr gewonnen werden können. Das wirtschaftliche Ziel „angemessenes Wirtschaftswachstum“, ausgedrückt durch das BIP, wird in Hinsicht auf die modernen Problemstellungen diskutiert. Den Abchluss bildet ein Fazit, welches noch einmal zusammenfassend auf die verschiedenen Theorien der Volkswirtschaft schaut und welche Erwartungen an diese bzw. an die Zukunft gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit und Vorgehensweise
- Pflichtteil A
- Paradigmen
- Neoklassik
- Keynes
- Rolle des Arbeitsmarktes, Umgang mit Arbeitslosigkeit
- Arbeitsmarkt in der Neoklassik
- Arbeitsmarkt im Keynesianismus (und wirtschaftspolitische Empfehlungen)
- Paradigmen
- Wahlteil B
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Keynesianische Mengentheorie
- Kritik am Wirtschaftswachstum und Lösungsansätze für die grüne Zukunft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die beiden dominierenden ökonomischen Theorien, die Neoklassik und den Keynesianismus, und untersucht deren Anwendung auf den Arbeitsmarkt und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Arbeit befasst sich mit der Kritik am Wirtschaftswachstum und den Lösungsansätzen für eine nachhaltige Zukunft.
- Die neoklassische Theorie und der Keynesianismus
- Die Rolle des Arbeitsmarktes in beiden Theorien
- Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und die keynesianische Mengentheorie
- Kritik am Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung
- Die Anwendung und Relevanz der Theorien in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und beschreibt den methodischen Ansatz. Es werden die beiden dominierenden ökonomischen Theorien, die Neoklassik und der Keynesianismus, als Gegenstand der Untersuchung benannt und deren Relevanz für die moderne Wirtschaft hervorgehoben.
Pflichtteil A: Paradigmen
Neoklassik
Die Neoklassik entstand im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die industriellen Revolution. Sie basiert auf der subjektiven Werttheorie, die den Wert eines Gutes durch den Preismechanismus von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die Neoklassik geht von vollständiger Konkurrenz auf den Märkten aus und sieht den Homo Oeconomicus als Modell des menschlichen Verhaltens. Die staatliche Intervention wird als überflüssig angesehen.
Keynes
Das keynesianische Paradigma entstand während der Weltwirtschaftskrise als Reaktion auf die Versäumnisse der neoklassischen Theorie. Keynes sah die Wirtschaft als Kreislaufsystem und betonte die Bedeutung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Er argumentierte, dass der Staat durch anti-zyklische Nachfrageprogramme in Rezessionen eingreifen sollte, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Pflichtteil A: Rolle des Arbeitsmarktes, Umgang mit Arbeitslosigkeit
Arbeitsmarkt in der Neoklassik
Die Neoklassik betrachtet den Arbeitsmarkt als einen Markt wie jeden anderen, der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Arbeitslosigkeit wird in der Neoklassik als kurzfristiges Phänomen betrachtet, das durch zu hohe Reallöhne verursacht wird. Der Wettbewerb unter den Arbeitslosen führt zu einer Senkung der Löhne, die zu einem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt.
Arbeitsmarkt im Keynesianismus
Der Keynesianismus sieht die Arbeitslosigkeit als ein Folgeproblem unzureichender gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. Die Politik sollte durch staatliche Interventionen die Nachfrage steigern, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.
Schlüsselwörter
Neoklassik, Keynesianismus, Arbeitsmarkt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Mengentheorie, Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit, grüne Zukunft, Homo Oeconomicus, Preismechanismus, Angebot und Nachfrage, Arbeitslosigkeit, anti-zyklische Nachfrageprogramme, Reallohnsatz, Opportunitätskosten, staatliche Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernunterschiede zwischen Neoklassik und Keynesianismus?
Die Neoklassik vertraut auf Selbstheilungskräfte des Marktes durch den Preismechanismus, während der Keynesianismus staatliche Eingriffe zur Steuerung der Nachfrage betont.
Wie wird Arbeitslosigkeit in der Neoklassik erklärt?
Arbeitslosigkeit gilt hier als freiwillig oder vorübergehend, verursacht durch zu hohe Reallöhne, die über dem Marktgleichgewicht liegen.
Was ist das Konzept der antizyklischen Wirtschaftspolitik?
Es ist eine keynesianische Empfehlung, nach der der Staat in Krisenzeiten die Ausgaben erhöhen und in Boomzeiten senken sollte, um die Konjunktur zu glätten.
Was ist der "Homo Oeconomicus"?
Ein neoklassisches Modell des Menschen als rationaler Nutzenmaximierer, der auf Basis von Preis- und Knappheitssignalen entscheidet.
Welche Kritik gibt es am ständigen Wirtschaftswachstum?
Die Arbeit diskutiert ökologische Grenzen des Wachstums und fordert Lösungsansätze für eine nachhaltige, "grüne" Zukunft jenseits des reinen BIP-Wachstums.
Was untersucht die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)?
Die VGR liefert ein umfassendes quantitatives Bild des wirtschaftlichen Geschehens einer Volkswirtschaft, insbesondere durch Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Konjunktur und Beschäftigung. Geschichte der Neoklassik und des Keynesianismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307611