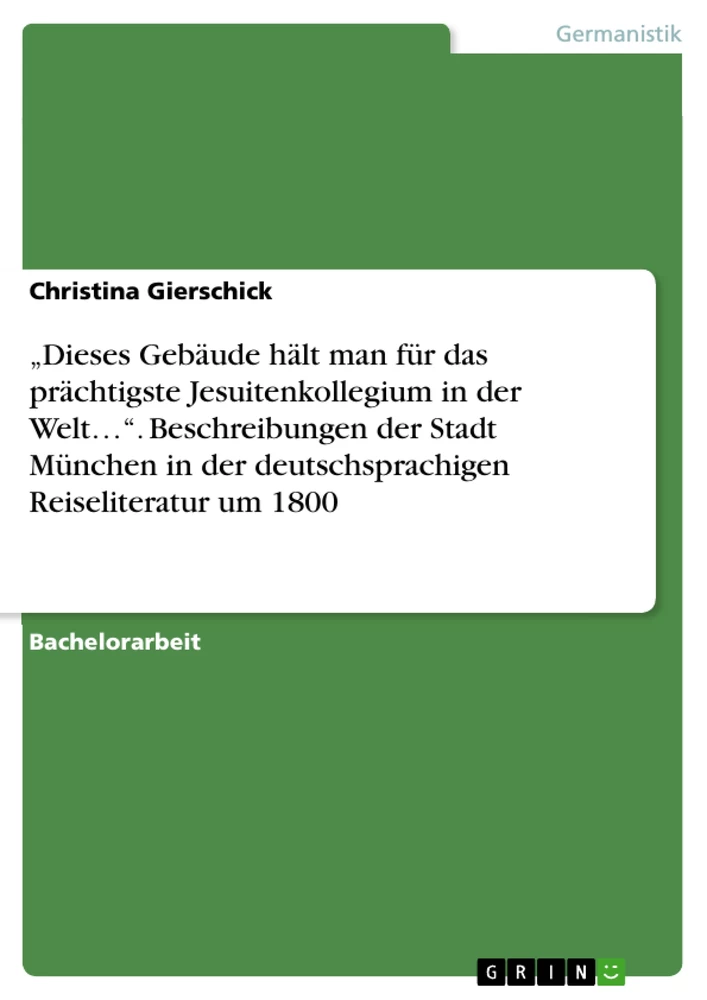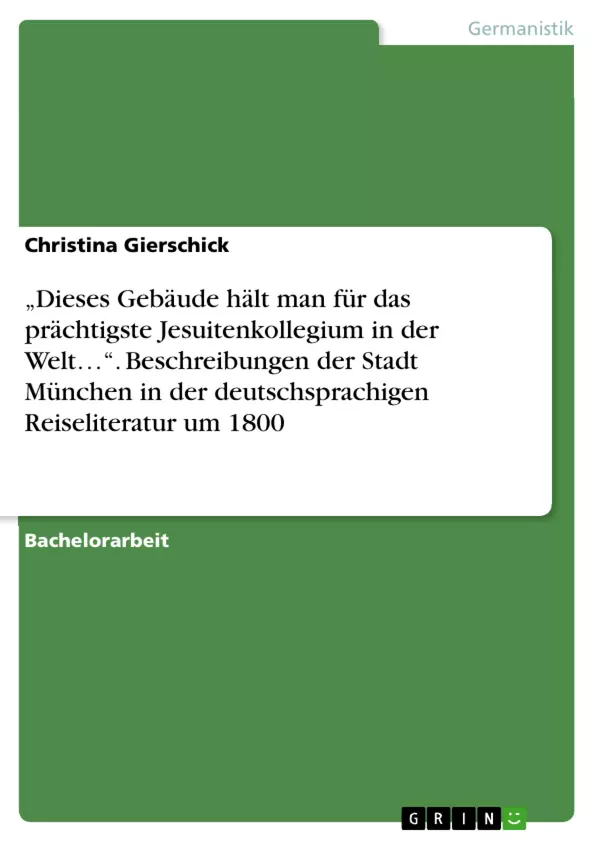Reiseberichte faszinieren: Die Eigenheiten der Gebiete, die Charakteristika der Sprache, der Kultur, sowie der Einwohner, aber auch der Wirtschaft, Bildung und Religion sind über einen kurzen Eindruck definiert und dienen den Daheimgebliebenen als Zeugnisse einer fremden Landschaft, die sie selbst wahrscheinlich niemals sehen werden.
Auch heute noch prägen Reisebeschreibungen den Buchhandel. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Hape Kerkelings "Ich bin dann mal weg", welches 2006 erschien und bereits im Jahr 2008 über 3 Mio. Mal verkauft wurde. Doch die Faszination daran ist kein Phänomen der Moderne. Bereits im 18. Jahrhundert entwickelte sich - neben dem Roman - der Reisebericht zum beliebtesten Genre.
Insgesamt kursierten in Deutschland über 10.000 verschiedene Titel (Übersetzungen aus dem Ausland eingeschlossen). Ab ca. 1750 fanden die Berichte größtenteils Absatz bei Bad-, Bildungs-, und Fachreisenden. Darüber hinaus wurde die barocke Tradition der Kavalierstour aufrechterhalten. Im Zeitalter der Hochaufklärung begann man schließlich politische, bildungsabhängige, soziale sowie medizinische Zustände zu beschreiben. Diese sozialkritischen Reisen sind besonders bei Wilhelm Ludwig Wekhrlin (1739-1792) und Johann Pezzl (1756-1823) zu finden. Den Höhepunkt der Reisebeschreibungen in der Aufklärung mag wohl Friedrich Nicolais (1733-1811) Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz in zwölf erschienenen Bänden sein. In diesem Reisebericht sind die Elemente der bildungs-und sozialkritischen, der forschungs- und fachwissenschaftlichen Reise auf enzyklopädische Art verbunden.
Die drei genannten Autoren durchreisten alle unabhängig voneinander die Reichs- und Residenzstadt München und gaben ihre Eindrücke von der Stadt in ganz unterschiedlicher Art und Weise, aber auch in verschiedener Länge und Schwerpunktsetzung wieder. Alle drei Reisen wurden innerhalb von 15 Jahren (ca. 1770-1785) absolviert und dokumentierten somit einen kleinen, aber doch nicht zu unterschätzenden Teil der Münchner Geschichte.
Ziel dieser Arbeit ist es, die einzelnen Werke und deren Darstellungen der Stadt München, sowie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu charakterisieren. Es soll aber auch aufgezeigt werden, wie die Reiseberichte von der Wirklichkeit bzw. der Meinung des Einheimischen Lorenz Westenrieder abweichen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Gegenwärtiger Forschungsstand
- 3. München im Wandel der Zeit
- 3.1. Das Ministerium
- 3.2. Die Bayrische Akademie der Wissenschaften
- 3.3. Religion
- 3.4. Die Münchner Bevölkerung
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Reisebeschreibungen der Stadt München aus der Feder von Friedrich Nicolai, Johann Pezzl und Wilhelm Ludwig Wekhrlin im 18. Jahrhundert zu analysieren. Sie konzentriert sich dabei auf die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren, deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sowie den Vergleich mit der Sicht des einheimischen Gelehrten Lorenz Westenrieder.
- Die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren auf die Stadt München
- Der Einfluss der Aufklärung auf die Reisebeschreibungen
- Die Rolle von Institutionen wie dem Ministerium und der Bayrischen Akademie der Wissenschaften
- Der Stellenwert der Religion im Münchner Leben
- Die Charakterisierung der Münchner Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel stellt die Reisebeschreibungen als Genre vor und beleuchtet ihre Entwicklung im 18. Jahrhundert, insbesondere in Deutschland. Es werden die verschiedenen Perspektiven der Autoren Nicolai, Pezzl und Wekhrlin auf die Stadt München vorgestellt, und es wird auf die Relevanz dieser Werke für das Verständnis der Münchner Geschichte hingewiesen.
- Kapitel 2: Gegenwärtiger Forschungsstand Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Stand der Forschung zu Reisebeschreibungen in München im 18. Jahrhundert. Es wird deutlich, dass es bisher keine umfassende Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt, und die Gründe dafür werden analysiert. Weiterhin wird auf den Forschungsstand zu den einzelnen Autoren sowie zur historischen und städtischen Entwicklung Münchens eingegangen.
- Kapitel 3: München im Wandel der Zeit Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Reisebeschreibungen, darunter das Ministerium, die Bayrische Akademie der Wissenschaften, die Religion und die Münchner Bevölkerung. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren auf diese Bereiche analysiert und miteinander verglichen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit Reisebeschreibungen, München, 18. Jahrhundert, Friedrich Nicolai, Johann Pezzl, Wilhelm Ludwig Wekhrlin, Lorenz Westenrieder, Aufklärung, Ministerium, Bayrische Akademie der Wissenschaften, Religion, Münchner Bevölkerung, Stadtgeschichte, Vergleichende Analyse.
- Quote paper
- Christina Gierschick (Author), 2013, „Dieses Gebäude hält man für das prächtigste Jesuitenkollegium in der Welt…“. Beschreibungen der Stadt München in der deutschsprachigen Reiseliteratur um 1800, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307707