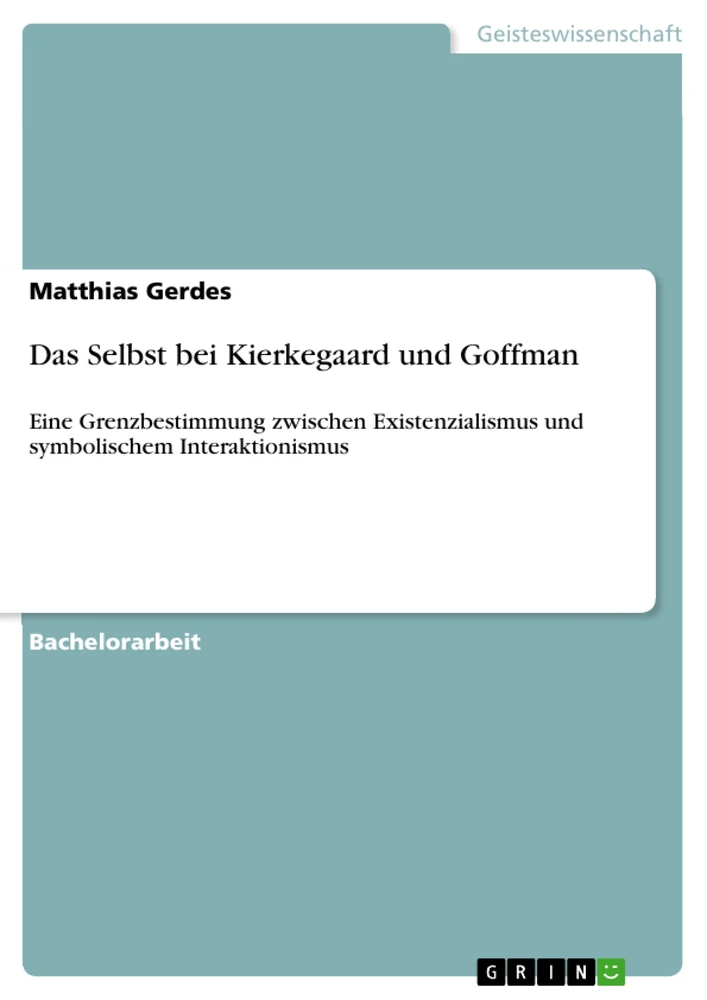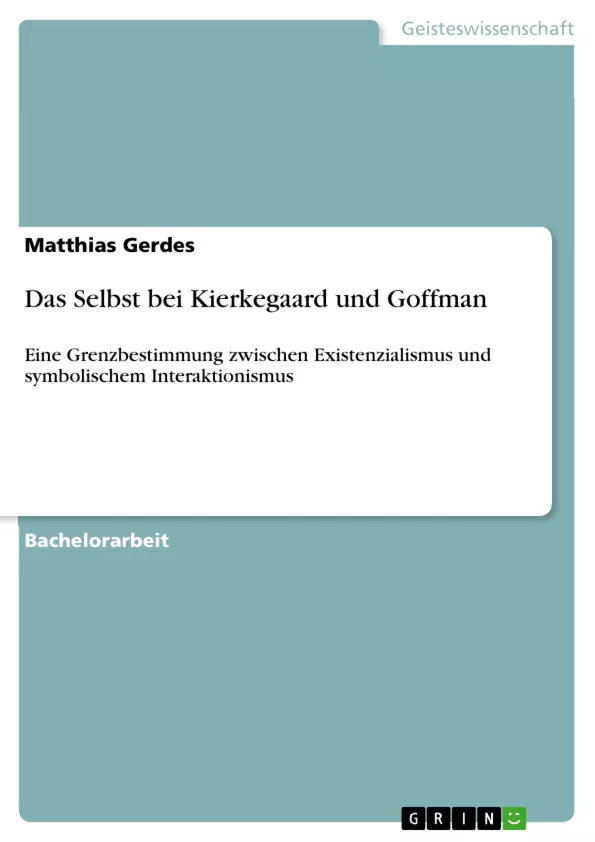So möchte ich in dieser vorliegenden Arbeit der Frage nachgehen, inwiefern das menschliche Selbst aus Sicht des Existenzialismus und des symbolischen Interaktionismus konstruiert wird. Exemplarisch für diese beiden Strömungen möchte ich mich in dieser Arbeit mit den Werken von Erving Goffman, als Vertreter des symbolischen Interaktionismus, und mit den Werken von Sören Kierkegaard, als Vertreter des Existenzialismus, auseinandersetzten. So soll meine Untersuchungsfrage folgendermaßen lauten: - Wie wird das menschliche Selbst nach Goffman und Kierkegaard konstruiert und welchen Einfluss hat das Gefühl der Angst auf das Selbst nach Goffman und Kierkegaard?
Dabei soll es in dieser vorliegenden Arbeit nicht um eine bloße Darstellung der Theorien beider Autoren zu dieser Frage gehen, sondern ich möchte insbesondere großen Wert auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Autoren zu dieser Frage legen. Inhaltlich möchte ich mich bei dieser vergleichenden Analyse hauptsächlich auf die Werke „Stigma“ und „Wir alle spielen Theater“ (Goffman) sowie „Die Krankheit zum Tode“ und „Der Begriff der Angst“ (Kierkegaard) beziehen. So ergibt sich die Struktur der Arbeit im Wesentlichen aus der eingangs gestellten Fragestellung. Demnach wird die Arbeit grob in drei große Blöcke unterteilt. Im ersten Teil werde ich Sören Kierkegaards Theorie und Standpunkt zum menschlichen Selbst darzulegen. Im zweiten Teil werde ich aufzeigen, wie Erving Goffman das menschliche Selbst sieht und im letzten und dritten Teil werde ich die Standpunkte beider Autoren mit Hilfe von folgenden drei Thesen vergleichen:
- Beide Autoren gehen von der Vorstellung aus, dass der Mensch kein fertig gesetztes Wesen ist, sondern sich im Laufe seines Lebens ein Selbst aneignet.
- Beide Autoren gehen von der Vorstellung aus, dass Angst (und Verzweiflung) den Menschen grundlegend konstituieren.
- Die Strategien der stigmatisierten Personen zur Wahrung ihrer Identität sind die Erscheinungsformen der eigentlichen Verzweiflung nach Kierkegaard.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kierkegaards Grundbestimmung des Menschen
- Der Begriff Angst
- Die Erscheinungsformen dieser Krankheit
- Uneigentliche Form der Verzweiflung
- Eigentliche Form der Verzweiflung
- Verzweifelt nicht man selbst sein wollen.
- Verzweifelt man selbst sein zu wollen.
- Die Möglichkeit der Freiheit
- Der Weg zum Selbst
- Verzweiflung als Bestimmung des Geistes
- Goffmans Grundbestimmung des Menschen
- Stigma-Der Umgang mit einer beschädigten Identität.
- Stigmata-Management
- Informationskontrolle.
- Die Konstruktion der Identität im Alltag- „Wir alle Spielen Theater"
- Rolle
- Darstellung
- Dramatische Gestaltung
- Idealisierung
- Zur Methodik der vergleichenden Analyse
- Das Selbst bei Kierkegaard
- Das Selbst bei Goffman
- Analyse der Vergleichsthesen
- Erste Vergleichsthese
- Zweite Vergleichsthese
- Angst und Verzweiflung bei Kierkegaard.
- Angst und Verzweiflung bei Goffman
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Konstruktion des menschlichen Selbst aus der Perspektive des Existenzialismus und des symbolischen Interaktionismus zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Werke von Sören Kierkegaard und Erving Goffman, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Ansichten zum Selbst und dem Einfluss von Angst auf dieses zu beleuchten.
- Die Konstruktion des menschlichen Selbst im Existenzialismus und symbolischen Interaktionismus
- Die Rolle der Angst und Verzweiflung in der Selbstfindung
- Der Einfluss von sozialer Interaktion auf die Identität
- Die Strategien zur Bewältigung von Stigmata
- Der Vergleich der Theorien von Kierkegaard und Goffman
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor, die sich mit der Konstruktion des menschlichen Selbst aus der Sicht des Existenzialismus und des symbolischen Interaktionismus beschäftigt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Werke von Sören Kierkegaard und Erving Goffman, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Ansichten zum Selbst und dem Einfluss von Angst auf dieses zu beleuchten.
- Kierkegaards Grundbestimmung des Menschen: Dieses Kapitel behandelt Kierkegaards Theorie des Selbst, die sich auf die zentrale Rolle der Verzweiflung und Angst konzentriert. Kierkegaard versteht den Menschen als ein komplexes Verhältnis, eine Synthese von Endlichkeit und Unendlichkeit, die durch ein ständiges Sich-Verhalten gekennzeichnet ist.
- Die Erscheinungsformen dieser Krankheit: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Erscheinungsformen der Verzweiflung nach Kierkegaard. Dabei wird zwischen einer uneigentlichen und einer eigentlichen Form der Verzweiflung unterschieden. Die uneigentliche Form der Verzweiflung zeichnet sich durch einen verzweifelten Versuch aus, nicht man selbst sein zu wollen, während die eigentliche Form der Verzweiflung sowohl das Verzweifeln, nicht man selbst sein zu wollen, als auch das Verzweifeln, man selbst sein zu wollen, umfasst.
- Die Möglichkeit der Freiheit: Dieses Kapitel beleuchtet die Möglichkeit der Freiheit im Kontext von Kierkegaards Theorie des Selbst. Der Weg zum Selbst wird als ein Prozess der Selbstfindung beschrieben, der durch Verzweiflung geprägt ist. Verzweiflung wird dabei als eine notwendige Voraussetzung für die Selbstfindung angesehen.
- Goffmans Grundbestimmung des Menschen: Dieses Kapitel stellt Goffmans Theorie des symbolischen Interaktionismus vor, die sich auf die soziale Konstruktion der Identität konzentriert. Goffman argumentiert, dass die Identität des Menschen durch Interaktion und Darstellung im sozialen Kontext geformt wird.
- Stigma-Der Umgang mit einer beschädigten Identität.: Dieses Kapitel befasst sich mit Goffmans Konzept des Stigmas. Goffman analysiert, wie Menschen mit einer beschädigten Identität im sozialen Kontext umgehen. Dabei werden verschiedene Strategien des Stigmata-Managements und der Informationskontrolle vorgestellt.
- Die Konstruktion der Identität im Alltag- „Wir alle Spielen Theater": Dieses Kapitel untersucht Goffmans Theorie der "dramaturgischen Analyse", die den Alltag als Theater betrachtet. Goffman analysiert, wie Menschen im sozialen Kontext Rollen übernehmen und sich in bestimmten Situationen darstellen. Dieses Kapitel beleuchtet auch die Rolle der Idealisierung im Rahmen der Selbstdarstellung.
- Zur Methodik der vergleichenden Analyse: Dieses Kapitel erläutert die Methodik der vergleichenden Analyse, die in der vorliegenden Arbeit angewendet wird. Es werden die zentralen Annahmen von Kierkegaard und Goffman zum Selbst vorgestellt.
- Analyse der Vergleichsthesen: Dieses Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien von Kierkegaard und Goffman. Es werden drei zentrale Thesen vorgestellt und anhand der Werke beider Autoren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Existenzialismus, symbolischer Interaktionismus, Selbst, Identität, Angst, Verzweiflung, Stigma, soziale Interaktion, Darstellung, Goffman, Kierkegaard. Diese Begriffe repräsentieren die Kernaspekte der beiden Theorien und die grundlegende Fragestellung der Arbeit. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Konstruktion des Selbst und der Rolle der Angst und Verzweiflung in diesem Prozess.
Häufig gestellte Fragen
Wie definieren Kierkegaard und Goffman das "Selbst"?
Kierkegaard sieht das Selbst als ein metaphysisches Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, während Goffman es als ein Produkt sozialer Interaktion (Theater) betrachtet.
Welche Rolle spielt Angst bei der Selbstwerdung?
Für beide ist Angst konstitutiv: Bei Kierkegaard ist sie die "Schwindel der Freiheit", bei Goffman die Angst vor dem Gesichtsverlust in der sozialen Darstellung.
Was ist "Stigmata-Management" nach Goffman?
Es beschreibt die Strategien, mit denen Personen eine "beschädigte Identität" verbergen oder kontrollieren, um in der Gesellschaft als normal zu gelten.
Was meint Kierkegaard mit der "Krankheit zum Tode"?
Er meint damit die Verzweiflung, entweder man selbst sein zu wollen oder gerade nicht man selbst sein zu wollen, was den Geist des Menschen zersetzt.
Inwiefern ist der Alltag laut Goffman ein Theater?
In "Wir alle spielen Theater" zeigt Goffman, dass Menschen in jeder Interaktion Rollen einnehmen und eine bestimmte Fassade aufrechterhalten, um ihr Selbst zu konstruieren.
- Quote paper
- Matthias Gerdes (Author), 2015, Das Selbst bei Kierkegaard und Goffman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307725