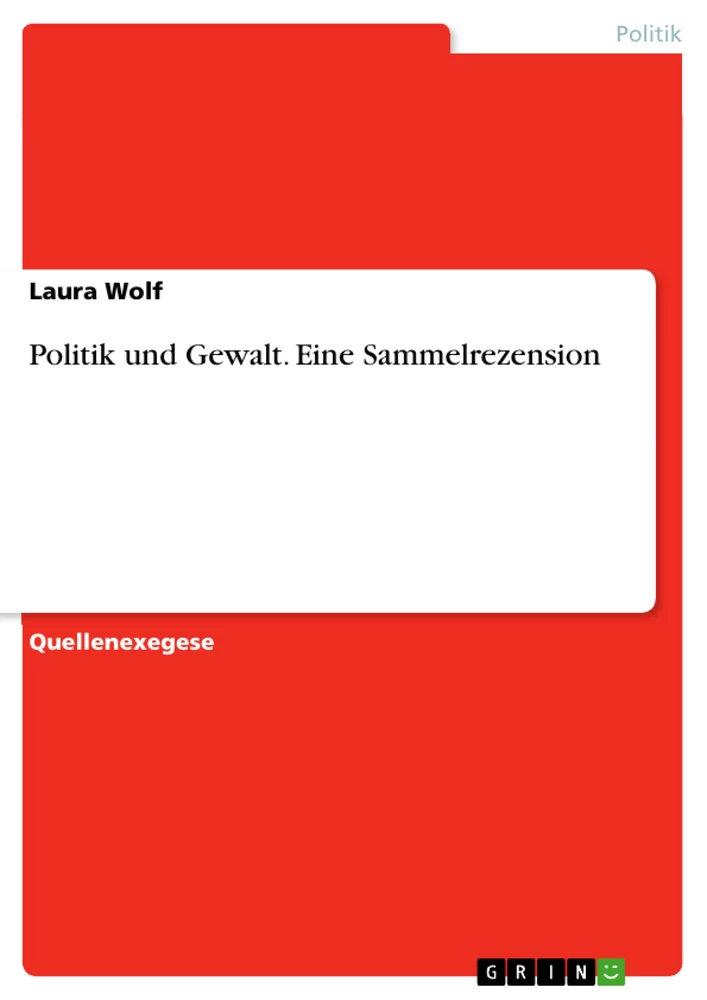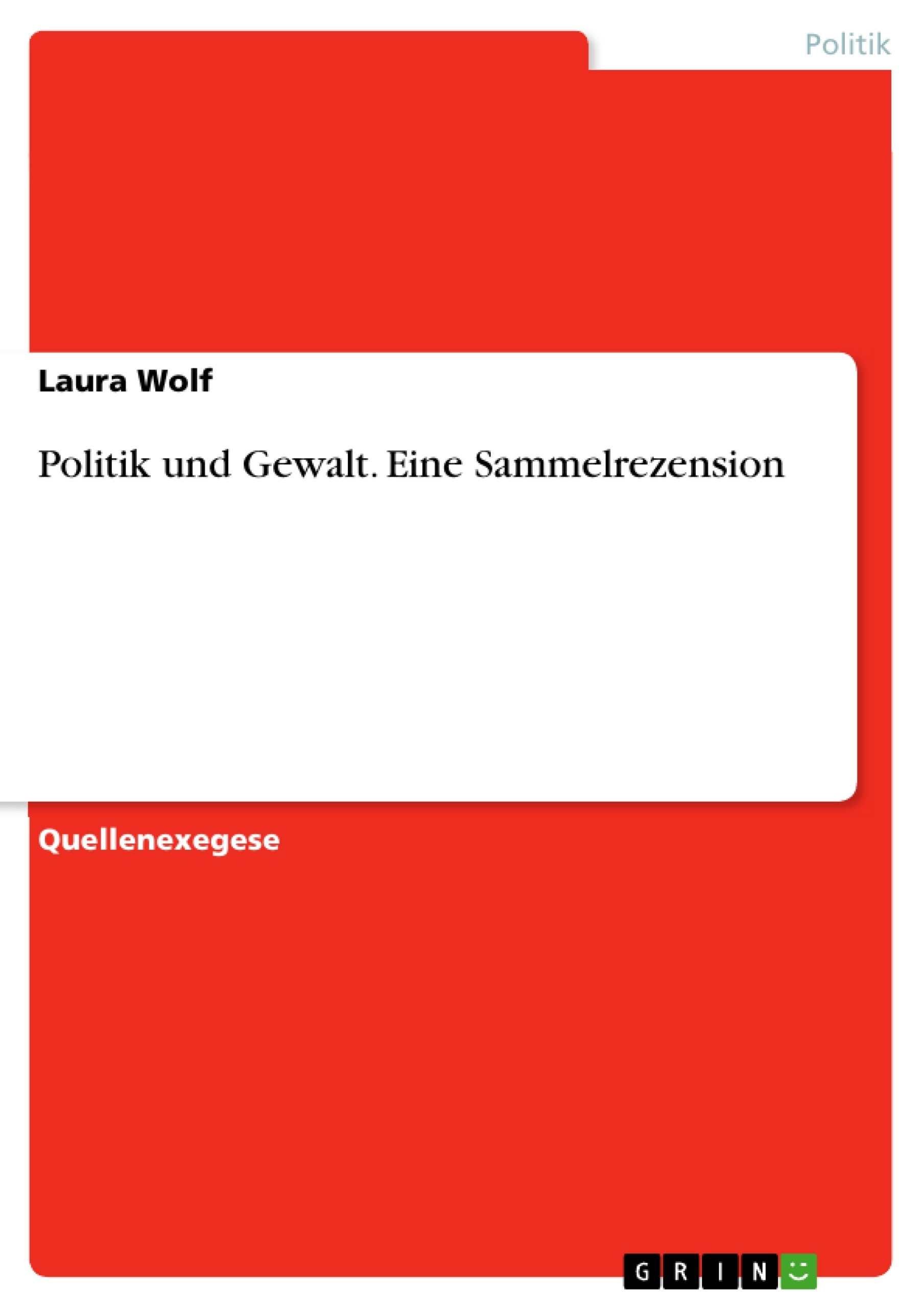In der folgenden Sammelrezension werde ich die vier politikwissenschaftlichen Theorien von Carl Schmitt, Hannah Arendt, Niklas Luhmann und Judith Butler erläutern.
Carl Schmitt und Hannah Arendt könnten in ihrer Einstellung zur Politik nicht unterschiedlicher sein:
Während er im zweiten Weltkrieg auf der Seite des Nationalsozialismus aufzufinden war, wurde sie als Jüdin verfolgt.
Das äußert sich auch in ihren beiden Theorien: Für Carl Schmitt ist der Krieg etwas Essenzielles ohne den es keine Politik gibt, während Hannah Arendt Gewalt gänzlich als Abwesenheit von Macht versteht.
Darauf werde ich allerdings in Abschnitt 3 (Vergleich von Carl Schmitts Theorie mit Hannah Arendts) genauer eingehen.
Niklas Luhmann, ein Unterstützer der Systemtheorie sieht den Wandel, die Politik als etwas, das aus Kommunikationsvorgängen hervorgeht.
Dieser Auffassung ist auch Judith Butler, die allerdings genauer auf die eigentliche Macht der Sprache eingeht.
Beide empfinden die Sprache, die Kommunikation als essenziell für Politik.
Hierauf werde ich in Abschnitt 4 (Vergleich von Niklas Luhmanns Theorie mit Judith Butlers Auffassung von Politik) genauer eingehen.
Am Ende der beiden Vergleiche verfasse ich ein Schlusswort, dass das Thema „Gewalt“ abschließt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Verständnis von Politik
- 1.1. Carl Schmitt
- 1.2. Hannah Arendt
- 1.3. Niklas Luhmann
- 1.4. Judith Butler
- 3. Vergleich von Carl Schmitts mit Hannah Arendts Auffassung von Macht
- 4. Vergleich von Niklas Luhmanns mit Judith Butlers Auffassung von Gewalt
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Sammelrezension analysiert und vergleicht vier politikwissenschaftliche Theorien von Carl Schmitt, Hannah Arendt, Niklas Luhmann und Judith Butler, um ein tieferes Verständnis von Politik und Gewalt zu entwickeln. Die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf Macht und Gewalt und untersucht die Rolle der Kommunikation und des Krieges in politischen Zusammenhängen.
- Das Verhältnis von Politik und Gewalt
- Die Bedeutung der Sprache und Kommunikation in der Politik
- Die Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt
- Der Stellenwert des Krieges in politischen Theorien
- Die Konzepte von Freund und Feind in der Politik
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die vier untersuchten Theorien von Carl Schmitt, Hannah Arendt, Niklas Luhmann und Judith Butler vor und skizziert die zentralen Themen der Rezension. Im zweiten Kapitel wird das Verständnis von Politik aus der Perspektive der vier Denker beleuchtet.
Kapitel 1.1 widmet sich Carl Schmitts protomilitärischem Ansatz und seiner Kritik an der modernen Politik. Dabei wird die zentrale Rolle der Freund-Feind-Unterscheidung und des Krieges für Schmitts Theorie hervorgehoben.
Kapitel 1.2 bietet eine kurze Einführung in Hannah Arendts Denkweise und ihren Text „Macht und Gewalt“.
Kapitel 1.3 und 1.4 konzentrieren sich auf die Theorien von Niklas Luhmann und Judith Butler. Dabei wird ihre Sicht auf die Bedeutung der Kommunikation und Sprache in der Politik beleuchtet.
Die Kapitel 3 und 4 vergleichen die Theorien von Carl Schmitt mit Hannah Arendt sowie Niklas Luhmann mit Judith Butler und analysieren die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf Macht und Gewalt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Begriffe der Rezension sind: Politik, Gewalt, Macht, Freund-Feind-Unterscheidung, Kommunikation, Sprache, Krieg, Systemtheorie, moderne politische Theorie, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Niklas Luhmann, Judith Butler.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich Carl Schmitt und Hannah Arendt in ihrem Gewaltbegriff?
Für Carl Schmitt ist der Krieg und die Freund-Feind-Unterscheidung essenziell für die Politik. Hannah Arendt hingegen sieht Gewalt als das Gegenteil von Macht; wo Gewalt herrscht, endet für sie die Politik.
Was ist Niklas Luhmanns Sicht auf die Politik?
Luhmann betrachtet Politik im Rahmen seiner Systemtheorie als ein Ergebnis von Kommunikationsvorgängen innerhalb eines sozialen Systems.
Welchen Stellenwert hat die Sprache bei Judith Butler?
Butler betont die "Macht der Sprache". Kommunikation ist für sie nicht nur Informationsaustausch, sondern ein Instrument zur Herstellung und Festigung politischer Realitäten.
Was bedeutet die "Freund-Feind-Unterscheidung" bei Carl Schmitt?
Es ist das spezifisch politische Kriterium, das besagt, dass Politik erst dort entsteht, wo eine Gruppe Menschen in Freund und Feind eingeteilt wird.
Wie hängen Kommunikation und Gewalt zusammen?
Die Arbeit vergleicht Theorien, die Gewalt als Abbruch von Kommunikation (Arendt) oder als Teil eines diskursiven Machtgefüges (Butler/Luhmann) verstehen.
- Quote paper
- Laura Wolf (Author), 2015, Politik und Gewalt. Eine Sammelrezension, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307734