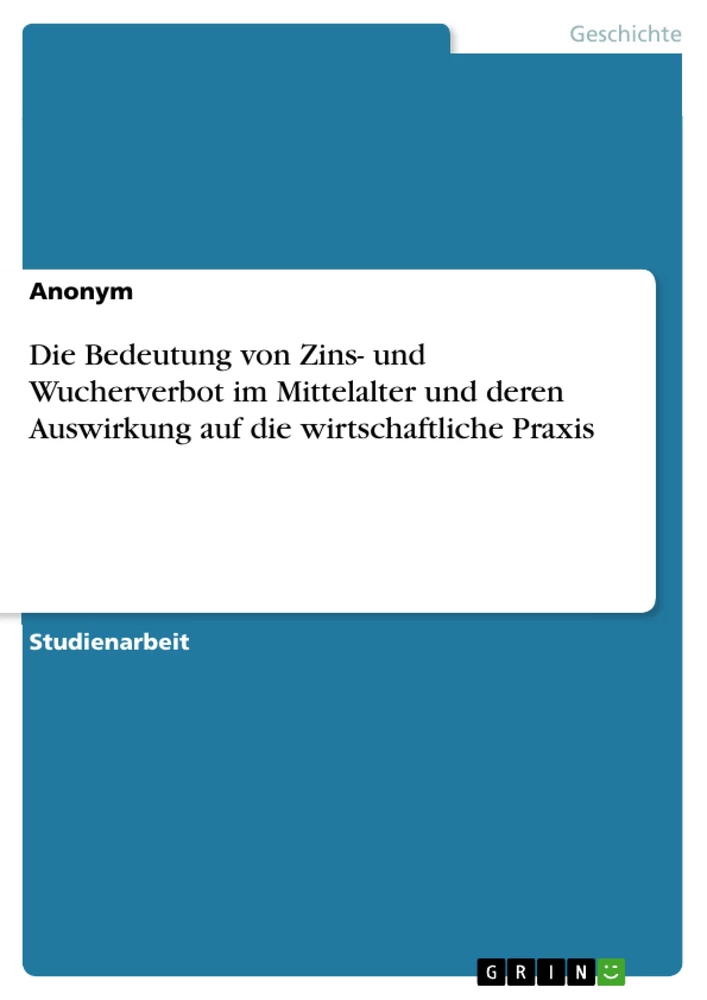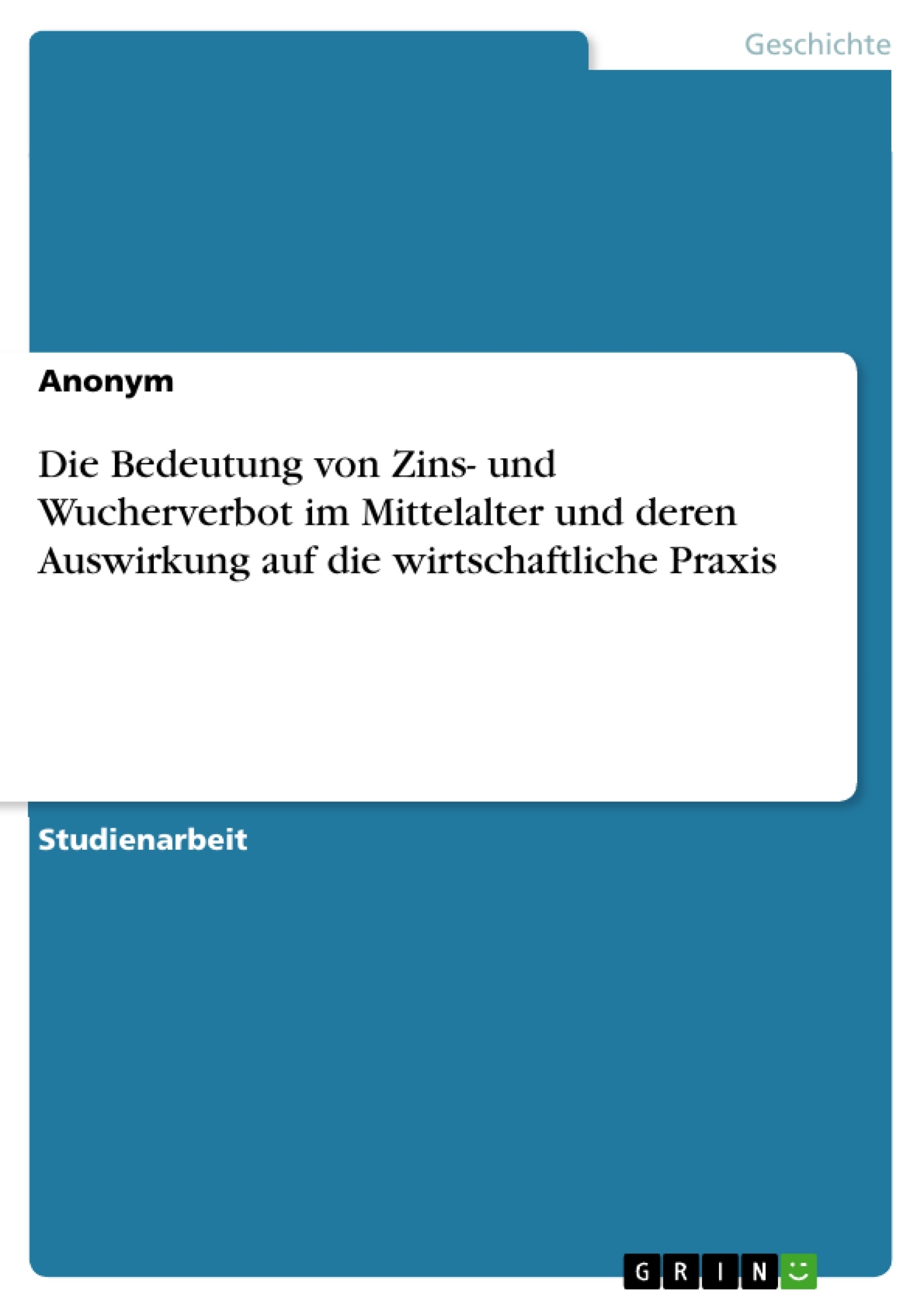Die vorliegende Arbeit behandelt die Frage, auf welchen Pfeilern das Zinsverbot im Hoch- und Spätmittelalter gebaut worden ist, was es genau umfasst und warum die Zinslehre der Kirche in der Form existierte. Des Weiteren soll die Frage nach der Relevanz jener für die mittelalterliche Wirtschaft in der Praxis beantwortet und der letztendliche Effekt der kirchlichen Wucherlehre herausgearbeitet werden.
Zins und Wucher waren in der durch materielle Güter geprägten frühmittelalterlichen Wirtschaft und Gesellschaft nur bedingt ein relevantes Thema. Dies änderte sich jedoch mit der ökonomischen Entwicklung des Hoch- und Spätmittelalters und dem damit entstandenen Kapitalmarkt. Den Kredit in unterschiedlichster Gestalt gab gewissermaßen schon immer. Doch jene Zeit ab dem 12. Jahrhundert n. Chr. war Beginn eines Wandels der feudalen Wirtschaft und die Kirche aber auch weltliche Herrscher sahen sich gezwungen diese Entwicklung kontrollieren zu wollen. Die Kirche tat dies mit einem Verbot des Wuchers und der Strafandrohung bei Missachtung dessen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie sich das Kreditwesen unter Berücksichtigung der kirchlichen Wucherlehre entwickelte und, welche Auswirkungen das Verbot in der Realität hatte.
Dazu sollen zu Beginn die Begriffe an sich und deren Verwendung thematisiert werden. Im Hauptteil der Arbeit soll in der ersten Hälfte auf den Ursprung der kirchlichen Wucherlehre und deren Ausprägung und Festlegung ab dem 12. Jahrhundert eingegangen werden. In der zweiten Hälfte soll jene Theorie auf deren Wirksamkeit in der Praxis untersucht werden. Zuerst sollen Umgehungsstrategien genannt werden und danach eine Darstellung des mittelalterlichen Kreditwesens im Spiegel des Zins- und Wucherverbotes folgen, um mit einem abschließenden Fazit enden zu können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Begriffsdefinition und -verwendung
- Die Bedeutung von Zins- und Wucherverbot im Mittelalter und deren Auswirkung auf die wirtschaftliche Praxis
- Grundlagen von Zins- und Wucherverbot in der Theorie
- Der Ursprung der kirchlichen Usuralehre
- Zins- und Wucherverbot ab dem 12. Jahrhundert.
- Zins- und Wucherverbot in der wirtschaftlichen Praxis.
- Umgehungsgeschäfte.
- Das Zins- und Kreditgeschäft im Spiegel des Wucherverbots........
- Grundlagen von Zins- und Wucherverbot in der Theorie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich das Zins- und Wucherverbot der Kirche im Mittelalter auf die wirtschaftliche Praxis auswirkte. Ziel ist es, die Grundlagen der Usuralehre zu beleuchten, deren Relevanz für die mittelalterliche Wirtschaft zu untersuchen und den Effekt des Verbots in der Realität herauszuarbeiten.
- Entwicklung und Bedeutung des Zins- und Wucherverbots im Mittelalter
- Der Ursprung und die Ausprägung der kirchlichen Usuralehre
- Die Auswirkung des Verbots auf das Kreditwesen und die wirtschaftliche Praxis
- Umgehungsstrategien und die Rolle des Zinsverbots im mittelalterlichen Kreditgeschäft
- Die Relevanz der Usuralehre für die mittelalterliche Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt das Thema Zins und Wucher in der mittelalterlichen Wirtschaft vor und erläutert den Wandel des Kreditwesens ab dem 12. Jahrhundert.
- Das Kapitel "Begriffsdefinition und -verwendung" definiert die Begriffe "Zins" und "Wucher" und untersucht deren Verwendung in mittelalterlichen Quellen.
- Das Kapitel "Die Bedeutung von Zins- und Wucherverbot im Mittelalter und deren Auswirkung auf die wirtschaftliche Praxis" untersucht die Grundlagen der kirchlichen Usuralehre. Es geht auf den Ursprung der Lehre, die Ausprägung ab dem 12. Jahrhundert sowie die Wirksamkeit in der Praxis ein.
Schlüsselwörter (Keywords)
Zinsverbot, Wucher, Usuralehre, Mittelalter, Kirche, Wirtschaft, Kreditwesen, Umgehungsgeschäfte, fruchtloses Geld, natürliches Recht, biblische Lehre, "census", "usura", "fenus", "reditus", "turpe lucrum", "pretium iustum", "wuohhar"
Häufig gestellte Fragen
Warum verbot die Kirche im Mittelalter Zinsen?
Das Zinsverbot basierte auf biblischen Lehren und der Vorstellung, dass Geld „unfruchtbar“ sei und Zeit (die Gott gehört) nicht verkauft werden dürfe.
Was galt im Mittelalter als „Wucher“ (Usura)?
Als Wucher galt jede Forderung, die über den geliehenen Betrag hinausging, da dies als sündhafter Gewinn aus der Notlage anderer angesehen wurde.
Wie wurde das Zinsverbot in der wirtschaftlichen Praxis umgangen?
Händler nutzten Umgehungsstrategien wie Wechselgeschäfte, Rentenkäufe oder versteckte Gebühren in Kaufverträgen, um dennoch Gewinne aus Kapital zu erzielen.
Welche Auswirkungen hatte das Verbot auf das jüdische Kreditwesen?
Da das kirchliche Verbot primär für Christen galt, besetzten Juden oft die Nische des Geldverleihs, was jedoch zu sozialen Spannungen und Stigmatisierungen führte.
Wann begann das Zinsverbot zu wanken?
Ab dem 12. Jahrhundert zwang die Entstehung eines Kapitalmarktes die Kirche dazu, ihre Lehre anzupassen und Ausnahmen (z.B. für Verzugsschäden) zuzulassen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Die Bedeutung von Zins- und Wucherverbot im Mittelalter und deren Auswirkung auf die wirtschaftliche Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307840