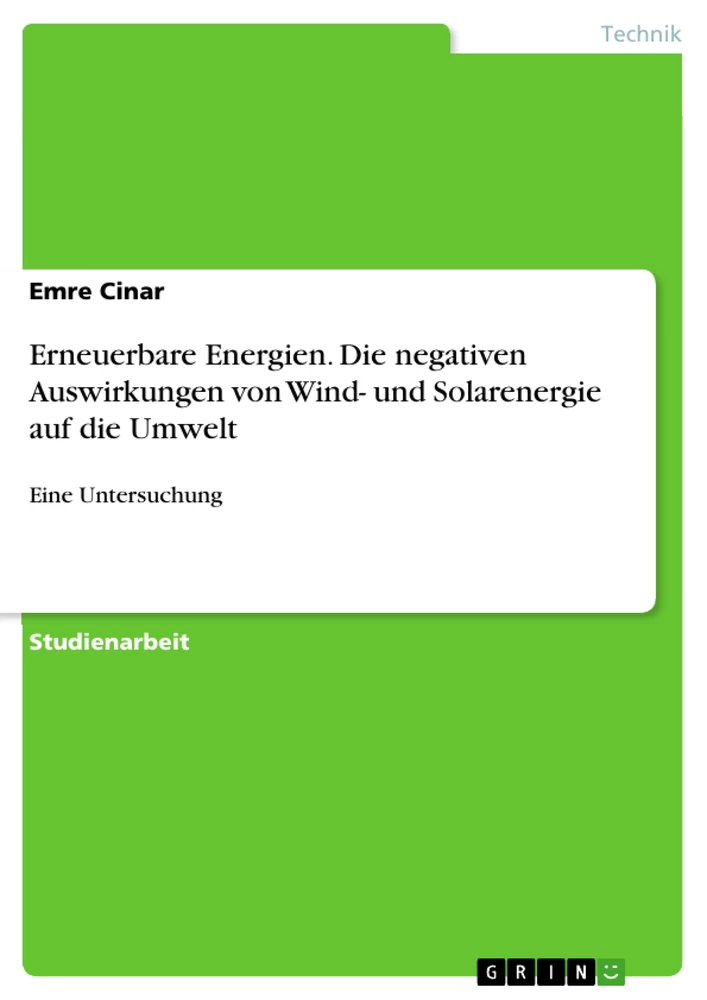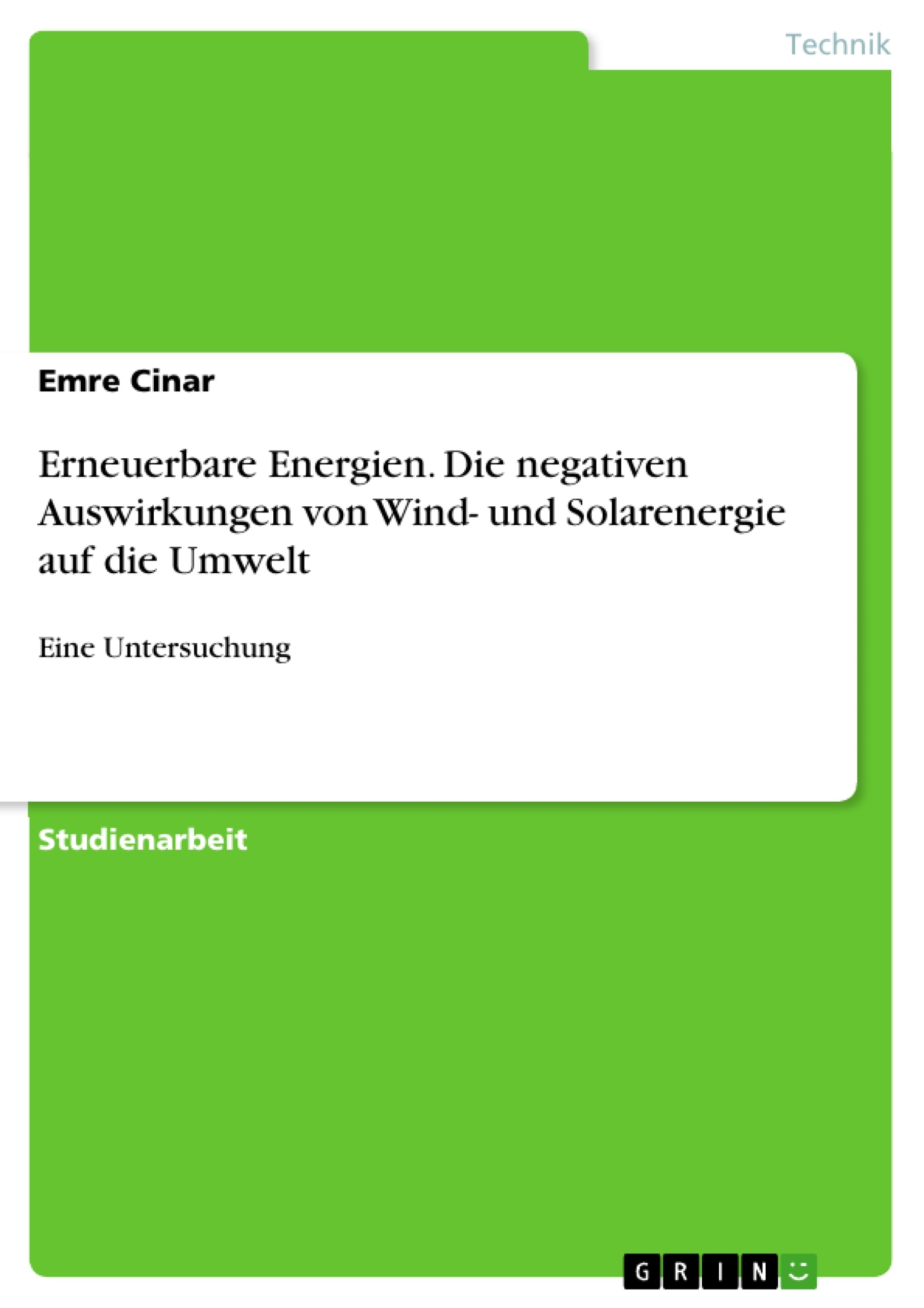Diese Hausarbeit handelt von der Nachhaltigkeit und den Funktionsweisen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien. Was sind die negativen Auswirkungen von Wind- und Solarenergie auf die Umwelt? Hierbei wird im Allgemeinteil der Aufbau und die Geschichte der verschiedenen Möglichkeiten, erneuerbare Energie zu gewinnen, erläutert. Vertieft wird die Energieerwirtschaftung durch Solar- und Windkraftanlagen, da diese die Art von Stromerzeugung ist, von der man am meisten mitbekommt. Doch, wie diese Arbeit aufzuzeigen versucht, gefährdet diese Art von Stromherstellung die Bevölkerung, die Tierwelt und die Umwelt.
Hierzu werden der Aufbau und die Funktionsweise diverser Einrichtungen zur Gewinnung von vermeintlich sauberer Energie erläutert. Im Bezug auf die Leitfrage werden die negativen Auswirkungen auf den Menschen, die Flora und Fauna in mehreren Beispielen dargestellt. Außerdem bezieht die Arbeit Stellung zur aktuellen Entwicklung der spezifischen Anlagemöglichkeiten zur Gewinnung von erneuerbaren Energien, wobei der Schwerpunkt auf der Bundesrepublik Deutschland liegt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einführung
- 2. Erneuerbare Energien
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Windkraftanlagen
- 2.3 Solarenergie
- 3. Negative Auswirkungen auf die Umwelt:
- 3.1 Solarenergie
- 3.2 Negative Auswirkung Windkraft:
- 4. Aktuelle Entwicklung
- 5. Fazit:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht die Nachhaltigkeit und Funktionsweisen der Gewinnung erneuerbarer Energien, insbesondere die Auswirkungen von Wind- und Solarenergie auf die Umwelt. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte und den Aufbau verschiedener Methoden zur Gewinnung erneuerbarer Energien, wobei der Fokus auf Solar- und Windkraftanlagen liegt, da diese am häufigsten sichtbar sind. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Risiken dieser Technologien für die Umwelt, die Tierwelt und die menschliche Gesundheit.
- Die Bedeutung erneuerbarer Energien für die Energiewende
- Die Funktionsweise von Solar- und Windkraftanlagen
- Die negativen Auswirkungen von Wind- und Solarenergie auf die Umwelt
- Die aktuelle Entwicklung der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland
- Der Vergleich der Nachhaltigkeit von Wind- und Solarenergie mit konventionellen Energiequellen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 führt in das Thema der Erneuerbaren Energien ein und stellt die Forschungsfrage nach den negativen Auswirkungen von Wind- und Solarenergie auf die Umwelt. Kapitel 2 definiert den Begriff der Erneuerbaren Energien und erläutert die Funktionsweise von Solar- und Windkraftanlagen. Kapitel 3 analysiert die negativen Auswirkungen dieser Technologien auf die Umwelt, wobei der Fokus auf den Einfluss auf die Tierwelt, die menschliche Gesundheit und die Landschaft liegt. Kapitel 4 befasst sich mit der aktuellen Entwicklung der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland.
Schlüsselwörter (Keywords)
Erneuerbare Energien, Windkraft, Solarenergie, Energiewende, Nachhaltigkeit, Umweltbelastung, Tierwelt, menschliche Gesundheit, Landschaft, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Welche negativen Auswirkungen hat Windkraft auf die Tierwelt?
Windkraftanlagen können Vögel und Fledermäuse gefährden (Schlagopfer). Zudem können sie Lebensräume durch Lärm und Infraschall stören und Wanderrouten beeinträchtigen.
Gibt es Umweltprobleme bei der Solarenergie?
Ja, die Herstellung von Solarzellen erfordert oft seltene Rohstoffe und Chemikalien. Zudem führen großflächige Solarparks zu einer Versiegelung oder Veränderung von Flächen, was die lokale Flora und Fauna beeinflusst.
Wie beeinflussen Windräder die menschliche Gesundheit?
Anwohner berichten teils über Belastungen durch Infraschall, Lärmemissionen und den sogenannten optischen Bedrängungseffekt (Schattenwurf), was das Wohlbefinden beeinträchtigen kann.
Sind erneuerbare Energien wirklich „sauber“?
Die Arbeit argumentiert, dass sie zwar CO2-ärmer als fossile Brennstoffe sind, aber dennoch ökologische Fußabdrücke hinterlassen, die bei einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtung berücksichtigt werden müssen.
Wie entwickelt sich die Wind- und Solarkraft in Deutschland?
Deutschland setzt massiv auf diese Technologien für die Energiewende. Die Arbeit beleuchtet jedoch kritisch, dass der schnelle Ausbau oft im Konflikt mit dem Naturschutz und den Interessen der lokalen Bevölkerung steht.
- Quote paper
- Emre Cinar (Author), 2015, Erneuerbare Energien. Die negativen Auswirkungen von Wind- und Solarenergie auf die Umwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307852