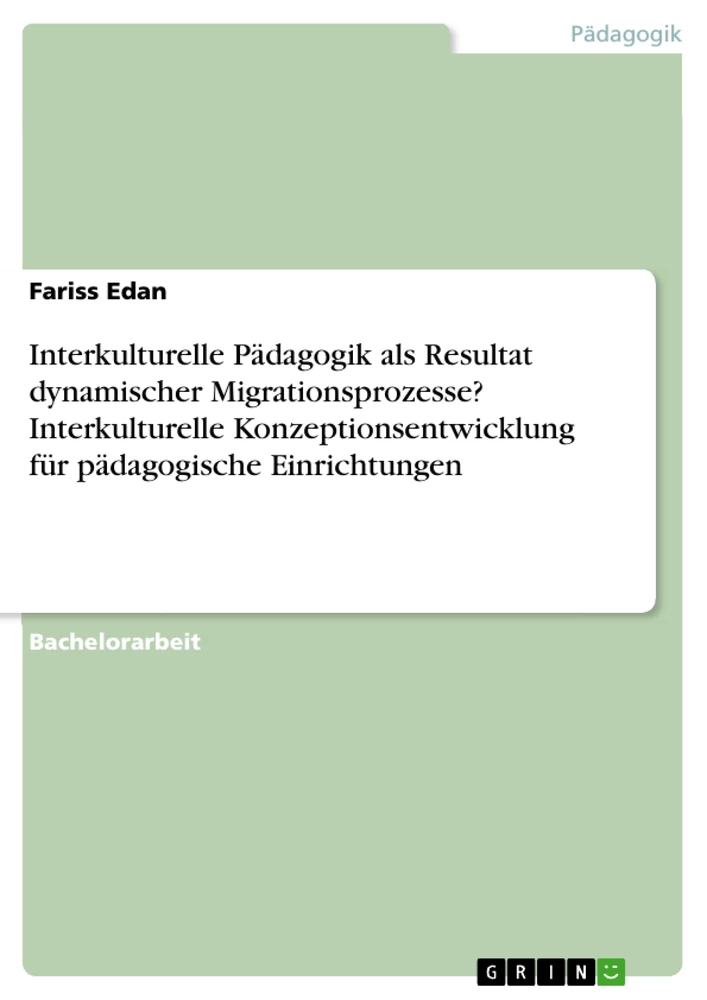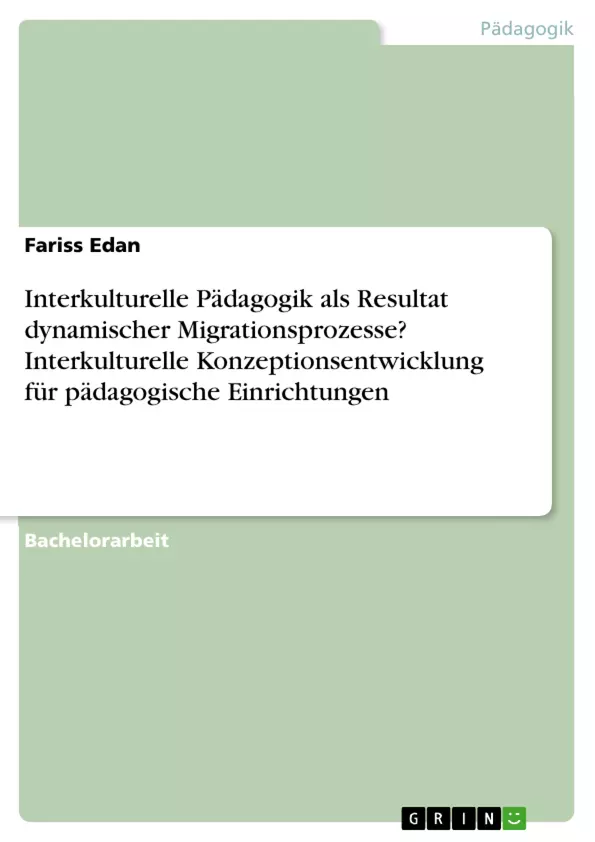Laut dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes von 2013 leben rund 16,5 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland, was einem Anteil von 20,5 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Die Pluralisierung der kulturellen Lebenseinflüsse und Lebenswelten nimmt in Mehrheitsgesellschaften immer mehr zu. Vielfalt der Kulturen stellt in Einwanderungsgesellschaften, wie auch Deutschland eine ist, einen wichtigen Teil dar, der auch aus dem beruflichen Alltag von pädagogischem Fachpersonal nicht mehr wegzudenken ist.
Im Alltag werden sie zunehmend mit kulturell heterogenen Gruppenkonstellationen konfrontiert, weshalb von ihnen gefordert wird, auf unterschiedlichen Ebenen mit einer Vielfalt im Kontakt mit Familien aber auch mit Kolleginnen und Kollegen umzugehen.
Doch kann sich die alltägliche Begegnung mit kulturell fremden Lebensbedingungen in Mehrheitsgesellschaften für viele als problematisch darstellen. Was ich in dieser Arbeit mit hervorheben möchte, ist, dass diese fremd erscheinenden Bedingungen überschattet werden von Diskriminierungen und anderen schwer wahrnehmbaren Formen von passiver Gewalt, die sich sowohl hinter Dominanz- und Machtstrukturen als auch hinter Normativitätsvorstellungen einer dominierenden Gesellschaftsstruktur verbergen. Schnell werden dadurch Vorurteile gebildet, die im schlimmsten Fall zu einer rassistisch motivierten Abgrenzung und Stereotypisierung führen können, Peter Nick spricht hierbei von einer konstruierten „strukturellen Fremdheit“.
Institutionen und Strukturen des elementaren Bereiches spiegeln die Realität der Gesellschaft wider, weshalb immer mehr interkulturelle Handlungskompetenzen gefragt sind. Da Kinder in besonderer Weise von Ausgrenzung und Marginalisierung bedroht sind, gewinnen diese Kompetenzen für die Arbeit mit interkulturellen Konzeptionen immer mehr an Bedeutung und sind mittlerweile sehr oft sogar Voraussetzung.
Ob und inwieweit diese Ansichten für ein interkulturelles Lernen in den heutigen Konzepten und Ansätzen berücksichtigt werden und welche Rollen die Pädagogen und Pädagoginnen dabei einnehmen, ein interkulturelles Bewusstsein bei Kindern auszubilden, sind zentrale Fragen, mit denen ich mich in dieser Abschlussarbeit im Detail beschäftigen möchte.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Migration und kulturelle Vielfalt
- Ursachen bzw. Formen von Migration
- Bewusstsein für eine kulturelle Vielfalt in einer Gesellschaft
- Was ist Kultur? Definitionen und Modelle zum Kulturbegriff
- Gefahr einer gesellschaftlichen und politischen Ausgrenzung durch prekäre Fremdbilder
- Idee der Transkulturalität nach Wolfgang Welsch
- Interkulturelle Pädagogik
- Zur Entstehung einer interkulturellen Pädagogik
- Pädagogische Arbeit als Wegbereiter zum interkulturellen Bewusstsein?
- Bedeutung von Modellen und Ansätzen für ein interkulturelles Lernen
- Interkulturelle Modelle und Ansätze
- Bildungs- und Orientierungsprogramme
- Staatliche Europa-Schule Berlin
- Anti-Bias-Approach
- Zusammenfassung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie die Interkulturelle Pädagogik auf die wachsende kulturelle Vielfalt in modernen Gesellschaften reagieren kann. Sie untersucht die dynamischen Prozesse der Migration und die Bedeutung einer interkulturellen Konzeptionsentwicklung in pädagogischen Einrichtungen.
- Die Bedeutung von Migration und kultureller Vielfalt in modernen Gesellschaften
- Die Herausforderungen und Chancen der Interkulturellen Pädagogik
- Die Entwicklung eines Bewusstseins für kulturelle Vielfalt und interkulturelle Kompetenz in pädagogischen Einrichtungen
- Die Rolle von Modellen und Ansätzen für ein interkulturelles Lernen
- Die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Diskriminierung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Interkulturellen Pädagogik ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext der zunehmenden kulturellen Vielfalt in Deutschland. Kapitel 3 analysiert Migrationsprozesse und die Bedeutung von kultureller Vielfalt in der Gesellschaft. Hierbei werden verschiedene Formen von Migration, die Entstehung von Fremdbildern und die Idee der Transkulturalität nach Wolfgang Welsch betrachtet. Kapitel 4 befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Interkulturellen Pädagogik. Es werden wichtige Elemente interkultureller Bildungsarbeit und die Bedeutung von Modellen und Ansätzen für ein interkulturelles Lernen beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Interkulturelle Pädagogik, Migration, kulturelle Vielfalt, interkulturelle Kompetenz, Bildung, Pädagogik, Anti-Bias-Approach, Transkulturalität, Fremdbilder, Diskriminierung, Inklusion, Gesellschaft, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernanliegen der Interkulturellen Pädagogik?
Sie reagiert auf die wachsende kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft und zielt darauf ab, interkulturelle Handlungskompetenzen in pädagogischen Einrichtungen zu fördern.
Was bedeutet der "Anti-Bias-Approach"?
Dies ist ein pädagogischer Ansatz zur Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung, der Diskriminierung und Machtstrukturen kritisch hinterfragt.
Welche Rolle spielt Migration für die Pädagogik?
Durch dynamische Migrationsprozesse entstehen kulturell heterogene Gruppen, die von pädagogischem Fachpersonal neue Kompetenzen im Umgang mit Vielfalt erfordern.
Was versteht Wolfgang Welsch unter Transkulturalität?
Transkulturalität beschreibt die Durchmischung von Kulturen, die nicht mehr als isolierte Inseln, sondern als miteinander verflochtene Lebensformen existieren.
Warum sind interkulturelle Konzeptionen in Kitas wichtig?
Da Kinder besonders von Ausgrenzung bedroht sind, helfen solche Konzepte dabei, Vorurteile abzubauen und ein inklusives Umfeld zu schaffen.
- Quote paper
- Fariss Edan (Author), 2015, Interkulturelle Pädagogik als Resultat dynamischer Migrationsprozesse? Interkulturelle Konzeptionsentwicklung für pädagogische Einrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307976