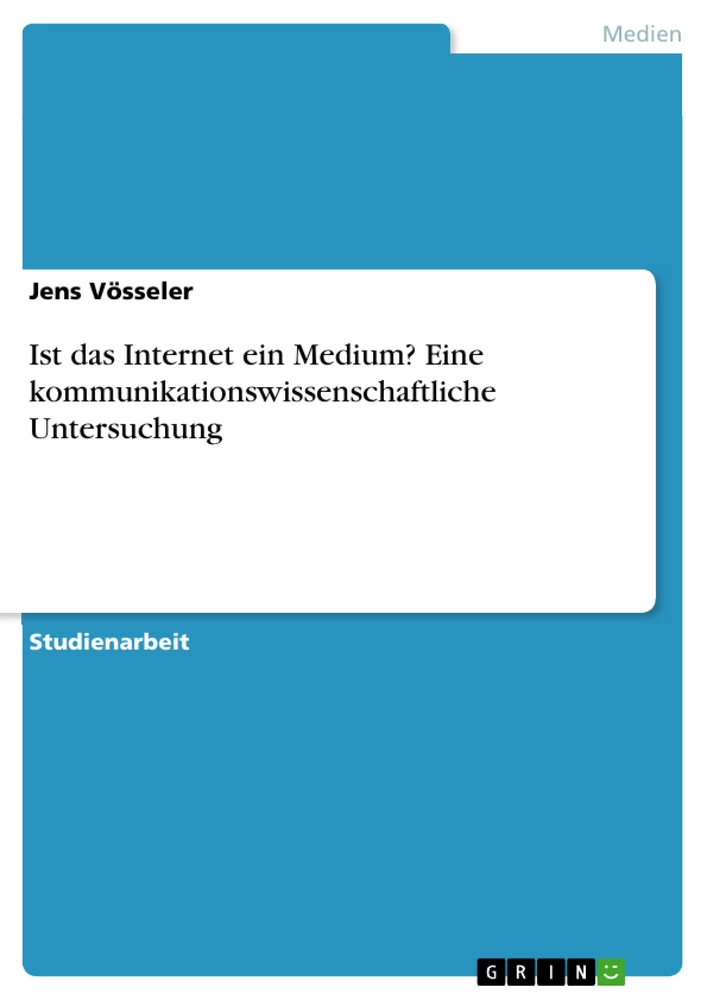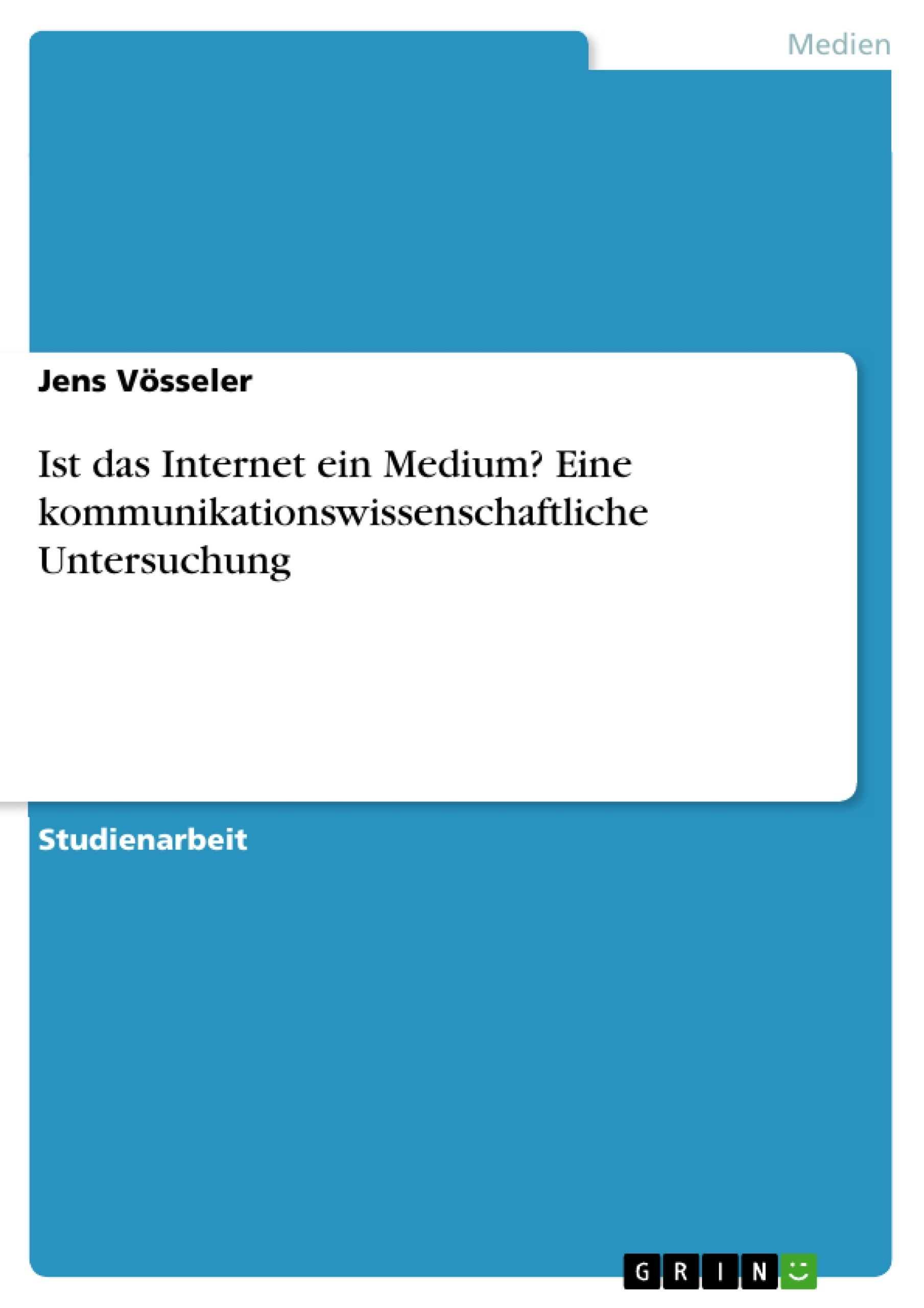„Der Mensch hat sich einen neuen Lebensraum erobert: die digitale Welt.“ (Evsan 2009). Mit dem Internet hielt in den letzten zwei Jahrzehnten eine große Innovation im digitalen Bereich auf der gesamten Welt Einzug. Wir leben in einem Zeitalter, das maßgeblich durch Medien geprägt ist und in dem durch die Erfindung des Internets die Kommunikation revolutioniert wurde. Manche meinen sogar, dass mit dem Internet eine ganz neue Welt geschaffen wurde, die sich uns durch das World Wide Web eröffnet und aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Internetnutzer sprechen enthusiastisch über die neuen Möglichkeiten, die das eigene Leben in vielen Punkten verändern. Die Kritiker hingegen heben den Werteverfall hervor, der sich ihrer Meinung nach im Zuge der Digitalisierung durch das Internet einstellte. Über den neuen Lebensraum, wie Evsan ihn beschreibt, kann nur eine Sache sicher gesagt werden: „Das einzige, was wir über die Zukunft des Internets wissen, ist, dass wir gar nichts über sie wissen.“ (Carey 1998)
Die Wissenschaft bietet viele Ansätze zur Analyse der Medien; und auch zum Internet existieren viele Analyseansätze. Dass es bei einer Frage zur Bezeichnung sowohl von Medien als auch dem Internet verschiedene Positionen gibt, ist also sicher. Wie das Internet nach bisherigem Forschungsstand zu kategorisieren ist, soll mit der Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, näher betrachtet werden: Kann das Internet als Medium bezeichnet werden?
Um sich der Beantwortung dieser Frage anzunähern, wird im ersten Teil der Arbeit der Begriff des Mediums näher untersucht. Hier wird speziell auf den Medienkompaktbegriff nach Siegfried J. Schmidt Bezug genommen, der viele Mediendefinitionen zusammenführt und somit eine fundierte Anwendungsbasis bereitstellt. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den Merkmalen des Internets. Nach einer Erklärung, was die Multimedialität und Interaktivität des Internets ausmacht, folgt eine Beschreibung seiner Struktur. Schließlich soll mit dem letzten Punkt, der Erläuterung des Internets als ein Hybridmedium, zum Fazit übergeleitet werden, in dem am Ende der Arbeit die eingangs formulierte Forschungsfrage beantwortet wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Medienkompaktbegriff
- 2.1. Kommunikationsmittel
- 2.2. Medientechnologien
- 2.3. Institutionalisierung
- 2.4. Medienangebote
- 3. Internet
- 3.1. Interaktivität
- 3.2. Multimedialität
- 3.3. Netzstruktur
- 3.4. Hybridmedium
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob das Internet als Medium bezeichnet werden kann. Sie nähert sich dieser Frage durch eine Analyse des Medienbegriffs und der spezifischen Merkmale des Internets. Dabei wird der Medienkompaktbegriff nach Siegfried J. Schmidt als analytisches Framework verwendet.
- Analyse des Medienbegriffs anhand des Medienkompaktbegriffs
- Untersuchung der Interaktivität, Multimedialität und Netzstruktur des Internets
- Erläuterung des Internets als Hybridmedium
- Bewertung des Internets im Kontext der Medienentwicklung
- Diskussion der Bedeutung des Internets für die Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Einordnung des Internets als Medium. Kapitel 2 erläutert den Medienkompaktbegriff nach Siegfried J. Schmidt, der die vier Komponenten Kommunikationsmittel, Medientechnologien, Institutionalisierung und Medienangebote umfasst. Kapitel 3 widmet sich den spezifischen Merkmalen des Internets, wie Interaktivität, Multimedialität und Netzstruktur. Es wird zudem die Hybridität des Internets als Verbindung verschiedener Medienformen beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen und Konzepten der Kommunikationswissenschaft, wie Medien, Medienkompaktbegriff, Internet, Interaktivität, Multimedialität, Netzstruktur, Hybridmedium, Kommunikation und Digitalisierung.
- Quote paper
- Jens Vösseler (Author), 2014, Ist das Internet ein Medium? Eine kommunikationswissenschaftliche Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308070