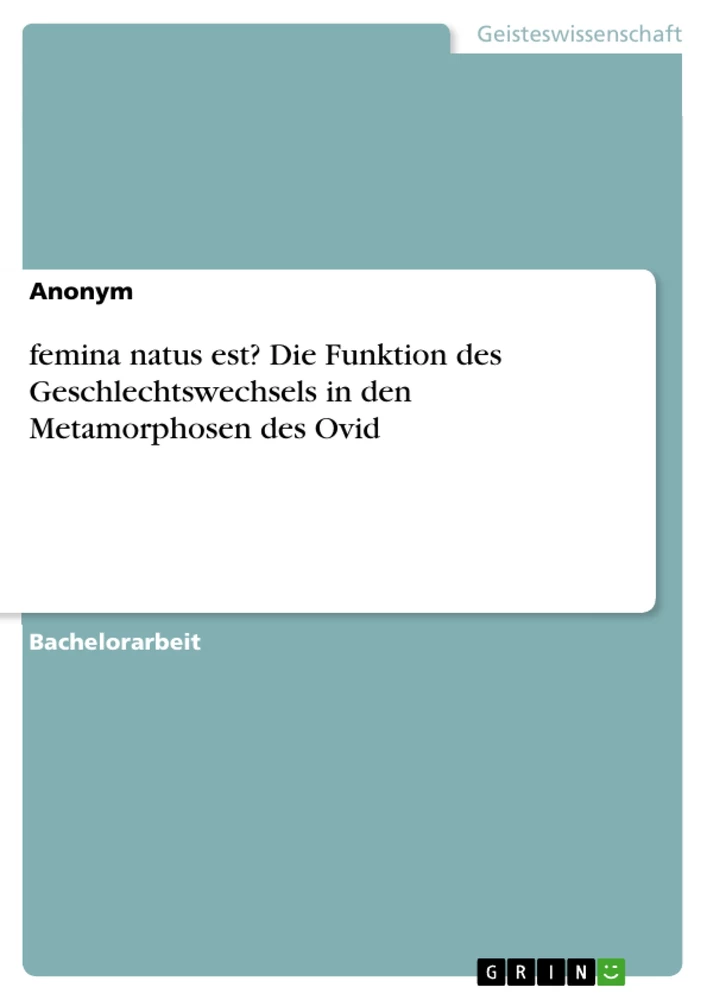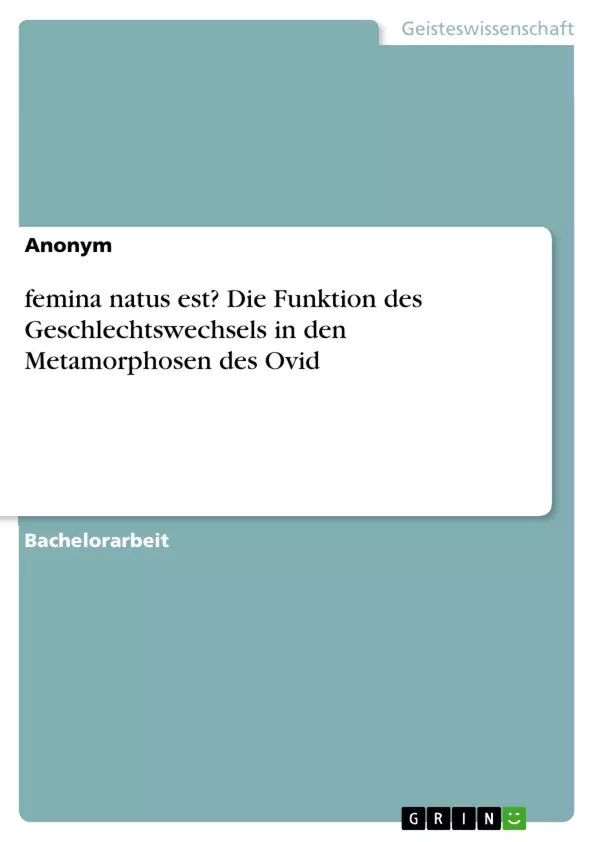Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich anhand von Ovids "Metamorphosen" mit dem gesellschaftlichen Verständnis, welche Funktionen, Charakteristika und Tätigkeiten Mann und Frau üblicherweise zukommen. Im Rahmen wiederholter Grenzüberschreitungen innerhalb von Ovids Werk greift er auch den Wechsel von (biologischen) Geschlechtern auf; dabei scheinen gesellschaftliche Normen gezielt aufgehoben zu werden.
Bedeutet dies, dass Ovid ein Vorreiter der gender-Forschung war, der seine Zeitgenossen womöglich zum Überdenken sozialer Rollen bewegen konnte? Oder waren Geschlechtsidentitäten gar nicht derart klar definiert, sodass ein Ausbrechen ohne Weiteres möglich war und kein tatsächlicher Tabubruch vorliegt? Wie können derartige Überschreitungen vor einem antiken Leser gerechtfertigt werden?
Nachfolgend sollen diese Fragen anhand der Mythen um Tiresias, Iphis sowie Caeneus diskutiert werden; diese werden zunächst unabhängig voneinander inhaltlich und auch sprachlich analysiert. Da dabei ein historischer Kontext nicht ausgespart werden kann, wird anschließend eine kurze Zusammenfassung gesellschaftlich spezifischer Geschlechterrollen zu Zeiten Ovids vorgenommen und im abschließenden Fazit mit den genannten Mythen in Verbindung gebracht; dabei soll auch der Frage nach weiteren motivischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen diesen nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Überblick und Auswahl
- 3 Iphis (9.666-797)
- 3.1 Einbettung im Werk
- 3.2 Gliederung des Mythos
- 3.3 Iphis' Name
- 3.4 Proömium und Verortung
- 3.5 Erscheinen der Isis und Zuspitzung durch Verlobung
- 3.6 Monolog
- 3.7 Zuspitzung der Verlobung, Anrufen der Isis und Erlösung
- 3.8 Epilog
- 4 Caeneus (12.171-209; 459-531)
- 4.1 Gliederung des Mythos
- 4.1.1 Einbettung im Werk
- 4.1.2 Der Mythos als Funktion
- 4.2 Caenis - Einführung, Vergewaltigung und Verwandlung
- 4.3 Caeneus - Verunglimpfung und Kampf gegen exzessive Männlichkeit
- 4.4 Epilog
- 5 Tiresias (3.316-338)
- 5.1 Einbettung im Werk
- 5.2 Vollständige Übersetzung
- 5.3 Tiresias Geschichte
- 5.4 Tiresias Ansicht
- 5.5 Epilog
- 6 Synopsis: Historischer Hintergrund und Ovids Verarbeitung
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Funktion des Geschlechtswechsels in Ovids Metamorphosen. Sie analysiert verschiedene Mythen, insbesondere die von Iphis, Caeneus und Tiresias, um zu verstehen, wie Ovid den Geschlechtswechsel in seinen Erzählungen verwendet und welche Bedeutung er ihm zuschreibt. Die Arbeit befasst sich mit den historischen und sozialen Kontexten der antiken Geschlechterrollen und beleuchtet, wie Ovid diese in seinen Mythen verarbeitet.
- Die Rolle des Geschlechtswechsels in Ovids Metamorphosen
- Die gesellschaftlichen und kulturellen Normen des Geschlechts in der römischen Antike
- Die Funktion von Mythen und Erzählungen in Ovids Werk
- Die literarische Analyse der Mythen um Iphis, Caeneus und Tiresias
- Die Bedeutung von Sprache und Rhetorik in Ovids Darstellung des Geschlechtswechsels
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas im Kontext moderner Debatten über Geschlechtsidentität und -rollen beleuchtet. Anschließend stellt das zweite Kapitel die ausgewählten Mythen sowie den methodischen Ansatz der Arbeit vor.
Das dritte Kapitel analysiert den Mythos um Iphis, wobei die Einbettung des Mythos im Werk, seine Gliederung, die Bedeutung des Namens Iphis, das Proömium und die Rolle der Isis sowie die Zuspitzung durch die Verlobung beleuchtet werden. Der Monolog von Iphis wird im Detail analysiert. Schließlich werden die Zuspitzung der Verlobung, das Anrufen der Isis und die Erlösung sowie der Epilog des Mythos untersucht.
Kapitel vier widmet sich dem Mythos um Caeneus. Die Arbeit untersucht die Gliederung des Mythos, die Einbettung im Werk, die Funktion des Mythos, die Einführung der Figur Caenis, die Vergewaltigung und die Verwandlung sowie die Verunglimpfung und den Kampf gegen exzessive Männlichkeit. Der Epilog des Mythos wird ebenfalls behandelt.
Kapitel fünf befasst sich mit dem Mythos um Tiresias. Die Arbeit analysiert die Einbettung des Mythos im Werk, bietet eine vollständige Übersetzung des relevanten Textes, beleuchtet Tiresias Geschichte und seine Ansicht sowie den Epilog des Mythos.
Das sechste Kapitel bietet eine Synopsis des historischen Hintergrundes und Ovids Verarbeitung des Geschlechtswechsels in seinen Metamorphosen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Geschlechtswechsel, Metamorphosen, Ovid, Geschlechterrollen, antike Gesellschaft, Mythen, literarische Analyse, Sprache, Rhetorik, Iphis, Caeneus, Tiresias.
Häufig gestellte Fragen
Welche Figuren mit Geschlechtswechsel werden in Ovids Metamorphosen untersucht?
Die Arbeit analysiert die Mythen um Tiresias, Iphis und Caeneus.
Warum verwandelt sich Iphis in einen Mann?
Iphis wurde als Mädchen geboren, aber als Junge erzogen, um den Zorn des Vaters zu vermeiden. Die Göttin Isis verwandelt sie vor der Hochzeit in einen Mann, um die Verbindung mit ihrer Geliebten Ianthe zu ermöglichen.
Was ist die Geschichte von Caeneus?
Caeneus war ursprünglich die Frau Caenis, die nach einer Vergewaltigung durch Neptun den Wunsch äußerte, ein Mann zu werden, um nie wieder ein solches Unrecht zu erleiden.
Wie kam Tiresias zu seinem doppelten Geschlechtswechsel?
Tiresias schlug zwei sich paarende Schlangen und wurde zur Frau; sieben Jahre später schlug er sie erneut und wurde wieder zum Mann.
Welche gesellschaftliche Funktion hat der Geschlechtswechsel bei Ovid?
Ovid nutzt diese Motive, um traditionelle Geschlechterrollen zu hinterfragen und die Grenzen zwischen männlichen und weiblichen Charakteristika auszuloten.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, femina natus est? Die Funktion des Geschlechtswechsels in den Metamorphosen des Ovid, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308076