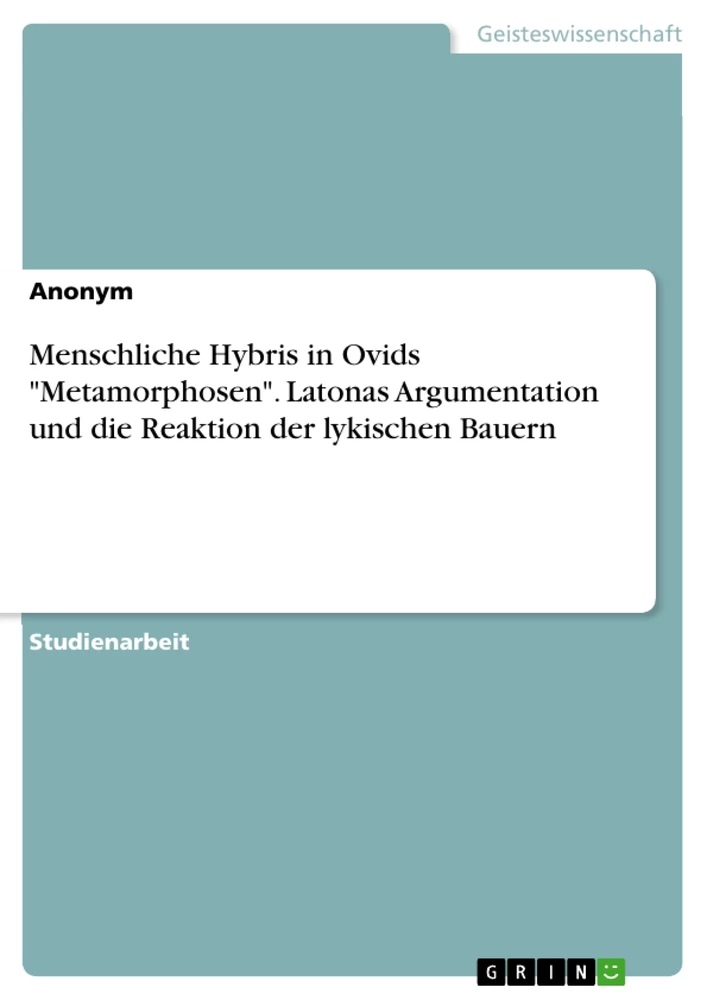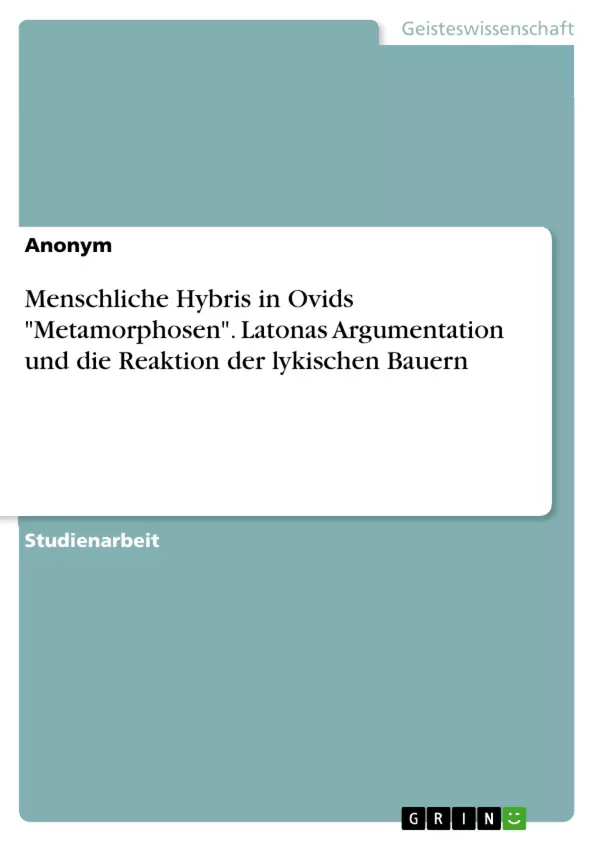Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der menschlichen Hybris in Ovids „Metamorphosen“. Dazu untersucht sie die Rede Latonas auf ihre Form und Struktur hin. Dabei werden zuerst die metrische Analyse und eine kommentierte Übersetzung der betreffenden Verse vorgenommen. Im Anschluss daran wird auf den Aufbau sowie die Argumente Latonas und die intendierte Wirkung des Gesagten eingegangen; anschließend soll ein Bezug zwischen Stil und Inhalt hergestellt werden.
Weiterhin wird der anschließende Effekt der Rede auf die Bauern beleuchtet. Im Vordergrund der Diskussion soll die Frage nach der Funktion der Rede sowohl innerhalb als auch außerhalb des Textes stehen. Deshalb erfolgt im Anschluss an die textliche Analyse eine Auseinandersetzung, die der Fragestellung nachgeht, wofür der Mythos außerhalb des Werkes stehen könnte.
Dabei wird eine nähere Reflektion der endgültigen Verwandlung ausgespart und lediglich auf das Handeln der Bauern in noch menschlicher Gestalt eingegangen, da dies einerseits unerheblich für die Fragestellung erscheint, andererseits dem vorgegeben Umfang der Arbeit nicht gerecht werden kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Skandierung und Übersetzung
- Metrische Analyse
- Kommentierte Übersetzung
- Interpretation
- Einordnung und Vorgeschichte
- Latonas Appell an die Bauern
- Die Reaktion der Bauern
- Die Lykischen Bauern als Metapher
- Die Metapher auf die Dichtkunst
- Die Metapher politischer Präferenzen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht Latonas Rede an die Lykischen Bauern im sechsten Buch der Metamorphosen und beleuchtet dabei ihre formale Struktur und argumentative Gestaltung. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Funktion der Rede im Text und außerhalb des Werkes.
- Metrische Analyse und Übersetzung von Latonas Rede
- Analyse der Argumentation Latonas und deren rhetorische Strategien
- Die Reaktion der Bauern und die Bedeutung ihrer Hybris
- Die Lykischen Bauern als Metapher für die Dichtkunst und politische Präferenzen
- Die Bedeutung des Mythos von Latona und den Bauern für die Interpretation des Gesamtwerkes
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt den Kontext des Mythos von Latona und den Bauern im sechsten Buch der Metamorphosen vor. Außerdem wird die Vorgehensweise der Analyse erläutert.
- Das Kapitel "Skandierung und Übersetzung" bietet eine metrische Analyse der relevanten Verse sowie eine kommentierte Übersetzung von Latonas Rede.
- Im Kapitel "Interpretation" wird Latonas Appell an die Bauern im Detail analysiert, wobei auf die Argumentationsstruktur, die rhetorischen Mittel und die intendierte Wirkung der Rede eingegangen wird. Ebenfalls wird die Reaktion der Bauern beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Ovid, Metamorphosen, Latona, Lykische Bauern, Hybris, Dichtkunst, politische Präferenzen, Rhetorik, Mythos, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Mythos von Latona und den lykischen Bauern?
Die Göttin Latona bittet erschöpft um Wasser an einem Teich, wird aber von Bauern böswillig daran gehindert. Zur Strafe verwandelt sie die Bauern in Frösche.
Was bedeutet „Hybris“ in diesem Kontext?
Hybris bezeichnet die menschliche Selbstüberhebung gegenüber den Göttern. Die Bauern missachten Latonas göttlichen Status und ihre grundlegende menschliche Not.
Wie argumentiert Latona in Ovids „Metamorphosen“?
Latona nutzt rhetorisch geschickte Appelle, indem sie auf das gemeinsame Naturrecht (Wasser für alle) und ihre mitleiderregende Situation als Mutter hinweist.
Wofür können die lykischen Bauern als Metapher stehen?
Sie können als Metapher für schlechte Dichtkunst (das „Quaken“) oder für bestimmte politische Präferenzen und sozialen Neid innerhalb der damaligen Gesellschaft gedeutet werden.
Was ist das Ziel der metrischen Analyse in dieser Arbeit?
Die Analyse untersucht den Hexameter Ovids, um zu zeigen, wie Stil und Rhythmus die Dramatik der Rede und die Charakterisierung der Figuren unterstützen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Menschliche Hybris in Ovids "Metamorphosen". Latonas Argumentation und die Reaktion der lykischen Bauern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308078