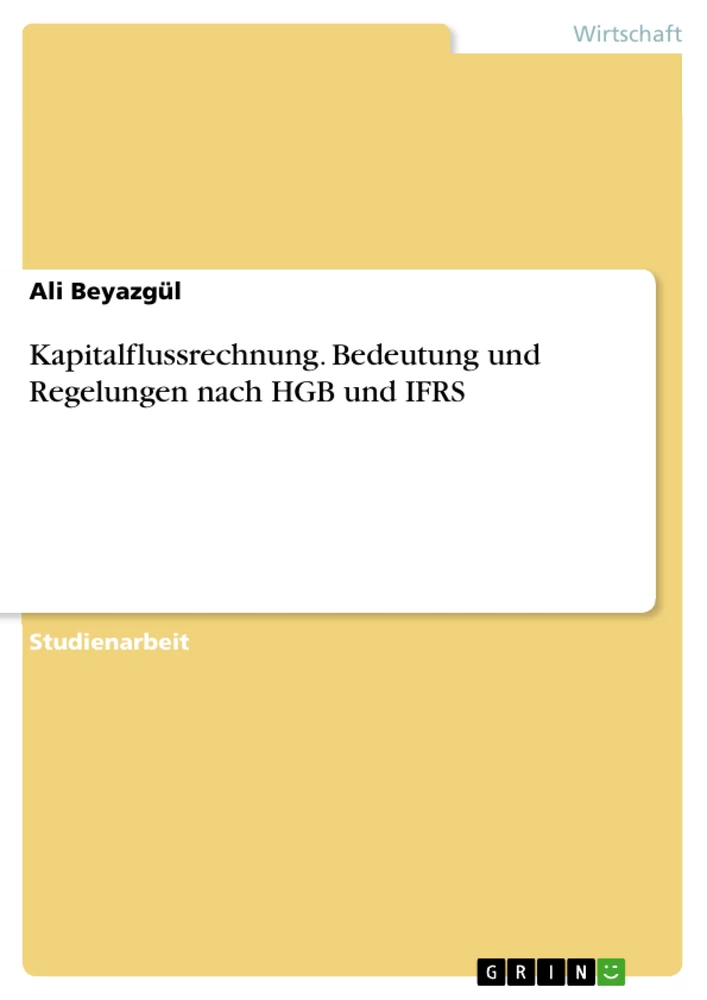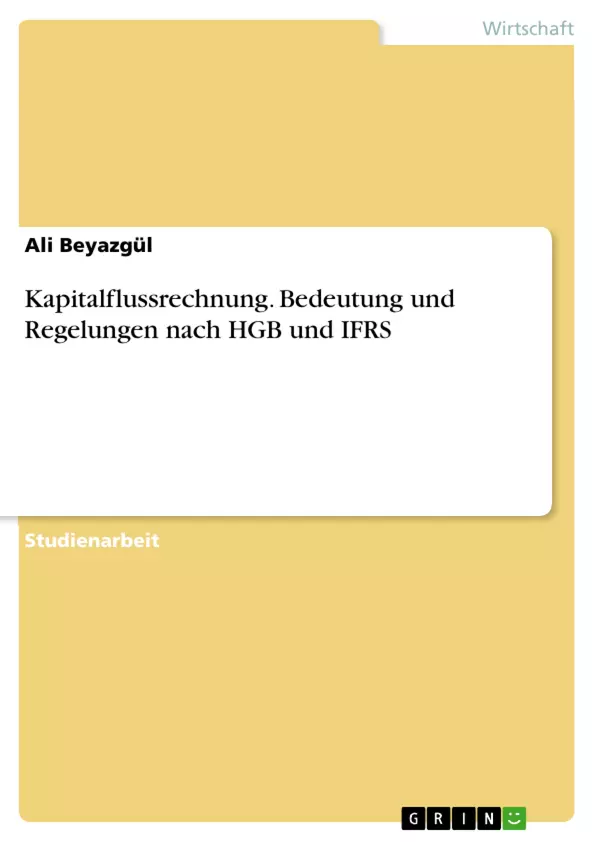Die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens wird durch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt. Die Bilanz gibt das Vermögen eines Unternehmens wieder und die Gewinn- und Verlustrechnung hat die Aufgabe, über die Ertragslage innerhalb eines bestimmten Zeitraumes Auskunft zu geben. Die Gewinn- und Verlustrechnung beispielsweise besteht aus vielen Faktoren wie z.B. aus Abschreibungen, die nicht den tatsächlichen Zahlungsfluss beeinflussen. Beide Instrumente geben nur begrenzt Auskunft über die Finanzlage des Unternehmens. Aus diesem Grund versucht man mit der Aufstellung einer Kapitalflussrechnung eine übersichtliche Beurteilung der Finanzlage zu ermöglichen.
Die Kapitalflussrechnung ist nach IFRS Pflichtbestandteil eines Jahresabschlusses. Im Bereich der nationalen Bilanzierung hingegen ist die Erstellung einer Kapitalflussrechnung nach Handelsgesetzbuch (HGB) lediglich für den Konzernabschluss und den Einzelabschluss von kapitalmarktorientierten Unternehmen, die keinen Konzernabschluss erstellen müssen, als verbindlicher Bestandteil des Jahresabschlusses vorgesehen. Da im HGB eine Konkretisierung zu ihren Aufgaben, Inhalt und Auf-bau fehlt, ist die Anwendung der vom Deutschen Rechnungslegungsrat (DRSC) erarbeitete „Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr.21“ (DRS 21) einschlägig.
Obwohl sich DRS 21 an die IFRS stützt, soll diese Arbeit den Leser neben den Ähnlichkeiten auch über die Unterschiede zwischen den nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards informieren. Eine kurze Einführung in das Thema soll durch die Definition der Kapitalflussrechnung und durch eine kurze Erklärung der Aufgaben erleichtert werden. Nach der Bereitstellung der Informationen über die allgemeinen Grundlagen der Kapitalflussrechnung, wird in Kapitel 3 der Aufbau und die Darstellung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und IAS 7 erklärt. Des Weiteren wird in Kapitel 4 die wesentlichen Unterschiede in der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und IAS 7 genannt. Abschließend wird anhand von Vor- und Nachteilen der Kapitalflussrechnung und einer kurzen Zusammenfassung des Themas die Arbeit abgerundet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeine Grundlagen der Kapitalflussrechnung
- 2.1 Definition
- 2.2 Zweck und Aufgabe
- 3 Aufbau und Struktur
- 3.1 Einführung
- 3.2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
- 3.3 Cashflow aus Investitionstätigkeit
- 3.4 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
- 3.5 Fondsänderungsnachweis
- 4 Unterschiede in der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und IAS 7
- 5 Kritische Würdigung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Kapitalflussrechnung, einem wichtigen Instrument der Finanzanalyse, das Aufschluss über die Finanzlage eines Unternehmens gibt. Sie stellt die Definition, den Zweck und die Aufgabe der Kapitalflussrechnung dar, erläutert den Aufbau und die Struktur der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und IAS 7, und beleuchtet die wesentlichen Unterschiede in der Anwendung dieser beiden Standards.
- Definition und Bedeutung der Kapitalflussrechnung
- Zweck und Aufgabe der Kapitalflussrechnung
- Aufbau und Struktur der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und IAS 7
- Unterschiede in der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und IAS 7
- Kritische Würdigung und Fazit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Kapitalflussrechnung ein und erklärt ihre Relevanz im Kontext der Finanzanalyse. Sie beleuchtet die Bedeutung der Kapitalflussrechnung als Ergänzung zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, um ein umfassendes Bild der Finanzlage eines Unternehmens zu erhalten.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit den allgemeinen Grundlagen der Kapitalflussrechnung. Es definiert die Kapitalflussrechnung und erläutert ihre wesentlichen Aufgaben. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen der Kapitalflussrechnung und anderen Finanzkennzahlen, sowie auf der Rolle der Kapitalflussrechnung bei der Bewertung des finanziellen Erfolgs und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Aufbau und der Struktur der Kapitalflussrechnung. Es beschreibt die verschiedenen Arten von Cashflows, die in der Kapitalflussrechnung dargestellt werden, und erklärt die Methoden zur Ermittlung der Cashflows. Dieses Kapitel behandelt insbesondere die drei Hauptbereiche der Kapitalflussrechnung: Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Cashflow aus Investitionstätigkeit und Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Kapitel 4 beleuchtet die Unterschiede in der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und IAS 7. Es vergleicht die beiden Standards hinsichtlich ihrer Anforderungen an die Darstellung und Gliederung der Kapitalflussrechnung, und zeigt die wichtigsten Abweichungen auf.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kapitalflussrechnung, DRS 21, IAS 7, Finanzanalyse, Cashflow, Finanzlage, Jahresabschluss, Unternehmen, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC), International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS).
Häufig gestellte Fragen zur Kapitalflussrechnung
Was ist eine Kapitalflussrechnung?
Die Kapitalflussrechnung ist ein Instrument der Finanzanalyse, das die Veränderung der liquiden Mittel eines Unternehmens innerhalb eines Zeitraums darstellt. Sie ergänzt Bilanz und GuV, um ein genaueres Bild der Finanzlage zu vermitteln.
Ist die Erstellung einer Kapitalflussrechnung nach HGB verpflichtend?
Nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) ist sie lediglich für den Konzernabschluss sowie für den Einzelabschluss kapitalmarktorientierter Unternehmen, die keinen Konzernabschluss erstellen, verbindlich vorgeschrieben.
Was regelt der Standard DRS 21?
Der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) konkretisiert die Anforderungen an den Inhalt und den Aufbau der Kapitalflussrechnung im deutschen Recht, da das HGB hierzu wenig Details enthält.
In welche Bereiche wird der Cashflow unterteilt?
Die Kapitalflussrechnung gliedert sich in drei Hauptbereiche: den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Welche Bedeutung hat die Kapitalflussrechnung für Investoren?
Sie ermöglicht eine Beurteilung der Fähigkeit eines Unternehmens, künftige Zahlungsüberschüsse zu generieren und Verpflichtungen nachzukommen, was durch Abschreibungen in der GuV oft verzerrt wird.
Gibt es Unterschiede zwischen DRS 21 und IAS 7?
Ja, obwohl sich DRS 21 stark an den internationalen Standard IAS 7 anlehnt, bestehen Unterschiede in Detailfragen der Gliederung und Darstellung der Zahlungsströme.
- Arbeit zitieren
- Ali Beyazgül (Autor:in), 2014, Kapitalflussrechnung. Bedeutung und Regelungen nach HGB und IFRS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308088