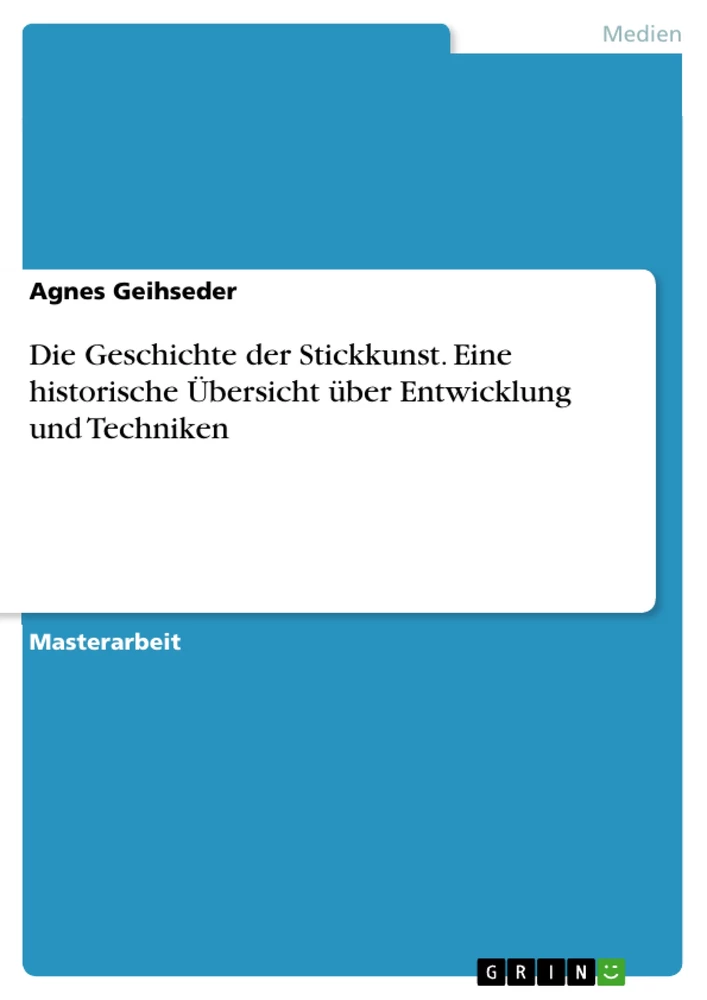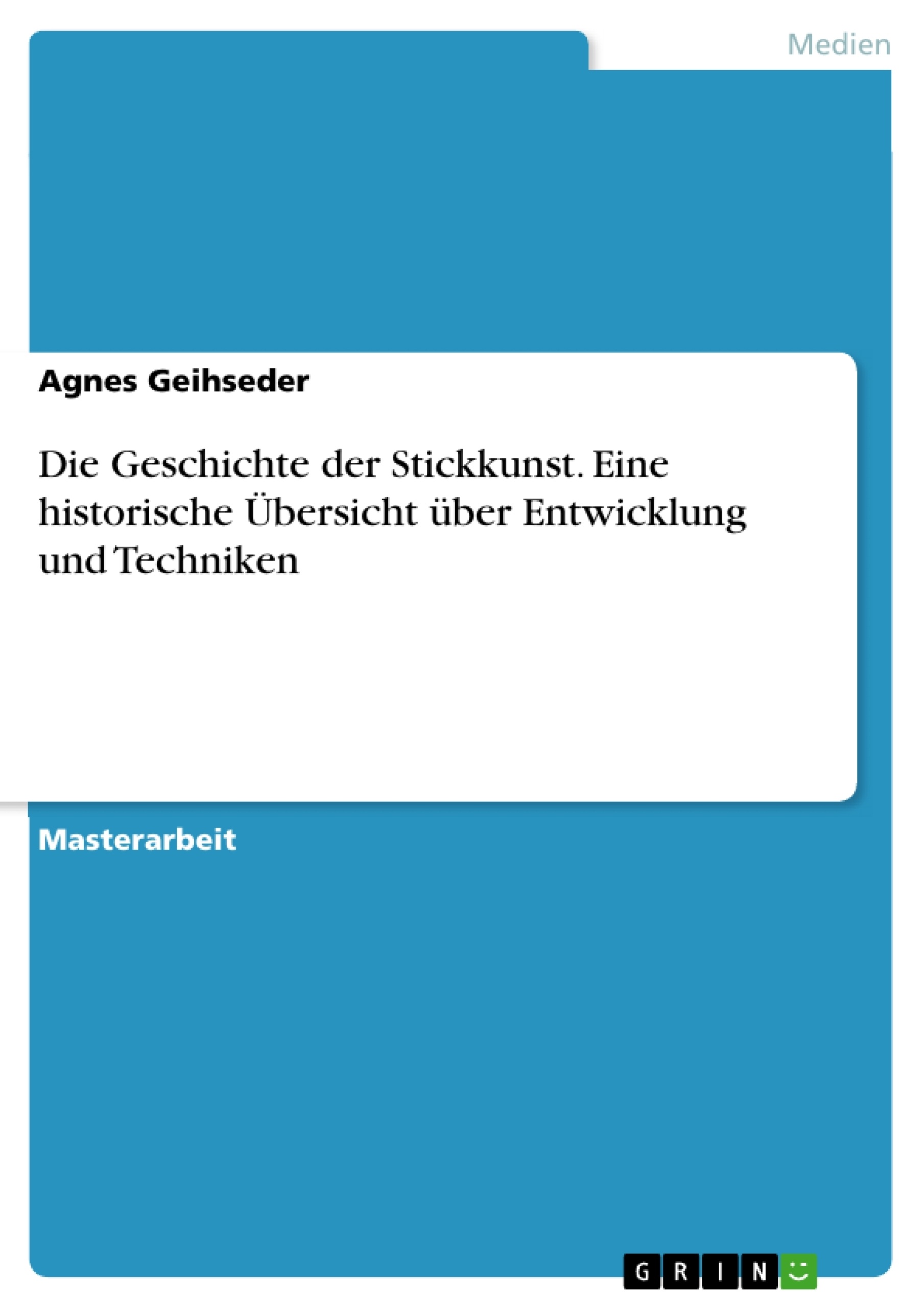„Handarbeitstechniken können nicht veralten, nur das, was man mit ihnen schafft, kann altmodisch werden.“ Dieser Satz von Jutta Lammèr aus „Das große Ravensburger Lexikon der Handarbeiten“ ist der eigentliche Leitfaden meiner Arbeit.
Mit Nadel und Faden zu arbeiten war schon immer meine liebste Tätigkeit und im Laufe der Zeit habe ich bald gelernt, dass speziell sticken mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung ist.
Nach einer kurzen Übersicht über Handarbeit im Allgemeinen und Sticken speziell auch historisch betrachtet, beschreibe ich meine künstlerisch-praktische Arbeit. Detaillierte Materialangaben sowie die Beschreibung der Arbeitsvorgänge in den verschiedenen Sticktechniken erläutere ich anschließend.
Der Wandbehang soll mit der Vielfalt der Farben und Techniken die Thematik der immerwährenden Aktualität des Stickens belegen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1 ORA ET LABORA
- 1.1 Ursprung
- 1.2 Christentum
- 1.3 Glanz und Gloria
- 1.4. Einfluss
- 1.5 Hohe Kunst
- 1.6 Weißstickerei
- 1.7. Savoir vivre
- 1.8. Rückbesinnung
- 1.9. „ Durch die Blume“
- 1.10. Natur als Maßstab
- 1.11. Neue Zeiten
- 2. Künstlerische Arbeit
- 2.1. Wie es dazu kam…
- 2.2. …und was daraus wurde
- Danksagung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die immerwährende Aktualität des Stickens aufzuzeigen, indem sie die Geschichte und Entwicklung der Stickerei beleuchtet, und die eigene künstlerisch-praktische Arbeit im Detail beschreibt.
- Die historische Entwicklung der Stickerei von ihren Ursprüngen bis in die Moderne
- Der Einfluss verschiedener Kulturen und Epochen auf die Stickkunst
- Die Bedeutung der Stickerei als Ausdrucksform von Kunst und Kultur
- Die Vielfältigkeit der Sticktechniken und Materialien
- Die eigene künstlerische Arbeit und ihre Einbettung in den Kontext der Stickereigeschichte
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Intention, die Aktualität des Stickens aufzuzeigen. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Geschichte der Stickerei, von ihren Ursprüngen in China über das mittelalterliche Europa bis hin zur Moderne. Die verschiedenen Kulturen, die an der Entwicklung der Stickerei beteiligt waren, werden beleuchtet und ihre Beiträge zur Kunstform werden hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel werden die Materialien und Sticktechniken vorgestellt, die in der eigenen künstlerischen Arbeit verwendet wurden. Die Arbeit umfasst einen Wandbehang mit 93 Figurenn, die in verschiedenen Posen und mit unterschiedlichen Kleidungsstücken dargestellt sind. Die Autorin beschreibt detailliert die verwendeten Materialien, die angewandten Sticharten und ihre Wirkung auf das Gesamtbild.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte der Stickerei als Ausdruck von Kunst und Kultur, wobei die Entwicklung der Sticktechniken und Materialien im Fokus stehen. Besonders werden die Bereiche Weißstickerei, Reliefstickerei, die Stickerei im Barock und Rokoko, im Klassizismus und Empire sowie im Jugendstil behandelt. Auch die eigene künstlerische Arbeit mit ihrem Fokus auf die Vielfältigkeit der Sticharten und die Wiedergabe von "Stoffigkeit" wird durch die Arbeit präsentiert.
Häufig gestellte Fragen zur Geschichte der Stickkunst
Wo liegen die Ursprünge der Stickerei?
Die Stickkunst hat ihre Wurzeln weit in der Vergangenheit, unter anderem im alten China, und verbreitete sich über verschiedene Kulturen weltweit.
Was bedeutet "Ora et Labora" im Kontext der Handarbeit?
Dieser Leitspruch ("Bete und Arbeite") verweist auf die Bedeutung der Stickerei in Klöstern, wo prächtige kirchliche Gewänder und Textilien entstanden.
Was ist Weißstickerei?
Die Weißstickerei ist eine Technik, bei der mit weißem Garn auf weißem Grund gearbeitet wird, was oft für Bettwäsche, Tischdecken oder feine Kleidung genutzt wurde.
Welche Rolle spielt die Stickerei im Jugendstil?
Im Jugendstil wurde die Stickerei als hohe Kunstform wiederentdeckt, wobei organische Formen und die Natur als Maßstab dienten.
Ist Sticken heute noch aktuell?
Ja, die Arbeit belegt durch einen modernen Wandbehang mit 93 Figuren, dass die Techniken zeitlos sind und nur die geschaffenen Objekte dem Modewandel unterliegen.
- Quote paper
- Agnes Geihseder (Author), 2012, Die Geschichte der Stickkunst. Eine historische Übersicht über Entwicklung und Techniken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308132