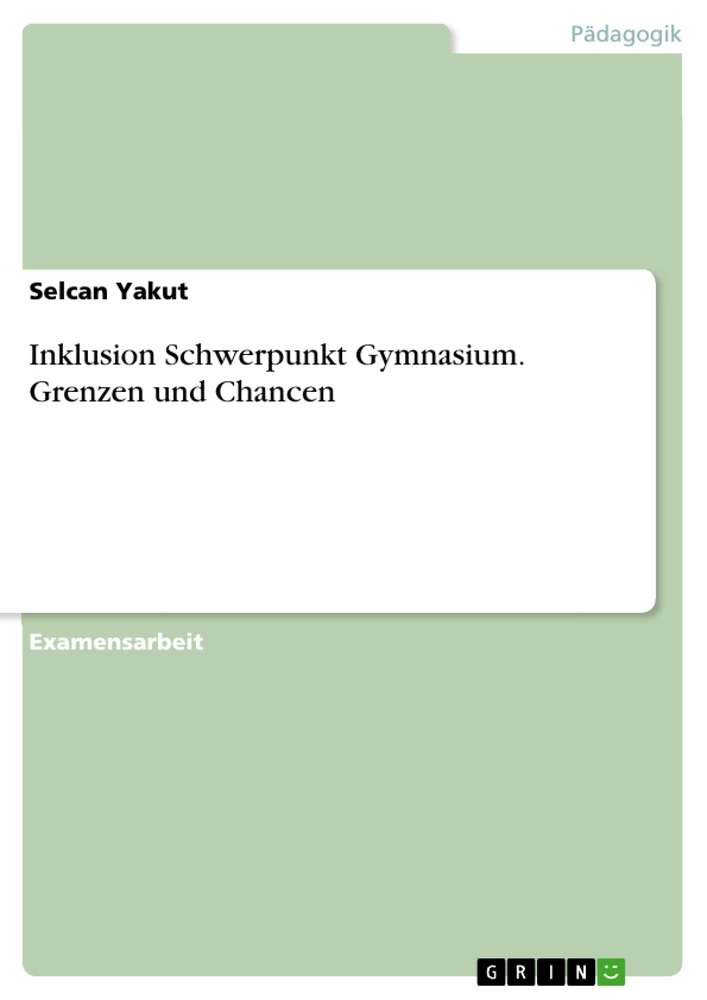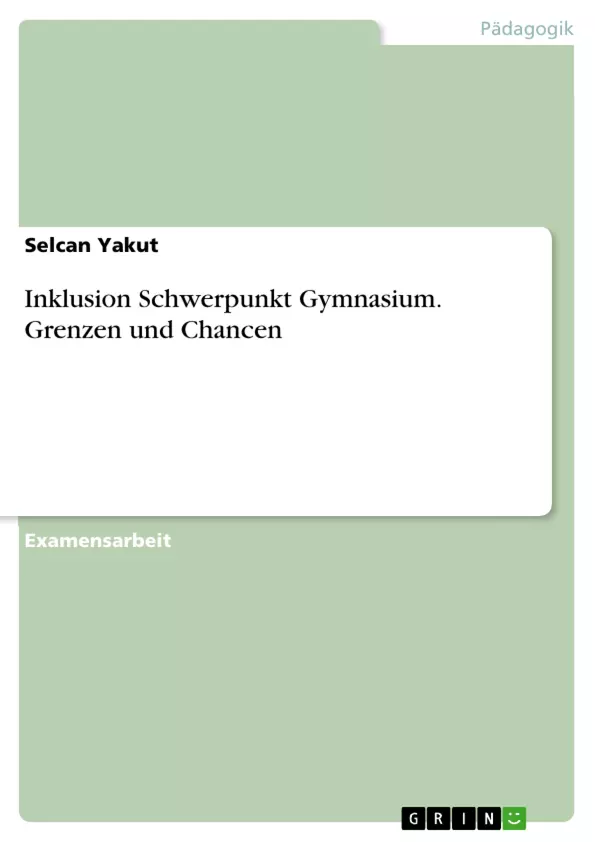Jeder einzelne Mensch auf unserer Erde unterscheidet sich stets vom Rest der Erdbürger. Diese Unterschiede können aus den Bedingungen herrühren in denen der Mensch aufgewachsen ist bzw. in denen er lebt. So haben Menschen unterschiedliche Religionen, Mentalitäten oder auch ökonomisch-soziale Bedingungen. Darüber hinaus können Menschen sich auch nach den Bedingungen ihres Körpers und ihrer intellektuell-kognitiven Begabungen voneinander unterscheiden. Hier wird zumeist von Behinderungen gesprochen, während Definitionen bezüglich unterschiedlich gelagerter Begabungen sinnvoller sind. Gesamtgesellschaftlich betrachtet stellt die Vereinbarkeit dieser Unterschiede von Menschen für eine Gesellschaft eine große Herausforderung dar. Vor diesem Hintergrund spielen in den letzten Jahrzehnten die Begriffe der Integration und Inklusion eine Rolle, da sie Entwürfe und Praxen für ein mögliches gemeinsames Miteinander von heterogenen Gesellschaften darstellen. Der aus dem Lateinischen stammende Begriff der Integration bezeichnet ursprünglich „wiederherstellen“ oder „wieder zu einem Ganzen herstellen“. In den letzten Jahren ist der Begriff der Integration vor allem in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung immer wieder in die Kritik geraten. Um Ungenauigkeiten zu vermeiden, plädieren viele für eine Ablösung des Begriffs der Integration durch den der Inklusion. Dies betrifft dabei nicht nur die wissenschaftliche Diskussion um die Integration von Migranten, sondern ebenfalls die begriffliche Diskussion um die Integration oder Inklusion von Behinderten in das Bildungssystem.
Die Probleme um die Begrifflichkeiten des Themenfeldes Integration, drehen sich um die Frage, wie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer Gesellschaft zu beschreiben ist. Dabei geht es selbstverständlich eben auch um die Frage, welche Konsequenzen sich aus einer Zugehörigkeit oder einer Nicht-Zugehörigkeit ergeben. Auch das Begriffspaar Inklusion und Exklusion dreht sich um diese Fragen. Rudolf Stichweh hat festgehalten, dass sich diese Begriffe innerhalb der Sozialwissenschaften innerhalb weniger Jahre durchgesetzt hätten. Ihren eigentlichen Ursprung hätten sie dabei in der Systemtheorie. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen und Aspekte der Inklusion
- 2.1 Heterogenität
- 2.2 Subjektivität
- 2.3 Individualität
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1 Gesellschaftspolitische Bedeutung der Inklusion
- 3.2 Pädagogische Bedeutung der Inklusion
- 3.3 Juristische Bedeutung der Inklusion
- 4. Inklusion und die Menschenrechtsdebatte
- 5. Bedeutung der Inklusion für die Schule
- 5.1 Auswirkungen auf die Schüler
- 5.2 Auswirkungen auf die Lehrer
- 5.3 Auswirkungen auf die Institution Schule am Beispiel der Schulform des Gymnasiums
- 6. Auswertung und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Inklusion, beleuchtet dessen Bedeutung für die Gesellschaft und insbesondere für das deutsche Bildungssystem. Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Inklusionsgedankens zu vermitteln und dessen Relevanz für die Gestaltung einer gerechten und vielfältigen Gesellschaft zu verdeutlichen.
- Definition und Entwicklung des Begriffs der Inklusion
- Theoretische Grundlagen und gesellschaftliche Relevanz der Inklusion
- Die Rolle der Inklusion im Bildungswesen
- Auswirkungen der Inklusion auf Schüler, Lehrer und die Institution Schule
- Die Bedeutung der Inklusion für das Gymnasium
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Thema Inklusion und skizziert den Hintergrund und die Relevanz des Begriffs in Bezug auf gesellschaftliche Unterschiede. Kapitel 2 befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Inklusion, darunter Heterogenität, Subjektivität und Individualität. Kapitel 3 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Inklusion, wobei die gesellschaftlichen, pädagogischen und juristischen Aspekte im Fokus stehen. Kapitel 4 diskutiert die Verbindung zwischen Inklusion und der Menschenrechtsdebatte. Kapitel 5 untersucht die Bedeutung der Inklusion für die Schule und analysiert die Auswirkungen auf Schüler, Lehrer und die Institution Schule selbst.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen und Konzepten der Inklusion, darunter Heterogenität, Subjektivität, Individualität, gesellschaftliche Teilhabe, Bildungsgerechtigkeit, inklusive Pädagogik, Menschenrechte, Sonderpädagogik, Integration, Förderschulsystem, Gymnasium, Schulsystem und Schulform.
- Quote paper
- Selcan Yakut (Author), 2015, Inklusion Schwerpunkt Gymnasium. Grenzen und Chancen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308180