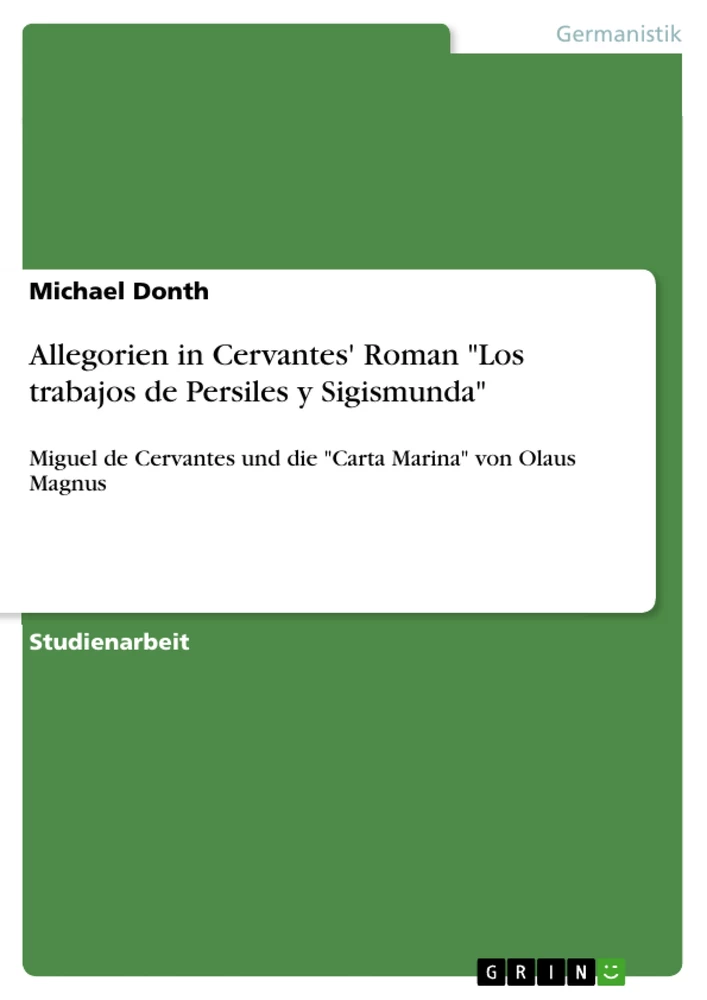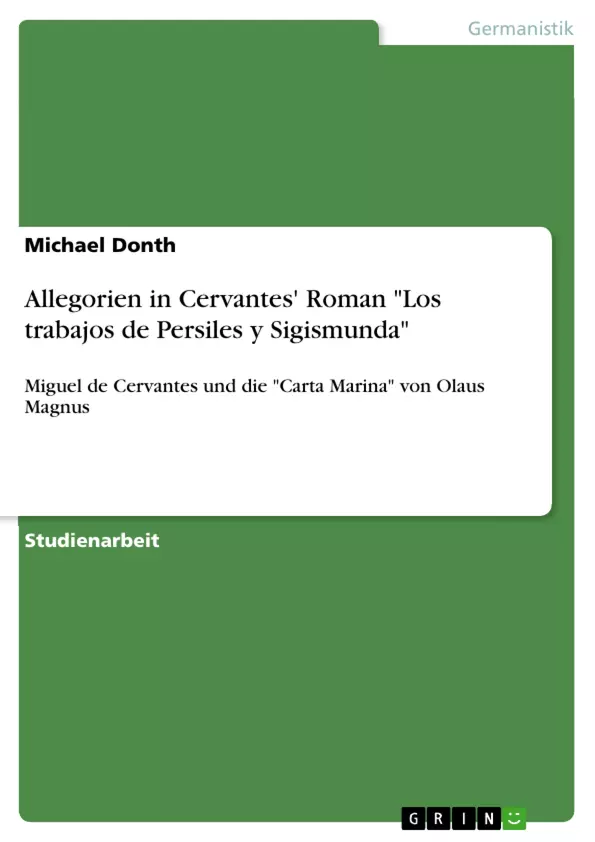Miguel de Cervantes' Roman Los trabajos de Persiles y Sigismunda (zu dt.: Die Mühen und Leiden des Persiles und der Sigismunda) ist voll von wunderbaren Begebenheiten, die auf ihrer literalen Ebene, also in der Art, wie die Geschichten dargestellt werden, seltsam erscheinen. Dem Rezipienten begegnen Inseln aus Edelsteinen, bösartige Meeresungeheuer, Schlittschuh laufende Soldaten im Nordmeer, zugefrorene Schiffe, Hexen, ein liebeskranker Portugiese, die schönsten Frauen der Welt und einiges Andere mehr.
Im Ganzen reisen zwei sich Liebende, Persiles und Sigismunda, nach Rom, um dort heiraten zu können. Ihre Pilgerreise erfährt einige Umwege, aus denen, auf einer literalen Ebene, nicht immer zu ersehen ist, wozu diese Abenteuer erzählt werden. Die Lektüre zwingt den Rezipienten geradezu nach einer zweiten, das heißt allegorischen Leseart, zu suchen.
Im fünfzehnten Kapitel des zweiten Buches findet sich die Erzählepisode vom Physeter oder Meerungeheuer, die auf die Carta Marina et descriptio septentrionalium terrarum von Olaus Magnus (1539) bezogen werden kann. Durch den intertextuellen Bezug zwischen Roman und der Karte von Skandinavien aus dem 16. Jahrhundert eröffnet sich, wie noch gezeigt werden wird, eine allegorisch religiöse Leseart des genannten Kapitels.
Die vorliegende Arbeit soll einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der Allegorese des Romans von Miguel de Cervantes geben. Die Hauptfrage lautet, in welcher Allegorie das fünfzehnte Kapitel gelesen werden kann. Es wird sich an besagter Textstelle zeigen, dass die religiös allegorische Leseart nicht durchgehalten werden kann.
Um den Punkt deutlich zu machen, muss ich zunächst auf die Biographie von Olaus Magnus eingehen, um die religiöse Allegorie der Carta Marina aufzurufen, um dann die Allegorie auf das Kapitel übertragen zu können. Anschließend werde ich das 'Durchhaltevermögen' der Allegorie am Kapitel untersuchen.
Inwieweit die getroffenen Aussagen, über die Allegorese des Kapitels, auf den gesamten Roman übertragen werden können, bleibt am Ende dieser Arbeit offen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Ein Gegenreformator im Exil
- 3. Sensus Spiritualis
- 4. Allegorien im fünfzehnten Kapitel
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Möglichkeiten und Grenzen der Allegorese in Miguel de Cervantes' Roman Los trabajos de Persiles y Sigismunda zu untersuchen. Insbesondere wird das fünfzehnte Kapitel des zweiten Buches auf seine allegorische Lesbarkeit hin analysiert. Dabei wird der intertextuelle Bezug zum Werk Carta Marina von Olaus Magnus herangezogen, um zu erforschen, ob und inwiefern sich eine religiös allegorische Interpretation des Kapitels begründen lässt.
- Die allegorische Dimension von Cervantes' Roman
- Die Carta Marina von Olaus Magnus als intertextueller Bezugspunkt
- Die religiöse Allegorie in der Carta Marina und ihre Übertragbarkeit auf das Kapitel
- Die Grenzen der allegorischen Interpretation
- Die Möglichkeiten der Allegorese in Cervantes' Roman
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Der Roman Los trabajos de Persiles y Sigismunda von Miguel de Cervantes wird vorgestellt. Die Arbeit stellt die Relevanz der allegorischen Interpretation des Romans heraus, insbesondere in Bezug auf das fünfzehnte Kapitel des zweiten Buches.
- Ein Gegenreformator im Exil: Die Biografie des Kartographen Olaus Magnus wird beleuchtet. Sein Leben im Exil nach der Reformation in Schweden und seine Arbeit an der Carta Marina werden als Hintergrund für die allegorische Interpretation des Romans von Bedeutung angesehen.
- Sensus Spiritualis: Die Carta Marina wird als mehr als nur eine kartographische Darstellung Nordeuropas beschrieben. Sie wird als ein Werk mit allegorischem Sinn, dem sensus spiritualis, interpretiert, der sich für die Gegenreformation einsetzt. Der Text verdeutlicht, dass die Karte Geschichten erzählt, die über die reine Darstellung von geografischen Details hinausgehen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Arbeit befasst sich mit den Themen Allegorese, Intertextualität, religiöse Allegorie, Carta Marina von Olaus Magnus, Gegenreformation und Los trabajos de Persiles y Sigismunda von Miguel de Cervantes.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Cervantes' Roman "Persiles y Sigismunda"?
Der Roman beschreibt die abenteuerliche Pilgerreise zweier Liebender nach Rom, die von wunderbaren Begebenheiten und seltsamen Begegnungen geprägt ist.
Warum wird eine allegorische Leseart für diesen Roman vorgeschlagen?
Viele Ereignisse im Roman erscheinen auf der wörtlichen Ebene unlogisch oder seltsam, was den Leser dazu zwingt, nach einer tieferen, oft religiösen Bedeutung zu suchen.
Welche Rolle spielt die "Carta Marina" von Olaus Magnus?
Die Karte dient als intertextueller Bezugspunkt für das 15. Kapitel. Sie enthält allegorische Darstellungen, die Cervantes für seine Erzählung über Meeresungeheuer nutzte.
Was bedeutet "Sensus Spiritualis"?
Es bezeichnet den geistigen oder allegorischen Sinn eines Textes oder Bildes, der über die rein materielle oder geografische Darstellung hinausgeht, oft im Sinne der Gegenreformation.
Sind der Allegorese in diesem Werk Grenzen gesetzt?
Ja, die Analyse zeigt, dass eine rein religiös-allegorische Interpretation oft nicht über das gesamte Kapitel oder den Roman hinweg lückenlos durchgehalten werden kann.
- Quote paper
- B.A. Michael Donth (Author), 2015, Allegorien in Cervantes' Roman "Los trabajos de Persiles y Sigismunda", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308192