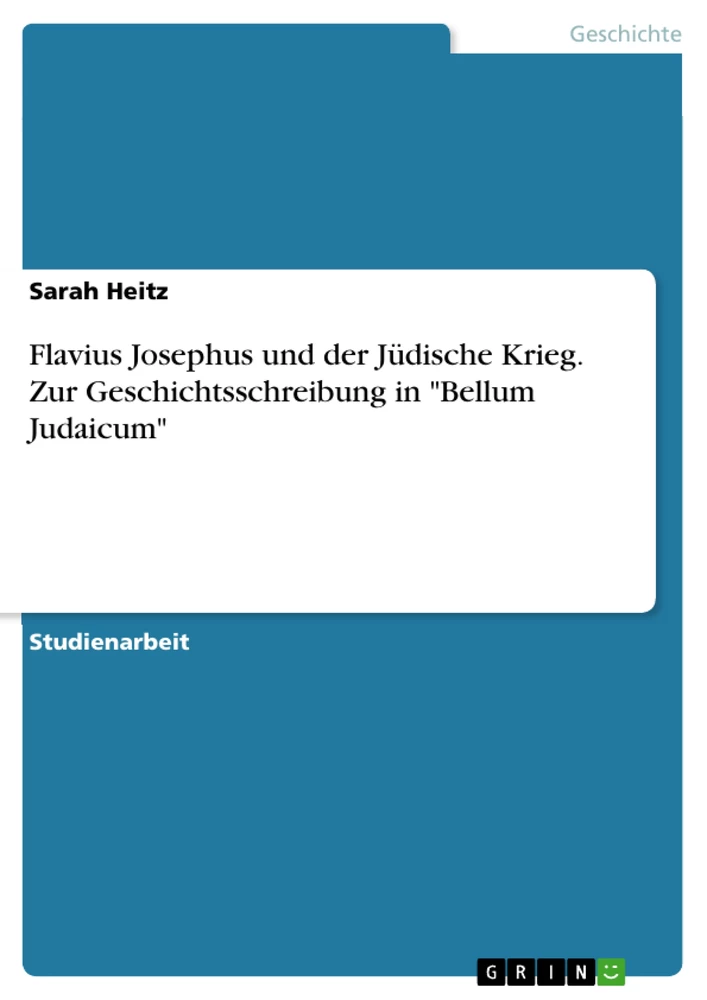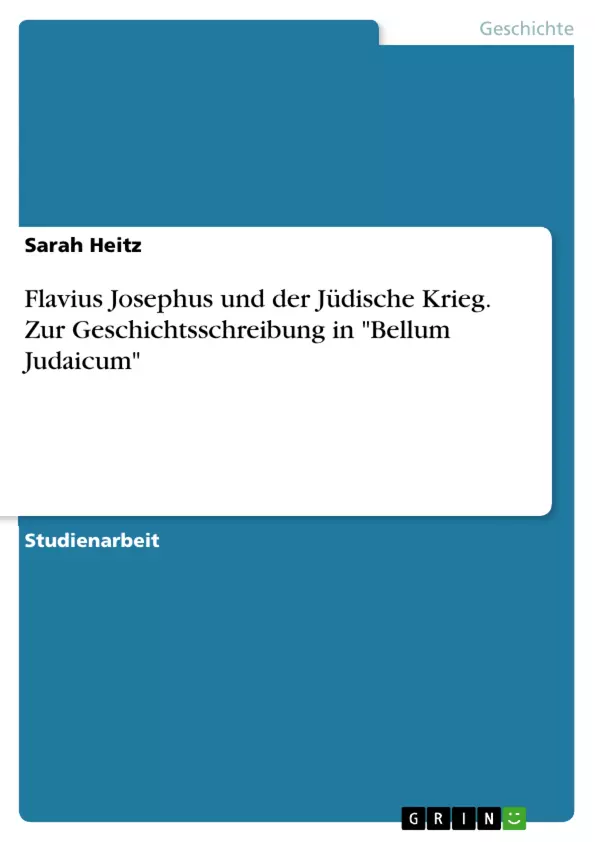Seinem Anspruch an die Geschichtsschreibung verleiht Flavius Josephus bereits in seinem Vorwort zu Bellum Judaicum Ausdruck. Darin verpflichtet er sich als Augenzeuge zu historischer Treue und dazu, nur das auf beiden Seiten tatsächlich Geschehene zu berichten, und, wie die alten Geschichtsschreiber, die Begebenheiten der eigenen Tage zu schildern. Einschränkend fügt er jedoch hinzu „ Will mich jemand um dessentwillen schelten, was ich, seufzend über das traurige Los meiner Vaterstadt, gegen die Tyrannen und ihren Anhang von Banditen im Tone der Anklage vorbringe, so möge er diesen Verstoss gegen das Gesetz der Geschichtsschreibung meinem Schmerz zugute halten.“
Von diesem Standpunkt aus betrachtet Josephus nun die Ereignisse in Bellum Judaicum mit dem selbst ernannten Ziel, „die Griechen sowie diejenigen Römer, die den Feldzug nicht mitgemacht [haben]“ über die Geschichte des Jüdischen Krieges zu informieren. Damit gibt Josephus in seinem Vorwort nicht mehr und nicht weniger vor als den Rahmen, innerhalb dessen er sein Werk und seine historiographische Leistung beurteilt sehen möchte.
Darüber hinaus darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass jeder Berichterstatter sich täuschen kann; dass er in der Regel nur unvollständig berichten kann, weil er bereits während des Berichtens eine Entscheidung treffen muss, welche Ereignisse er für bedeutend genug hält, um darüber zu informieren, und welche Ereignisse möglicherweise seine Adressaten interessieren könnten... Eine gänzlich objektive Quelle kann es demnach nicht geben. Jede Quelle trägt bewusst oder unbewusst, absichtlich oder ungewollt, offensichtlich oder unterschwellig die Handschrift ihres Verfassers. Diese Arbeit wird nun versuchen, anhand ausgewählter Beispiele die Handschrift des Josephus in Bellum Judaicum darzustellen, und auf mögliche unbewusste, unterschwellige oder absichtlich verschleierte Begebenheiten, Einflüsse und Intentionen im Werk aufmerksam zu machen. Gegenstand der Untersuchung ist zu zeigen, dass sein Werk einerseits von einem sehr tendenziösen und vereinfachenden Charakter geprägt ist, und sich andererseits durch seine vielen verschiedenen Einflüsse als hoch komplex erweist. Am Schluss dieser Untersuchung soll die Frage beantwortet werden, ob Josephus sich ebenfalls die im Zitat beschriebene Praxis zu eigen gemacht hat, oder ob er seinem Anspruch aus dem Vorwort zu Bellum Judaicum gerecht werden konnte.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- A. Einleitung: Anspruch an die Historiographie im Vorwort zu Bellum Judaicum
- B. Der historiographische Ort des Bellum Judaicum
- C. Der Autor - Flavius Josephus
- I. Biographische Daten
- II. Tendenzen Josephus' in seiner Geschichtsschreibung in Bellum Judaicum
- 1. Schmeicheleien gegenüber Titus und Lobreden auf die Stärke Roms.
- 2. Anschluss an hellenistische Traditionen
- 3. Apologetische Interpretation des Krieges.
- D. Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels – Zufall oder Absicht
- _I. Die Darstellung von Flavius Josephus - Zufall
- II. Zweifel an der Darstellung Josephus'und die Gegenthese - Absicht...
- E. Resümee: Umsetzung des historiographischen Anspruchs im Bellum Judaicum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit zielt darauf ab, anhand ausgewählter Beispiele die Handschrift des Josephus in Bellum Judaicum darzustellen und auf mögliche unbewusste, unterschwellige oder absichtlich verschleierte Begebenheiten, Einflüsse und Intentionen im Werk aufmerksam zu machen. Die Untersuchung soll zeigen, dass sein Werk einerseits von einem sehr tendenziösen und vereinfachenden Charakter geprägt ist und sich andererseits durch seine vielen verschiedenen Einflüsse als hoch komplex erweist. Abschließend wird die Frage beantwortet, ob Josephus sich die im Zitat beschriebene Praxis zueigen gemacht hat oder ob er seinem Anspruch aus dem Vorwort zu Bellum Judaicum gerecht werden konnte.
- Analyse der Handschrift von Josephus in Bellum Judaicum
- Untersuchung möglicher unbewusster, unterschwelliger oder absichtlicher Begebenheiten, Einflüsse und Intentionen
- Bewertung des tendenziösen und vereinfachenden Charakters des Werkes
- Erörterung der Komplexität des Werkes durch verschiedene Einflüsse
- Beantwortung der Frage, ob Josephus seinen Anspruch aus dem Vorwort zu Bellum Judaicum erfüllt hat
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet den Anspruch an die Historiographie, den Flavius Josephus im Vorwort zu Bellum Judaicum formuliert. Er bekennt sich als Augenzeuge zu historischer Treue und erklärt, nur das tatsächlich Geschehene zu berichten. Allerdings räumt er ein, dass seine Darstellung von persönlichen Emotionen beeinflusst sein kann. Josephus sieht die Schuld am Untergang Jerusalems bei den Zeloten und Sadduzäern, die er für die Zerstörung des Jahwe-Tempels verantwortlich macht. Rom hingegen trifft keine Schuld, da der Caesar Titus Mitleid mit dem Volk hatte und die Zerstörung Jerusalems hinauszögerte.
Im zweiten Kapitel wird der historiographische Ort des Bellum Judaicum untersucht. Flavius Josephus, geboren zwischen 37 und 38 n. Chr. und gestorben um 100 n. Chr., verfasste das Werk in griechischer Sprache. Die Veröffentlichung wurde von Vespasian persönlich freigegeben.
Das dritte Kapitel widmet sich Flavius Josephus als Autor und behandelt seine biographischen Daten sowie seine Tendenzen in der Geschichtsschreibung von Bellum Judaicum. Josephus schmeichelt Titus und lobt die Stärke Roms. Außerdem greift er auf hellenistische Traditionen zurück und interpretiert den Krieg apologetisch.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit Flavius Josephus, Bellum Judaicum, Historiographie, Tendenzen, Geschichtsschreibung, Judentum, Rom, Jerusalem, Tempel, Zerstörung, Titus, Zeloten, Sadduzäer, Objektivität, Quelle, Interpretation.
- Arbeit zitieren
- Sarah Heitz (Autor:in), 2005, Flavius Josephus und der Jüdische Krieg. Zur Geschichtsschreibung in "Bellum Judaicum", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308316