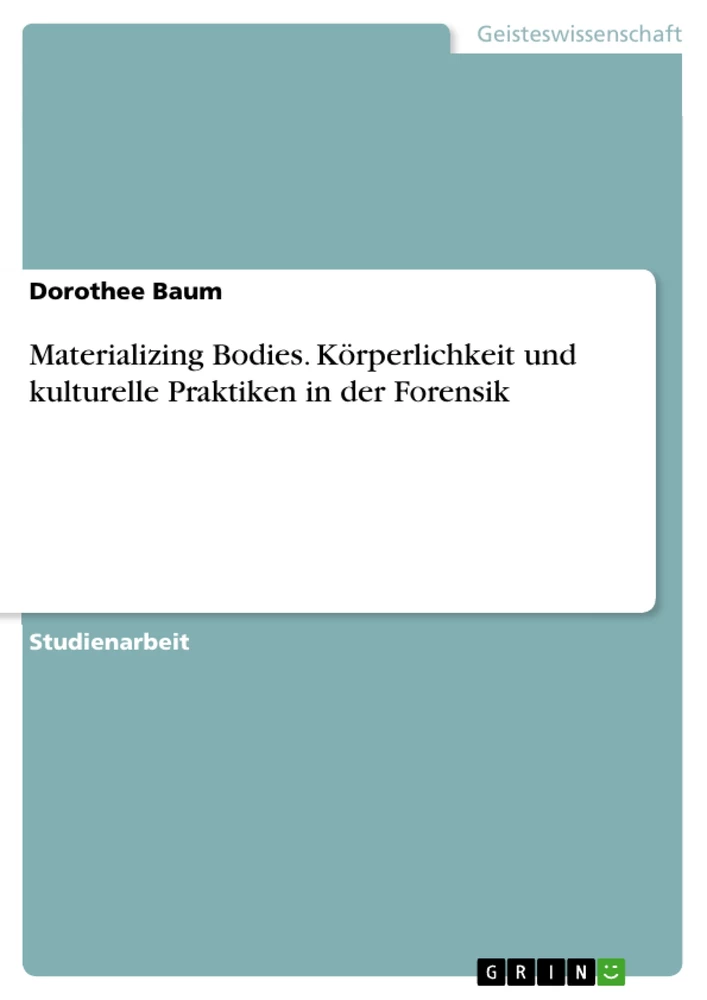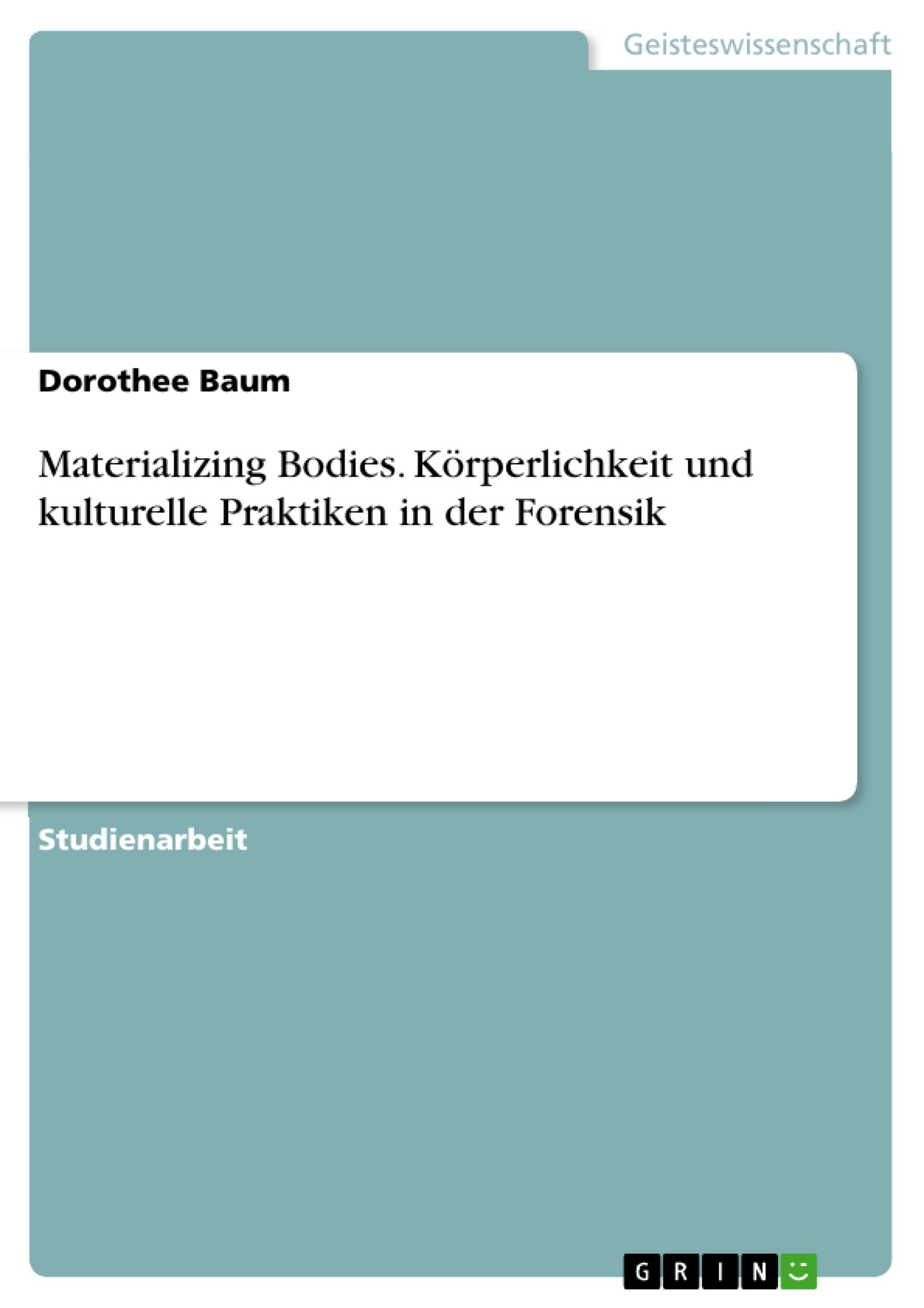Diese Arbeit basiert im Wesentlichen auf dem Text „Forensic evidence: Materializing bodies, materializing crimes“ von Corinna Kruse. Da Kruse auf das schwedische Rechtssystem rekurriert, wird in Hinblick auf die forensische Praxis zudem die österreichische Perspektive dargestellt.
Kruse übt mit ihrem Text heftige Kritik am starken Determinismus der Biologie und zeigt am Beispiel der forensischen Beweisführung und somit anhand eines Gebietes, das im Allgemeinen als ausschließlich in der Stofflichkeit verwurzelt betrachtet wird, auf, dass tatsächlich vielmehr eine enge, untrennbare materiell-technowissenschaftlich-kulturelle Verknüpfung vorliegt.
Mit der forensische Beweisführung gehe, so Kruse, eine Co-Materialisierung von Straftat und von bestimmten körperlichen und sozialen Konstellationen einher. Durch die Analyse der Produktionsmechanismen forensischer Beweise will Kruse einen Beitrag zum feministischen Verständnis der Untrennbarkeit von „sex“ und „gender“ leisten und Köper als fortwährende Materialisierung von materiell-technowissenschaftlich-kulturellen Praktiken verstanden wissen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Methode, Theorie und Praxis
- 2.1 Die Transformationskette („Legal Chain“)
- 2.1.1 Spurensicherung
- 2.1.2 Analyse des Beweismaterials
- 2.1.3 Beweisführung
- 2.2 Materializing Criminal Bodies – fragmentierte Körper
- 2.2.1 Co-Materialisierungen
- 2.3 Verschränkungen
- 2.1 Die Transformationskette („Legal Chain“)
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert den Text „Forensic evidence: Materializing bodies, materializing crimes“ von Corinna Kruse und untersucht, wie forensische Beweisführung den Körper materialisiert und somit zur Konstruktion von Geschlecht und Kriminalität beiträgt.
- Die Kritik am Determinismus der Biologie im Kontext forensischer Beweisführung.
- Die enge Verknüpfung von Materie, Technowissenschaften und kulturellen Praktiken in der forensischen Praxis.
- Die Co-Materialisierung von Straftat und Körper durch forensische Methoden.
- Der Beitrag der Arbeit zum feministischen Verständnis der Untrennbarkeit von „sex“ und „gender“.
- Die Reintegration des Körpers in feministische Epistemologien.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- 1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt die Autorin Corinna Kruse und ihr Werk „Forensic evidence: Materializing bodies, materializing crimes“ ein. Es wird erläutert, wie Kruse die forensische Praxis im Kontext der Materialisierung von Körpern und Straftaten analysiert und kritisch betrachtet.
- 2. Methode, Theorie und Praxis: Dieses Kapitel erörtert die Methoden, Theorien und Praktiken, die Kruse in ihrer Analyse verwendet. Es werden die Forensik als Fachgebiet, die Arbeitsweise von Kruse und deren Bezug zu Judith Butlers Theorie der „materialization“ sowie Karen Barads Konzept des „Agential Realism“ vorgestellt.
- 2.1 Die Transformationskette („Legal Chain“): Dieses Unterkapitel beschreibt die „Legal Chain“, die forensische Spuren im Rechtssystem durchlaufen. Dabei wird der Idealfall der Beweisführung von der Spurensicherung am Tatort bis zur rechtskräftigen Verurteilung dargestellt.
- 2.2 Materializing Criminal Bodies – fragmentierte Körper: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die Materialisierung des Körpers durch forensische Beweisführung. Es wird erläutert, wie forensische Methoden den Körper in Fragmente zerlegen und diese für die Konstruktion von Kriminalität nutzen.
- 2.3 Verschränkungen: Dieses Unterkapitel fokussiert auf die Verschränkungen von Materie, Technowissenschaften und Kultur in der forensischen Praxis. Es wird gezeigt, wie diese Faktoren zusammenwirken und die Materialisierung des Körpers beeinflussen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt Schlüsselbegriffe wie forensische Beweisführung, Materialisierung, Körper, Geschlecht, Kriminalität, Technowissenschaften, Kultur, Feministische Epistemologie, Judith Butler, Karen Barad, „Legal Chain“, „Agential Realism“. Die Arbeit beleuchtet die enge Verknüpfung von Materie, Technowissenschaften und kulturellen Praktiken in der forensischen Beweisführung und analysiert, wie diese Faktoren zur Konstruktion von Geschlecht und Kriminalität beitragen.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Corinna Kruse an der forensischen Praxis?
Sie kritisiert den starken biologischen Determinismus und zeigt auf, dass forensische Beweise tatsächlich eine Verknüpfung von Materie, Technik und Kultur sind.
Was bedeutet „Materialisierung“ des Körpers in der Forensik?
Es beschreibt den Prozess, wie der Körper durch technowissenschaftliche Praktiken in Fragmente zerlegt und als Beweismittel für Straftaten neu konstruiert wird.
Was ist die „Legal Chain“ (Transformationskette)?
Die Legal Chain umfasst den Weg einer Spur vom Tatort über die Analyse im Labor bis hin zur Beweisführung im Gerichtssaal.
Wie hängen „sex“ und „gender“ laut dieser Arbeit zusammen?
Die Arbeit nutzt die Forensik als Beispiel, um die Untrennbarkeit von biologischem Geschlecht und kultureller Geschlechterkonstruktion im Sinne feministischer Epistemologien aufzuzeigen.
Was versteht man unter „Co-Materialisierung“?
Es bezeichnet die gleichzeitige Entstehung der Identität einer Straftat und der Materialisierung bestimmter körperlicher Merkmale durch forensische Methoden.
Welche Rolle spielt Karen Barads „Agential Realism“?
Dieses Konzept dient als theoretische Basis, um die Verschränkung von menschlichen Akteuren, Messinstrumenten und der materiellen Welt zu erklären.
- Quote paper
- Dorothee Baum (Author), 2013, Materializing Bodies. Körperlichkeit und kulturelle Praktiken in der Forensik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308338