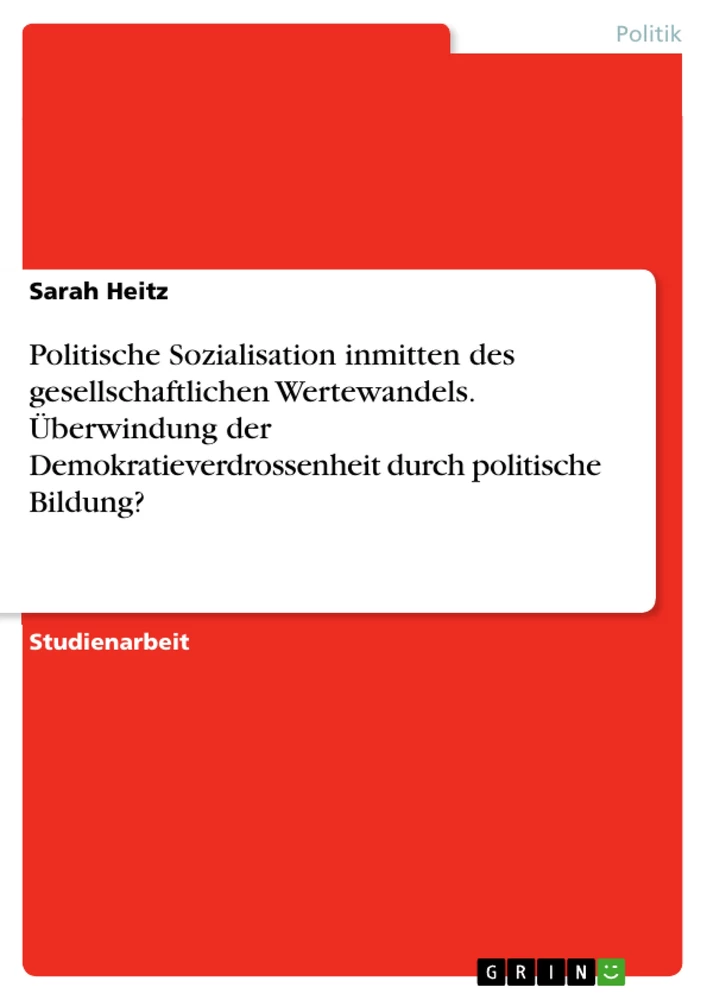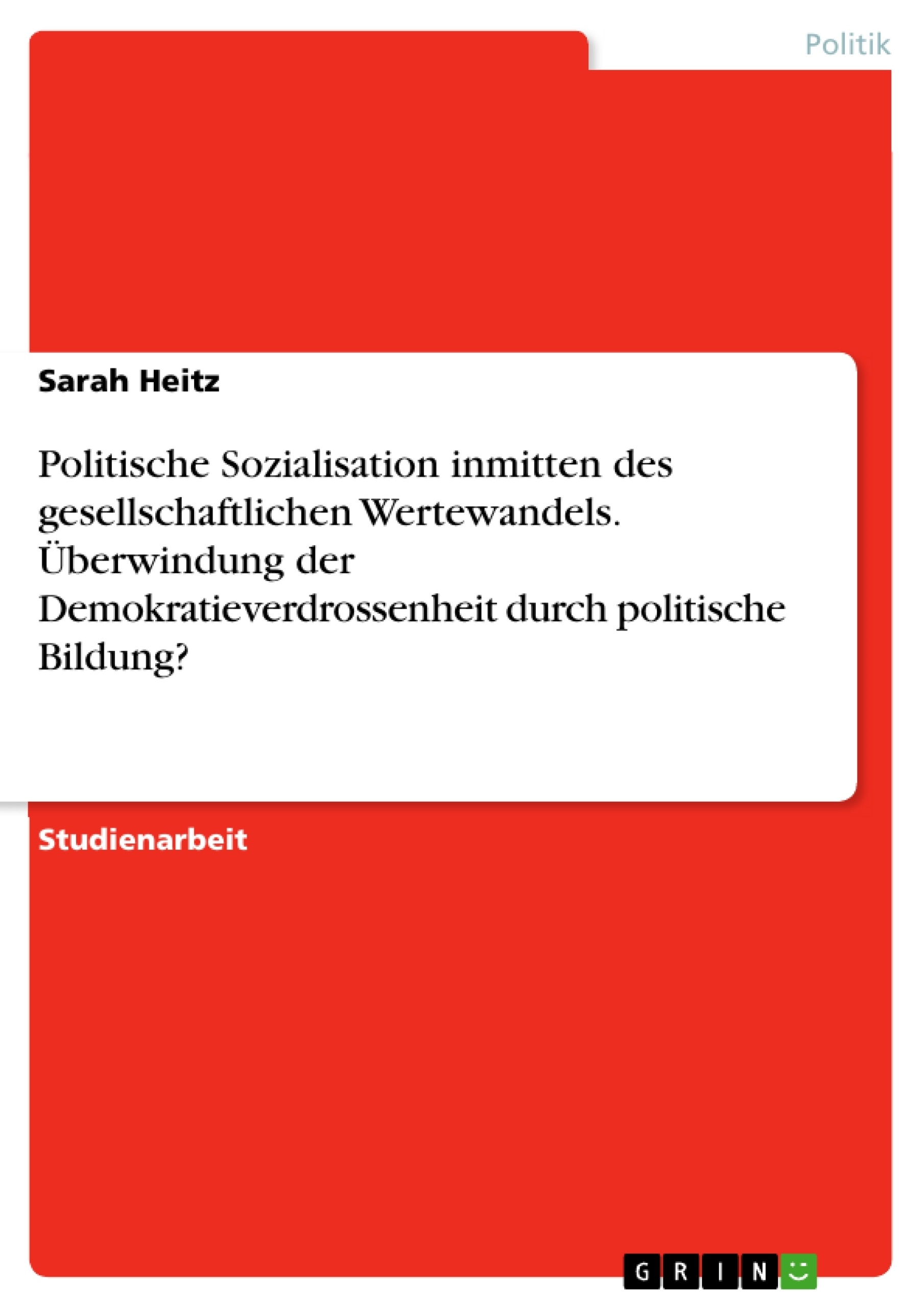Diese Arbeit beschäftigt sich mit der derzeitigen allgegenwärtigen Politik- und Demokratieverdrossenheit in Deutschland. Sie zeichnet in einem ersten Schritt die theoretischen Grundlagen der politischen Sozialisation nach. In einem zweiten Schritt werden die Herausforderungen der politischen Bildung im Kontext des Werte- und Gesellschaftswandels analysiert. Abschließend werden die sich aus der Analyse ergebenden Konsequenzen für die politische Bildung erörtert, welche zu einer Überwindung der Systemverdrossenheit beitragen könnten.
Nicht erst seit dem Jahr 2000 ist Politikverdrossenheit in aller Munde. Neu und alarmierend ist jedoch, dass dieser Politikverdrossenheit neuerdings eine Demokratieverdrossenheit, also eine Unzufriedenheit mit dem System, zugrunde liegt. Diese Systemverdrossenheit lässt sich unter anderem auf einen Mangel an politischer Bildung zurückführen. Trotz der Kenntnis dieser Tatsache ist es bei politischen Lippenbekenntnissen und der Forderung nach politischer Bildung geblieben, ohne diese jedoch tatsächlich zu fördern. Im Gegenteil, insbesondere nach den Ergebnissen der PISA-Studien wurde die politische Bildung zugunsten der Förderung naturwissenschaftlichen Fächer weiter zurückgedrängt.
Dabei könnte sich gerade die Systemverdrossenheit, aufgrund eines Informationsmangels über das System und die für das System essenzielle Notwendigkeit der politischen Partizipation als Chance für die Politik erweisen. Falls dies nämlich der Fall sein sollte, könnte die Politik mit einer wiedereingeführten politischen Bildung, im Sinne von Werteerziehung, dagegen steuern. Sollte sich die Politikverdrossenheit dagegen als Ergebnis einer tiefergehenden, bewusst reflektierten Systemunzufriedenheit herausstellen, wird es die Politik ungleich schwerer haben diese Systemkritik durch Abwesenheit politischer Beteiligung zu beheben, wie diese Arbeit zeigt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- A. Einleitung: Entgegen besseren Wissens
- B. Die theoretischen Grundlagen einer politischen Bewusstseinbildung
- I. Die vorpolitische Sozialisation in der Kindheit.
- II. Die politische Sozialisation und Identitätsbildung in der Adoleszenz.
- 1. Moralische Entwicklung und politische Sozialisation
- 2. Politische Identitätsbildung als Entwicklungsaufgabe.
- 3. Instanzen politischer Sozialisation im Jugendalter
- 3.1 Die Familie.
- 3.2 Die Gleichaltrigen
- 3.3 Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden wichtigen Instanzen
- 4. Soziale Ungleichheit und politische Sozialisation
- C. Herausforderungen der politischen Bildung in der Bundesrepublik
- I. Anspruch der Demokratie an die politische Sozialisation.
- II. Gesellschaftliche Entwicklungen und Wertewandel.
- 1. Die gesellschaftlichen Veränderungen in der Bundesrepublik
- 2. Die Wiedervereinigung.
- 3. Aktuelle Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung
- III. Konsequenzen für die politische Bildung
- D. Resümee: Politische Bildung als Gegenmittel für Demokratieverdrossenheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Demokratieverdrossenheit, insbesondere im Kontext der politischen Bildung. Das Ziel der Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen der politischen Sozialisation zu beleuchten und die Herausforderungen der politischen Bildung in der Bundesrepublik im Kontext des Werte- und Gesellschaftswandels zu analysieren. Abschließend werden die sich aus der Analyse ergebenden Konsequenzen für die politische Bildung erörtert, welche zu einer Überwindung der Systemverdrossenheit beitragen könnten.
- Politische Sozialisation
- Demokratieverdrossenheit
- Wertewandel und gesellschaftliche Entwicklungen
- Herausforderungen der politischen Bildung
- Konsequenzen für die politische Bildung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Problem der Demokratieverdrossenheit und die Relevanz politischer Bildung in diesem Zusammenhang dar. Kapitel B untersucht die theoretischen Grundlagen der politischen Sozialisation, beginnend mit der vorpolitischen Sozialisation in der Kindheit und der Bedeutung der Familie und der Gruppe der Gleichaltrigen. In Kapitel B.II werden die Jahre der Adoleszenz als entscheidend für das Entstehen politischen Denkens betrachtet, wobei die moralische Entwicklung und die politische Identitätsbildung im Vordergrund stehen.
Kapitel C analysiert die Herausforderungen der politischen Bildung in der Bundesrepublik. Es werden die Ansprüche der Demokratie an die politische Sozialisation, die gesellschaftlichen Veränderungen und der Wertewandel, sowie die Wiedervereinigung und aktuelle Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung beleuchtet. Abschließend werden die sich aus der Analyse ergebenden Konsequenzen für die politische Bildung erörtert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Politische Sozialisation, Demokratieverdrossenheit, Wertewandel, Gesellschaftliche Entwicklung, Politische Bildung, Familie, Gleichaltrige, Moralische Entwicklung, Identitätsbildung, Herausforderungen, Konsequenzen, Bundesrepublik Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Politik- und Demokratieverdrossenheit?
Politikverdrossenheit richtet sich gegen Akteure und Parteien, während Demokratieverdrossenheit eine tiefere Unzufriedenheit mit dem demokratischen System an sich beschreibt.
Welche Rolle spielt die Familie bei der politischen Sozialisation?
Die Familie gilt als die erste und wichtigste Instanz der vorpolitischen Sozialisation, in der grundlegende Werte und Einstellungen geprägt werden.
Kann politische Bildung die Systemverdrossenheit überwinden?
Die Arbeit untersucht, ob verstärkte politische Bildung als „Gegenmittel“ wirken kann, indem sie Wissen über das System vermittelt und zur Partizipation anregt.
Welchen Einfluss hatte die PISA-Studie auf die politische Bildung?
Nach PISA wurde die politische Bildung oft zugunsten naturwissenschaftlicher Fächer zurückgedrängt, was laut der Arbeit zum Mangel an politischem Verständnis beigetragen haben könnte.
Wie wirkt sich soziale Ungleichheit auf die politische Identität aus?
Soziale Ungleichheit kann den Zugang zu politischer Bildung erschweren und somit die politische Sozialisation und die Bereitschaft zur Teilhabe negativ beeinflussen.
- Quote paper
- Sarah Heitz (Author), 2006, Politische Sozialisation inmitten des gesellschaftlichen Wertewandels. Überwindung der Demokratieverdrossenheit durch politische Bildung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308362