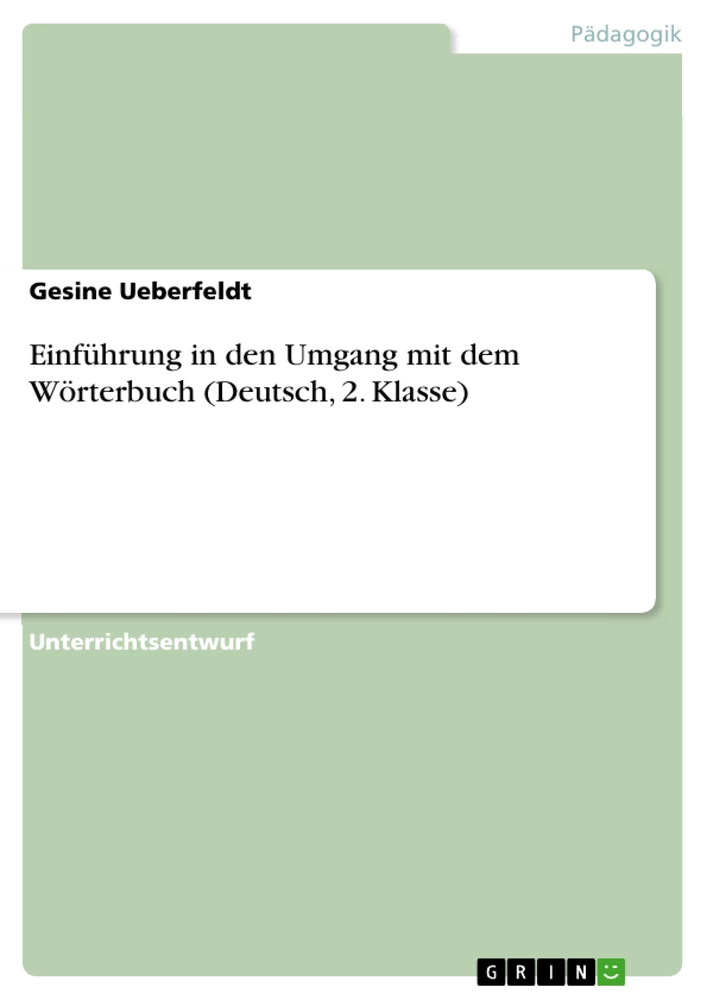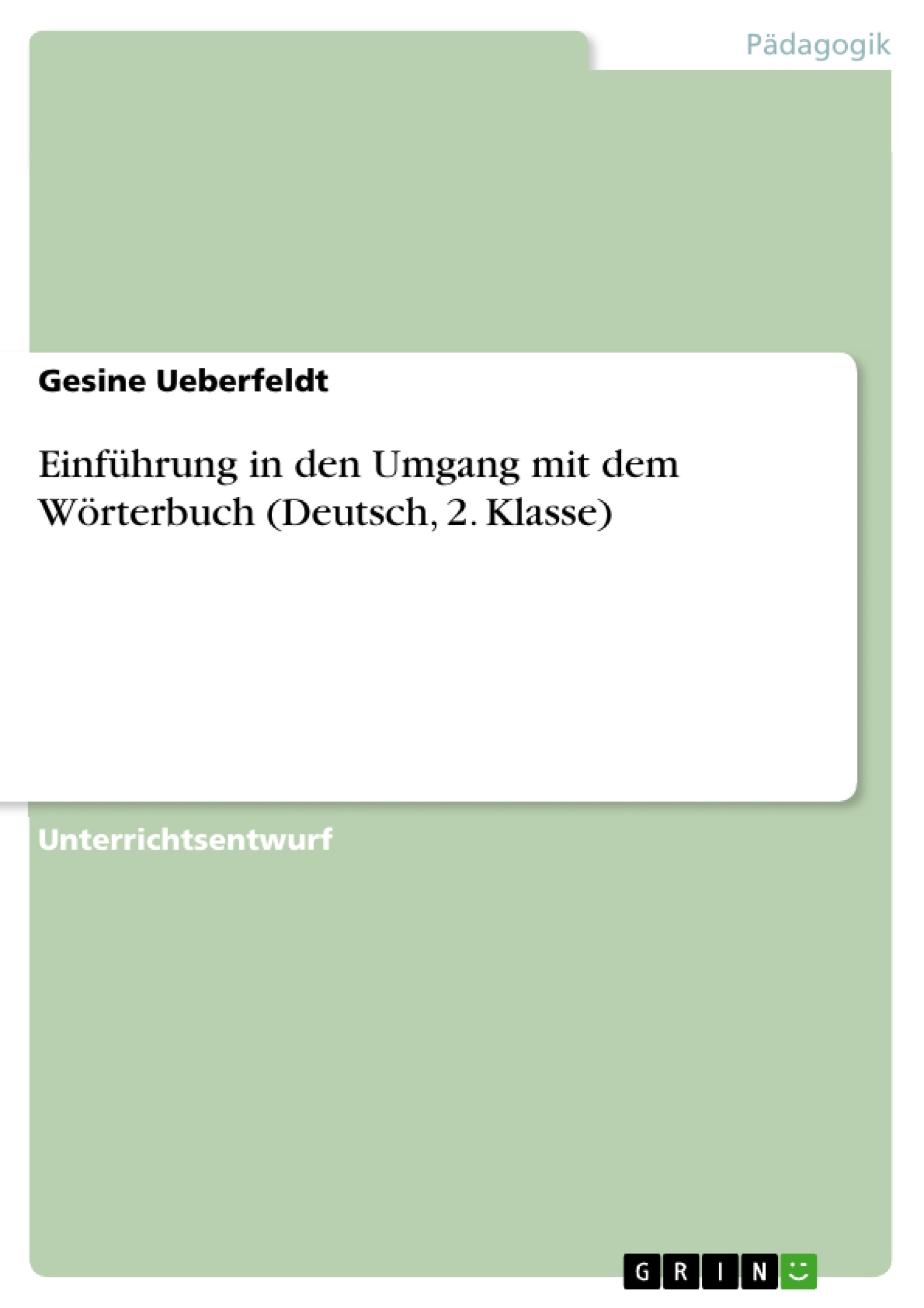Mir ist bewusst, dass gerade in der heutigen Gesellschaft das eigenständige Nachschlagen von unbekannten Sachverhalten sowie die Voraussetzung der Kenntnis über das Alphabet von großer Bedeutung ist, um selbstständig agieren zu können. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Wörterbuch, auch in anderen Bereichen, wie das Nachschlagen von Telefonnummern, das Recherchieren im Internet oder im Bereich des Lexikons ist dieses Wissen sehr elementar. Gerade diese Vielfältigkeit macht das Thema für mich persönlich spannend, dass ich motiviert war eine Unterrichtsstunde darüber zu gestalten.
Außerdem finde ich es wichtig, sich mit diesem Thema im Unterricht zu befassen, da der Umgang mit dem Wörterbuch die Kinder nicht nur selbstständiger, sondern auch unabhängiger von der Lehrkraft macht. Sie können eigenständig nachschlagen und sich selbst überprüfen, was sie wiederum Selbstbewusstsein und Stärke entwickeln lässt.
Weiterhin finde ich interessant, Einblicke in die persönlichen Erfahrungen der Kinder mit dem Umgang des Wörterbuchs zu bekommen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass manche Kinder eventuell bereits negative Erfahrungen mit dem Wörterbuch gemacht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie beim Finden des gesuchten Wortes enttäuscht worden sind oder durch sehr zeitaufwändiges Suchen aufgegeben haben. Daher ist es mir wichtig, den Kindern bestimmte Hilfen an die Hand zu geben, um die Arbeit mit dem Wörterbuch zu erleichtern und ihnen die Freude an der Suche (zurück) zu geben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Allgemeine Angaben
- Situationsanalyse
- Rahmenbedingungen
- Klasse
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Themas für die SchülerInnen
- Exemplarische Bedeutung
- Bezug zum Lehrplan
- Analyse der Lernvoraussetzungen
- Lernziele
- Grobziel (Stundenziel)
- Feinziele (Teilziele, in operationalisierter Form)
- Methodische Analyse
- Diskussion der Zugangswege und Alternativen und Begründung des eigenen Vorgehens
- Erarbeitungsphasen
- Abschluss der Stunde
- Strukturskizze
- Literaturangaben
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Zielsetzung dieser Unterrichtsstunde ist es, den Schülern der Klasse 2b eine Einführung in den Umgang mit dem Wörterbuch zu ermöglichen. Dazu wird die Bedeutung von Wörterbüchern im Lernprozess aufgezeigt und grundlegende Suchstrategien vermittelt.
- Einführung in die Funktionsweise eines Wörterbuchs
- Entwicklung von Suchstrategien für unbekannte Begriffe
- Vertiefung des Verständnisses für die Bedeutung von Wörtern
- Förderung der Selbstständigkeit im Lernprozess
- Motivation für die Nutzung von Wörterbüchern
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Abschnitt des Unterrichtsentwurfs "Allgemeine Angaben" gibt Einblick in die Erfahrungen der Verfasserin im Bereich der Grundschulbildung und beschreibt den Kontext des Praktikums an der Xxxxx-Grundschule Xxxxxxxx.
Im zweiten Kapitel "Situationsanalyse" wird zunächst der Rahmen des Unterrichts beleuchtet. Es werden die baulichen Gegebenheiten der Schule und der Klassenzimmer beschrieben, sowie die spezifischen Merkmale der Klasse 2b, wie zum Beispiel die Anzahl der Schüler, ihre Fähigkeiten und ihre Lernbereitschaft.
Die "Sachanalyse" führt in das Thema der Unterrichtsstunde "Umgang mit dem Wörterbuch" ein. Die Verfasserin beschreibt ihre persönliche Motivation, sich mit dieser Thematik zu befassen, sowie die Relevanz des Themas für den Lernprozess der Schüler.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Schlüsselwörter dieser Unterrichtsstunde sind: Wörterbuch, Umgang mit dem Wörterbuch, Suchstrategien, Sprachentwicklung, Lernprozess, Selbstständigkeit, Grundschule.
- Quote paper
- Gesine Ueberfeldt (Author), 2011, Einführung in den Umgang mit dem Wörterbuch (Deutsch, 2. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308392