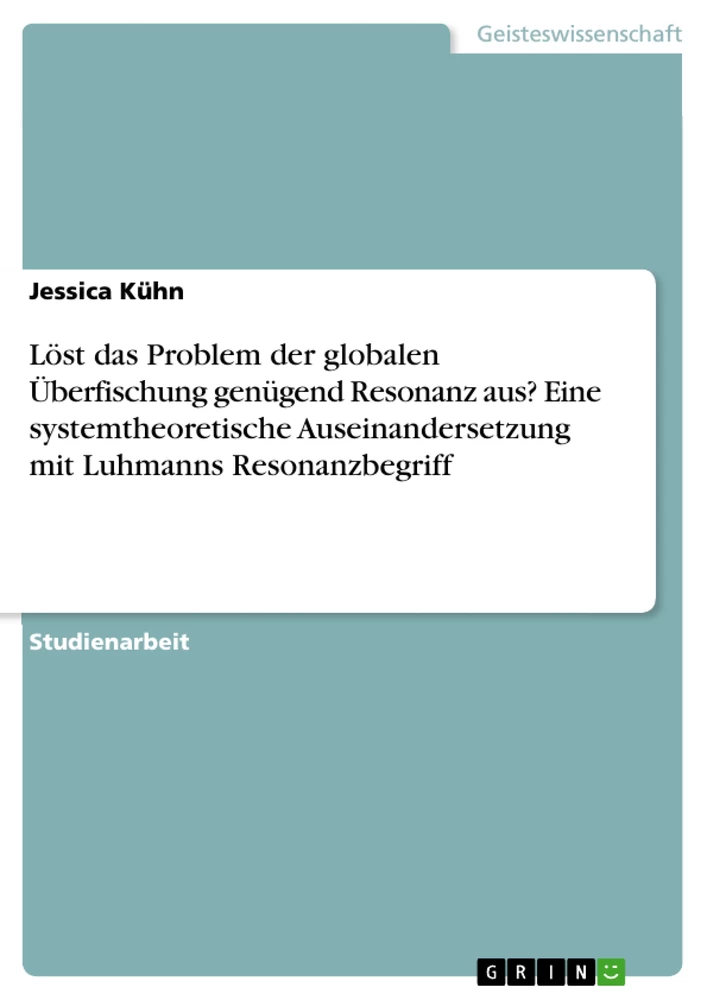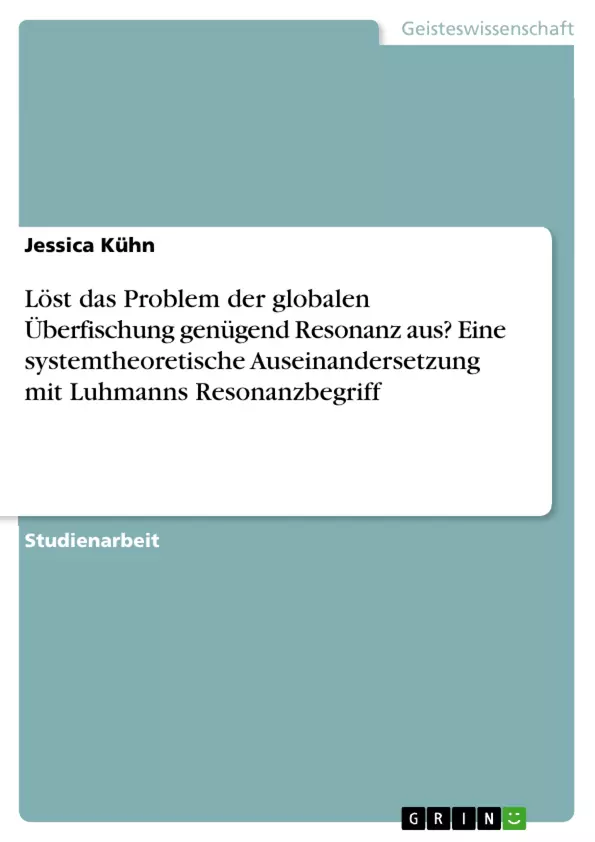Welche Zukunft haben die Meere? Durch sogenannte Überfischung wurden die weltweiten Fischbestände um bis zu 80 Prozent dezimiert.
Die vorliegende Arbeit soll erneut auf die gegenwärtige Problematik aufmerksam machen und daraus folgernd die Frage beantworten, ob und inwiefern auf das Overfishing und dessen verheerende Auswirkungen reagiert wird. Dazu wird die Überfischung der Weltmeere zu Beginn der Arbeit ausführlich behandelt. Da die Komplexität der Systemtheorie ein fundiertes theoretisches Gerüst für die Analyse der Maßnahmen gegen die bestehenden Probleme im Bereich der Überfischung der Weltmeere bildet, soll diese anschließend kurz erläutert werden.
Im Anschluss daran wird der mit der Theorie und ökologischen Gefährdungen in Verbindung stehende Resonanzbegriff Luhmanns thematisiert. Dieser soll im Zusammenhang mit der Bewertung der Reaktionen auf das Problem der Überfischung eine zentrale Rolle spielen. Auf Grundlage näherer Ausführungen dazu soll die Arbeit mit der Beantwortung der anfangs gestellten Frage abschließen: Löst die Problematik ausreichend Resonanz aus und inwiefern wird eine nachhaltige Fischereipolitik angestrebt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Überfischung der Meere
- Überfischung als globales Problem
- Auswirkungen des Overfishing
- Folgen der Überfischung für das Ökosystem Meer
- Die Konsequenzen der Fischerei für den Menschen
- Systemtheorie und Resonanzbegriff Luhmanns
- Die Systemtheorie im Überblick
- Der Resonanzbegriff Luhmanns
- Zu viel oder zu wenig Resonanz - Reaktionen auf das globale Problem der Überfischung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Problematik der Überfischung der Weltmeere und untersucht die Reaktion auf dieses globale Problem anhand der Systemtheorie und des Resonanzbegriffs von Niklas Luhmann. Ziel ist es, zu analysieren, ob und inwiefern auf das Overfishing und dessen verheerende Auswirkungen reagiert wird.
- Die Überfischung der Meere als globales Problem und ihre Ursachen
- Die Auswirkungen der Überfischung auf das Ökosystem Meer und die menschliche Gesellschaft
- Die Anwendung der Systemtheorie zur Analyse der Reaktionen auf die Überfischung
- Der Resonanzbegriff Luhmanns im Zusammenhang mit der Bewertung der Reaktionen auf die Überfischung
- Die Frage nach der ausreichenden Resonanz auf das Problem der Überfischung und die Möglichkeiten einer nachhaltigen Fischereipolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Überfischung ein und beleuchtet die Bedrohungslage der Meere sowie die Ursachen für die Überfischung. Anschließend werden die Auswirkungen der Überfischung auf das Ökosystem Meer und die Folgen für die menschliche Gesellschaft detailliert dargestellt. Das dritte Kapitel erläutert die Systemtheorie und den Resonanzbegriff von Niklas Luhmann, welche als theoretisches Gerüst für die Analyse der Reaktionen auf die Überfischung dienen.
Schlüsselwörter
Überfischung, Overfishing, Systemtheorie, Resonanz, Niklas Luhmann, Ökosystem Meer, Fischereipolitik, Nachhaltigkeit, Gesellschaft, Reaktion, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie stark sind die weltweiten Fischbestände durch Überfischung bedroht?
Die weltweiten Fischbestände wurden durch Überfischung bereits um bis zu 80 Prozent dezimiert.
Was bedeutet „Resonanz“ im Sinne von Niklas Luhmann?
Resonanz bezeichnet in der Systemtheorie die Fähigkeit eines Systems (z. B. Politik oder Wirtschaft), auf Umweltveränderungen oder ökologische Gefährdungen zu reagieren.
Welche Auswirkungen hat die Überfischung auf den Menschen?
Neben der Zerstörung mariner Ökosysteme bedroht die Überfischung die Ernährungssicherheit und die wirtschaftliche Grundlage von Millionen Menschen weltweit.
Löst das Problem der Überfischung genug gesellschaftliche Reaktion aus?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die aktuelle Fischereipolitik ausreichend auf die ökologischen Warnsignale reagiert oder ob die systemische Resonanz zu schwach ist.
Was ist das Ziel einer nachhaltigen Fischereipolitik?
Ziel ist es, die Entnahme von Fisch so zu steuern, dass sich die Bestände regenerieren können und die langfristige Stabilität des Ökosystems Meer gewährleistet bleibt.
- Quote paper
- Jessica Kühn (Author), 2014, Löst das Problem der globalen Überfischung genügend Resonanz aus? Eine systemtheoretische Auseinandersetzung mit Luhmanns Resonanzbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308407