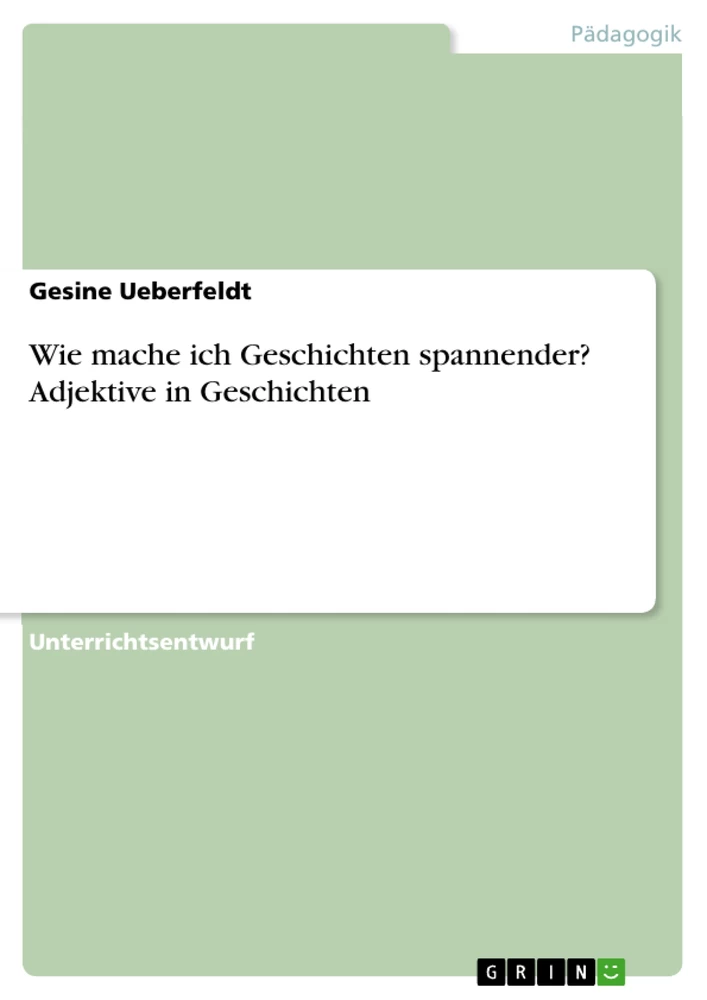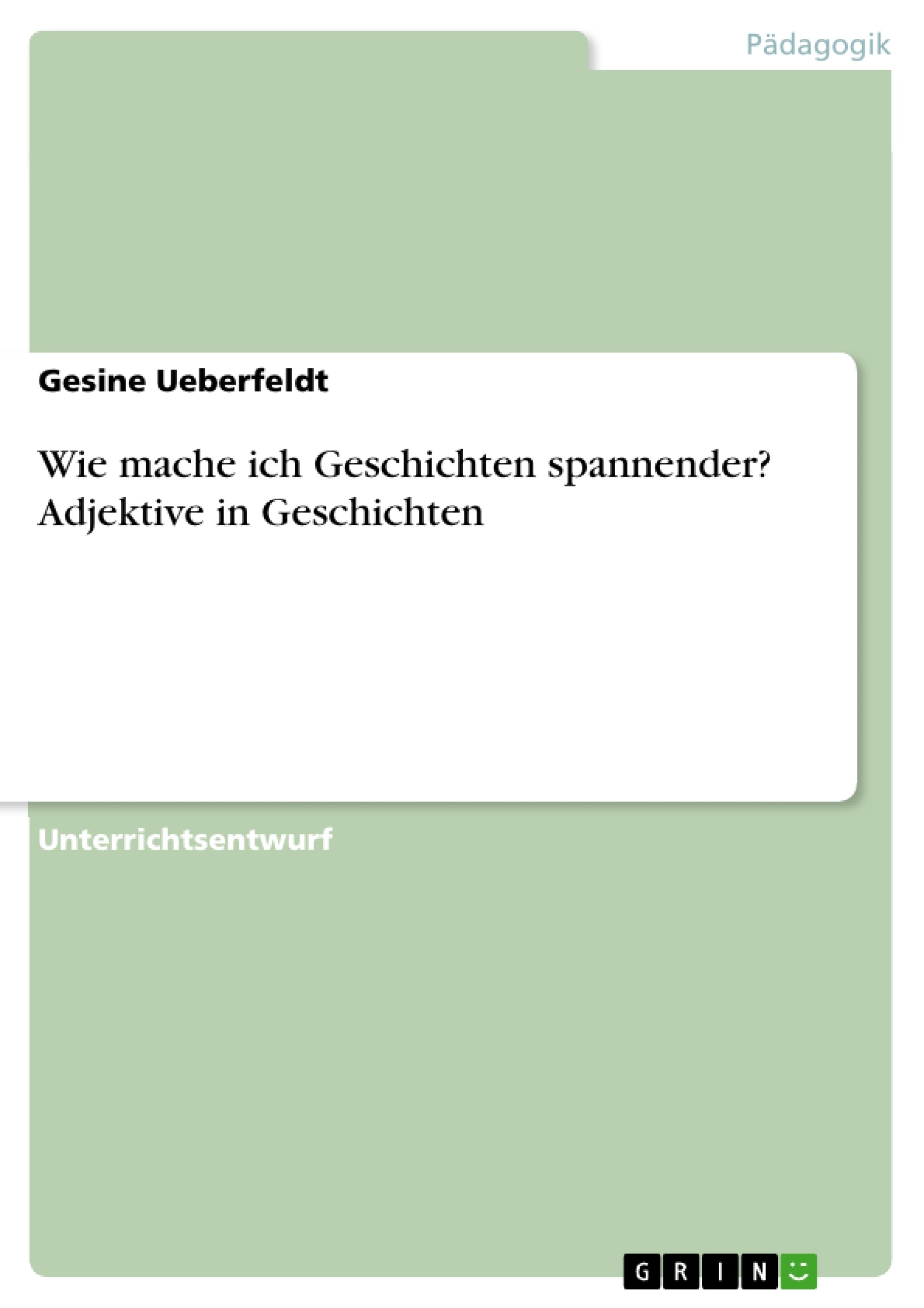Dieses Thema ist im Unterricht fest verankert, da das Geschichten schreiben die Kinder täglich begleitet. Sie bekommen vorgelesen, lesen selbst und beurteilen Geschichten nach ihrem Spannungsgrad. Sie fangen selbst zu schreiben an, lernen Geschichten adressatenorientiert zu schreiben und sind somit motiviert, sie spannend zu gestalten. In dieser Stunde lernen sie, wie sie eine Geschichte mit Adjektiven spannender gestalten können.
Außerdem finde ich es auch interessant, Einblicke in die persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse und Interessen der Kinder zu bekommen, die sie in ihren Geschichten äußern und einbringen. Durch einen Erfahrungsaustausch können die Kinder zusätzlich etwas voneinander lernen.
Adjektive bezeichnen Eigenschaften und Merkmale, aber man gibt mit ihnen auch an, wie jemand oder etwas ist, wie etwas vor sich geht oder wie etwas geschieht. Nach Adjektiven fragt man mit den Fragen „Wie ist etwas/jemand?“ oder „Wie geschieht etwas?“. Adjektive erfüllen unter Anderen den Zweck, Geschichten spannender, lustiger oder unterhaltsamer zu gestalten. In dieser Stunde geht es speziell darum, spannende Adjektive von anderen abzugrenzen, um erfahrbar zu machen, welche Adjektive sich für Gruselgeschichten eignen.
Inhaltsverzeichnis
- Unmittelbare Lernvoraussetzungen
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
- Einordnung der Stunde
- Strukturskizze
- Reflexion der Stunde
- Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, dass die Schüler der dritten Klasse die Wirkung von Adjektiven auf die Spannung einer Geschichte erkennen und verstehen lernen. Die Schüler sollen erfahren, welche Adjektive die Spannung erhöhen und welche nicht. Sie sollen diese Fähigkeit praktisch anwenden können.
- Wirkung von Adjektiven auf die Spannung
- Identifizierung spannungssteigernder Adjektive
- Unterscheidung zwischen spannungssteigernden und anderen Adjektiven
- Praktische Anwendung des Wissens beim Schreiben von Geschichten
- Analyse von Textbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Unmittelbare Lernvoraussetzungen: Dieser Abschnitt beschreibt die Zusammensetzung der dritten Klasse, bestehend aus 26 Kindern mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Er hebt das positive Klassenklima, die Leistungsfähigkeit der Schüler und deren positive Einstellung gegenüber neuen Lehrkräften und Unterrichtsmethoden hervor. Die Schüler sind aufmerksam, arbeitsam und zeigen eine hohe Bereitschaft zur Mitarbeit.
Sachanalyse: Hier wird das Thema der Unterrichtsstunde, "Wie mache ich Geschichten spannender? - Adjektive in Geschichten", begründet. Die Verfasserin erläutert ihre persönliche Motivation für die Wahl dieses Themas, die aus ihrem eigenen Interesse am Schreiben und dem Studium der deutschen Sprache resultiert. Sie beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext des bestehenden Unterrichts und betont die Bedeutung des Schreibens von Geschichten für die Schüler. Der Abschnitt erklärt die Funktion von Adjektiven und deren Rolle bei der Gestaltung von Spannung in Geschichten.
Didaktische Analyse: Dieser Abschnitt beschreibt das didaktische Vorgehen der Unterrichtsstunde. Das Ziel ist das Verständnis der Schüler für die Verwendung von Adjektiven zur Steigerung der Spannung. Der Ablauf umfasst die Betrachtung eines Bildes, das Vorlesen und Vergleichen von Textausschnitten mit unterschiedlichem Spannungsgrad und die anschließende schriftliche Festhaltung der Erkenntnisse. Die Schüler sollen lernen, spannungssteigernde Adjektive zu identifizieren und von anderen Adjektiven zu unterscheiden.
Schlüsselwörter
Adjektive, Spannung, Geschichten schreiben, Gruselgeschichten, Didaktik, Grundschule, Deutschunterricht, Textanalyse, Spannungssteigerung
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsstunde: "Wie mache ich Geschichten spannender? - Adjektive in Geschichten"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau auf eine Unterrichtsstunde zum Thema "Wie mache ich Geschichten spannender? - Adjektive in Geschichten". Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Unmittelbare Lernvoraussetzungen, Sachanalyse, Didaktische Analyse, Methodische Analyse – fehlt im vorliegenden Auszug, Einordnung der Stunde – fehlt im vorliegenden Auszug, Strukturskizze – fehlt im vorliegenden Auszug, Reflexion der Stunde – fehlt im vorliegenden Auszug, Quellenverzeichnis – fehlt im vorliegenden Auszug, Anhang – fehlt im vorliegenden Auszug) und Schlüsselwörter.
Was ist die Zielsetzung der Unterrichtsstunde?
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, dass die Schüler der dritten Klasse die Wirkung von Adjektiven auf die Spannung einer Geschichte erkennen und verstehen lernen. Sie sollen spannungssteigernde Adjektive identifizieren und von anderen Adjektiven unterscheiden können und dieses Wissen beim Schreiben eigener Geschichten anwenden.
Welche Themen werden in der Unterrichtsstunde behandelt?
Die zentralen Themen sind die Wirkung von Adjektiven auf die Spannung, die Identifizierung spannungssteigernder Adjektive, die Unterscheidung zwischen spannungssteigernden und anderen Adjektiven, die praktische Anwendung des Wissens beim Schreiben von Geschichten und die Analyse von Textbeispielen.
Wie ist die dritte Klasse zusammengesetzt?
Die Klasse besteht aus 26 Kindern mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Es wird ein positives Klassenklima, eine hohe Leistungsfähigkeit der Schüler und eine positive Einstellung gegenüber neuen Lehrkräften und Unterrichtsmethoden beschrieben.
Was ist die Sachanalyse?
Die Sachanalyse begründet das Thema der Unterrichtsstunde und erläutert die Funktion von Adjektiven und deren Rolle bei der Gestaltung von Spannung in Geschichten. Die Verfasserin beschreibt ihre Motivation für die Themenwahl und betont die Relevanz des Themas im Kontext des bestehenden Unterrichts.
Wie sieht die didaktische Analyse aus?
Die didaktische Analyse beschreibt das didaktische Vorgehen der Unterrichtsstunde. Der Ablauf umfasst die Betrachtung eines Bildes, das Vorlesen und Vergleichen von Textausschnitten mit unterschiedlichem Spannungsgrad und die schriftliche Festhaltung der Erkenntnisse. Die Schüler sollen lernen, spannungssteigernde Adjektive zu identifizieren und von anderen Adjektiven zu unterscheiden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Unterrichtsstunde?
Die Schlüsselwörter sind: Adjektive, Spannung, Geschichten schreiben, Gruselgeschichten, Didaktik, Grundschule, Deutschunterricht, Textanalyse, Spannungssteigerung.
Welche Kapitel sind im Dokument enthalten (Auszug)?
Der vorliegende Auszug enthält die Kapitel: Unmittelbare Lernvoraussetzungen, Sachanalyse und Didaktische Analyse. Weitere Kapitel wie Methodische Analyse, Einordnung der Stunde, Strukturskizze, Reflexion der Stunde, Quellenverzeichnis und Anhang fehlen in diesem Auszug.
- Quote paper
- Gesine Ueberfeldt (Author), 2013, Wie mache ich Geschichten spannender? Adjektive in Geschichten (Deutsch, 3. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308540