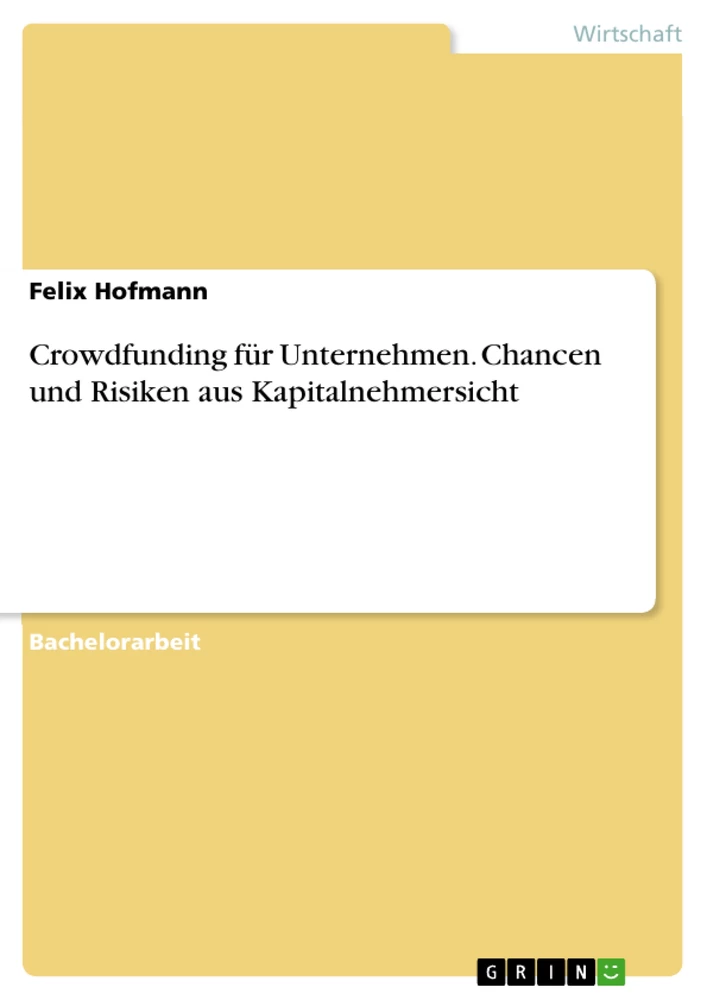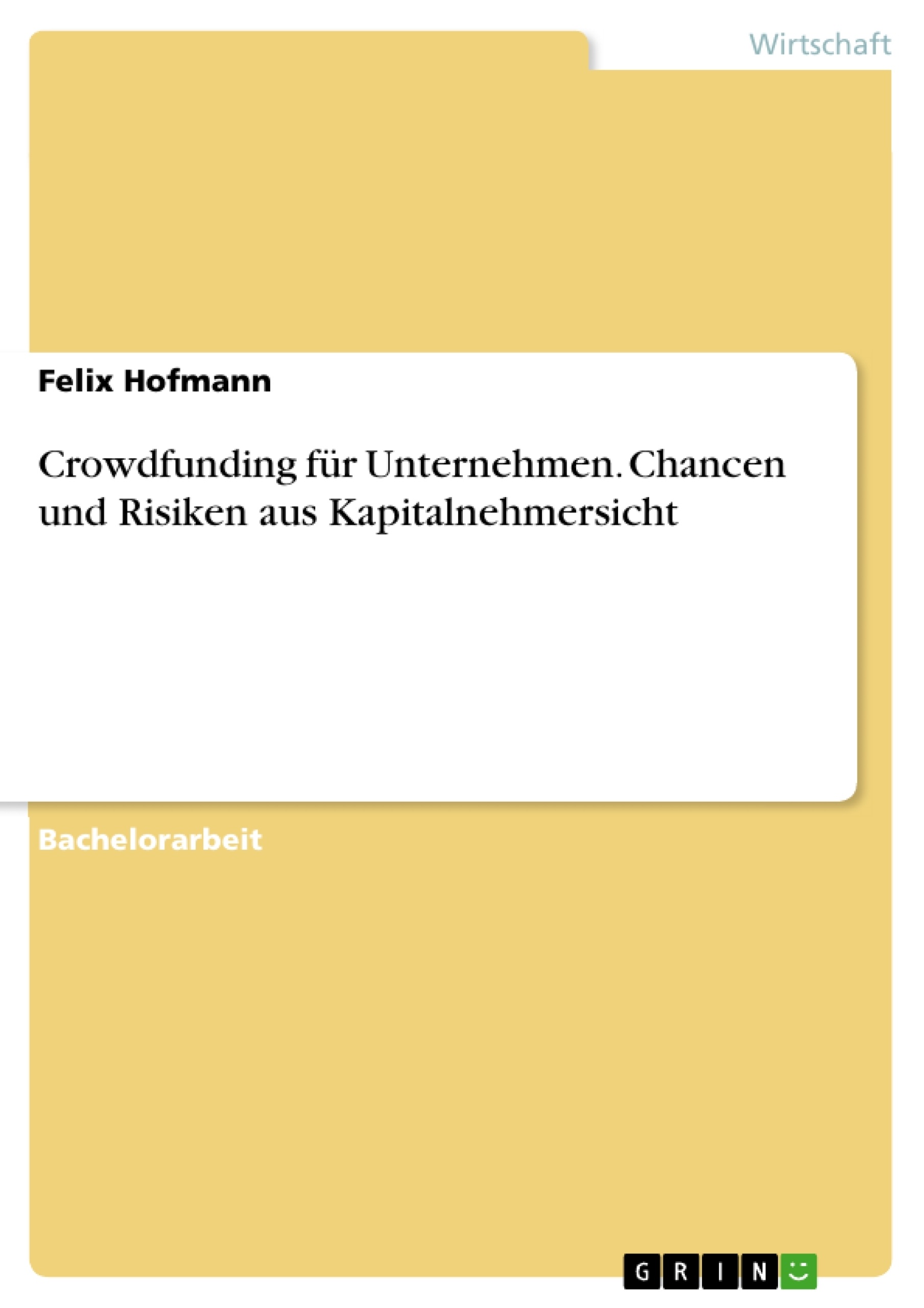Diese Arbeit analysiert die Chancen und Risiken von Crowdfunding für Unternehmen. Gerade in Zeiten wie den gegenwärtigen, mit historisch niedrigen Zinsen, suchen auch Privatpersonen nach Alternativen zum klassischen Sparbuch. Nicht zuletzt aus dem Grund, die anhaltend negativen Realzinsen auszugleichen. Durch das Crowdfunding ist es für Privatanleger möglich geworden, auch mit wenig Kapital am Erfolg eines Unternehmens partizipieren zu können. Für die Unternehmen hat sich damit eine neue Form der Finanzierung eröffnet, die das Potenzial hat, sich als Finanzierungsalternative zu etablieren. Fälle wie der S&K-Finanzskandal oder die Prokon-Insolvenz sorgten bundesweit für Aufsehen und riefen Verbraucherschützer auf den Plan. Der Gesetzgeber folgte dem dezidierten Aufruf nach Regulierung des sog. Grauen Kapitalmarktes. Mit dem geplanten Kleinanlegerschutzgesetz will man Verbraucher künftig besser vor undurchsichtigen und damit riskanten Investitionen schützen, die, im schlechtesten Fall, bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können.
Doch auch für die Unternehmen ergeben sich nicht nur Chancen, die über die reine Erhöhung des zur Verfügung stehenden Kapitals hinausreichen. Jedes Crowdfunding ist für die Beteiligten auch mit Risiken verbunden. In der Literatur herrscht nahezu ausnahmslos die anlegerorientierte Sichtweise vor, deren Schutz bisher meist im Mittelpunkt der Betrachtung stand. Eine Analyse der Chancen und Risiken, die sich für die kapitalsuchenden Unternehmen aus einem Crowdfunding ergeben können, fehlt bisher. Der Autor wird mit der vorliegenden Arbeit in einem ersten Ansatz versuchen, diese Lücke zu schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Herangehensweise
- Begriffsabgrenzungen und Arbeitsdefinitionen
- Crowdsourcing
- Crowdfunding
- Rahmenbedingungen für Crowdfunding
- Hauptakteure auf dem Crowdfunding-Markt
- Rechtliche Grundlagen
- Marktentwicklung
- Analyse der Chancen und Risiken aus Kapitalnehmersicht
- Chancen aus Kapitalnehmersicht
- Legitimation der Geschäftsidee und erfolgreicher Markteintritt
- Kundengewinnung und Produktinnovationen
- Erhöhung von Rentabilität und Liquidität
- Schließung von Finanzierungslücken
- Erhöhung des Umsatz-Kosten-Verhältnisses und der Bonität
- Erhöhung der finanzwirtschaftlichen Unabhängigkeit
- Risiken aus Kapitalnehmersicht
- Nichterreichen der Fundingschwelle
- Plattformbezogene Risiken
- Kostenentwicklung und Arbeitsaufwand
- Anschlussfinanzierung
- Prospektpflicht als rechtliches Risiko
- Widerrufsrecht der Anleger und unzureichender Urheberschutz
- Weitere rechtliche Risiken
- Bewertung der Analyseergebnisse
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassung und Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Chancen und Risiken von Crowdfunding aus der Perspektive des kapitalsuchenden Unternehmens. Sie schließt eine Forschungslücke, indem sie nicht nur die Anlegersicht, sondern auch die unternehmerische Perspektive in den Mittelpunkt stellt. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Vor- und Nachteile dieser Finanzierungsform für Unternehmen zu schaffen.
- Chancen von Crowdfunding für Unternehmen (z.B. Markteintritt, Kundengewinnung, Kapitalbeschaffung)
- Risiken von Crowdfunding für Unternehmen (z.B. rechtliche Aspekte, Plattformrisiken, Finanzierungslücken)
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Crowdfundings
- Marktentwicklung und Hauptakteure im Crowdfunding
- Bewertung der Chancen und Risiken im Kontext der Unternehmensfinanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung vor, indem sie den Gegensatz zwischen den Erfolgen innovativer Unternehmen und den eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten für junge Unternehmen hervorhebt. Sie führt Crowdfunding als neue Finanzierungsalternative ein und betont die Notwendigkeit einer unternehmerischen Perspektive auf die Chancen und Risiken dieser Methode, die bisher in der Literatur kaum Berücksichtigung gefunden hat. Die Arbeit will diese Lücke schließen.
Begriffsabgrenzungen und Arbeitsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Crowdsourcing und Crowdfunding, legt die Abgrenzungen zu anderen Finanzierungsformen fest und schafft somit eine klare Grundlage für die weitere Analyse. Es legt die methodischen und theoretischen Grundlagen der Arbeit fest und präzisiert die verwendete Terminologie, um Missverständnisse zu vermeiden und eine einheitliche Sprache zu gewährleisten.
Rahmenbedingungen für Crowdfunding: Dieses Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen des Crowdfundings. Es beschreibt die wichtigsten Akteure auf dem Markt, analysiert die relevanten rechtlichen Grundlagen und zeigt die Marktentwicklung auf. Die Analyse der Hauptakteure liefert Einblicke in die Struktur des Marktes, während die Betrachtung der rechtlichen Aspekte den rechtlichen Rahmen und die damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen verdeutlicht. Die Darstellung der Marktentwicklung gibt Aufschluss über das Wachstumspotenzial und die Dynamik des Crowdfunding-Marktes.
Analyse der Chancen und Risiken aus Kapitalnehmersicht: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und untersucht ausführlich die Chancen und Risiken von Crowdfunding für Unternehmen. Es werden sowohl die positiven Aspekte wie z.B. die Legitimation der Geschäftsidee, die Kundengewinnung, die Erhöhung der Rentabilität und Liquidität, als auch die Risiken, wie z.B. das Nichterreichen der Fundingschwelle, Plattformrisiken, rechtliche Herausforderungen und die Notwendigkeit einer Anschlussfinanzierung, detailliert analysiert. Die verschiedenen Unterkapitel liefern eine umfassende Risiko-Nutzen-Analyse und beleuchten die jeweiligen Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln.
Schlüsselwörter
Crowdfunding, Unternehmensfinanzierung, Chancen, Risiken, Kapitalnehmerperspektive, rechtliche Rahmenbedingungen, Marktentwicklung, Finanzierungsalternativen, Risiko-Nutzen-Analyse, Anleger, Start-ups, Innovation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Chancen und Risiken von Crowdfunding aus Kapitalnehmersicht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert umfassend die Chancen und Risiken von Crowdfunding aus der Perspektive des Unternehmens, das Kapital sucht. Sie konzentriert sich auf die unternehmerische Sichtweise und schließt damit eine Forschungslücke, da bisherige Arbeiten oft die Anlegersicht in den Vordergrund stellten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Chancen von Crowdfunding für Unternehmen (Markteintritt, Kundengewinnung, Kapitalbeschaffung), Risiken von Crowdfunding für Unternehmen (rechtliche Aspekte, Plattformrisiken, Finanzierungslücken), rechtliche Rahmenbedingungen, Marktentwicklung und Hauptakteure im Crowdfunding sowie eine Bewertung der Chancen und Risiken im Kontext der Unternehmensfinanzierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Begriffsabgrenzungen und Arbeitsdefinitionen (inkl. Crowdsourcing und Crowdfunding), Rahmenbedingungen für Crowdfunding (Hauptakteure, rechtliche Grundlagen, Marktentwicklung), eine detaillierte Analyse der Chancen und Risiken aus Kapitalnehmersicht und schließlich eine Schlussbetrachtung mit Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Chancen von Crowdfunding werden für Unternehmen betrachtet?
Die Arbeit untersucht Chancen wie Legitimation der Geschäftsidee und erfolgreichen Markteintritt, Kundengewinnung und Produktinnovationen, Erhöhung von Rentabilität und Liquidität, Schließung von Finanzierungslücken, Erhöhung des Umsatz-Kosten-Verhältnisses und der Bonität sowie Erhöhung der finanzwirtschaftlichen Unabhängigkeit.
Welche Risiken von Crowdfunding werden für Unternehmen betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet Risiken wie das Nichterreichen der Fundingschwelle, Plattformbezogene Risiken, Kostenentwicklung und Arbeitsaufwand, Probleme bei der Anschlussfinanzierung, die Prospektpflicht, das Widerrufsrecht der Anleger, unzureichenden Urheberschutz und weitere rechtliche Risiken.
Welche methodischen und theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Das Kapitel "Begriffsabgrenzungen und Arbeitsdefinitionen" legt die methodischen und theoretischen Grundlagen der Arbeit fest und präzisiert die verwendete Terminologie, um Missverständnisse zu vermeiden und eine einheitliche Sprache zu gewährleisten.
Wer sind die Hauptakteure im Crowdfunding-Markt?
Das Kapitel "Rahmenbedingungen für Crowdfunding" beschreibt die wichtigsten Akteure auf dem Crowdfunding-Markt, analysiert die relevanten rechtlichen Grundlagen und zeigt die Marktentwicklung auf.
Wie wird die Marktentwicklung des Crowdfundings dargestellt?
Die Darstellung der Marktentwicklung im Kapitel "Rahmenbedingungen für Crowdfunding" gibt Aufschluss über das Wachstumspotenzial und die Dynamik des Crowdfunding-Marktes.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Crowdfunding, Unternehmensfinanzierung, Chancen, Risiken, Kapitalnehmerperspektive, rechtliche Rahmenbedingungen, Marktentwicklung, Finanzierungsalternativen, Risiko-Nutzen-Analyse, Anleger, Start-ups, Innovation.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt eine Forschungslücke, indem sie die unternehmerische Perspektive auf die Chancen und Risiken von Crowdfunding in den Mittelpunkt stellt, ein Aspekt, der in der bisherigen Literatur nur unzureichend behandelt wurde.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Felix Hofmann (Author), 2014, Crowdfunding für Unternehmen. Chancen und Risiken aus Kapitalnehmersicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308820