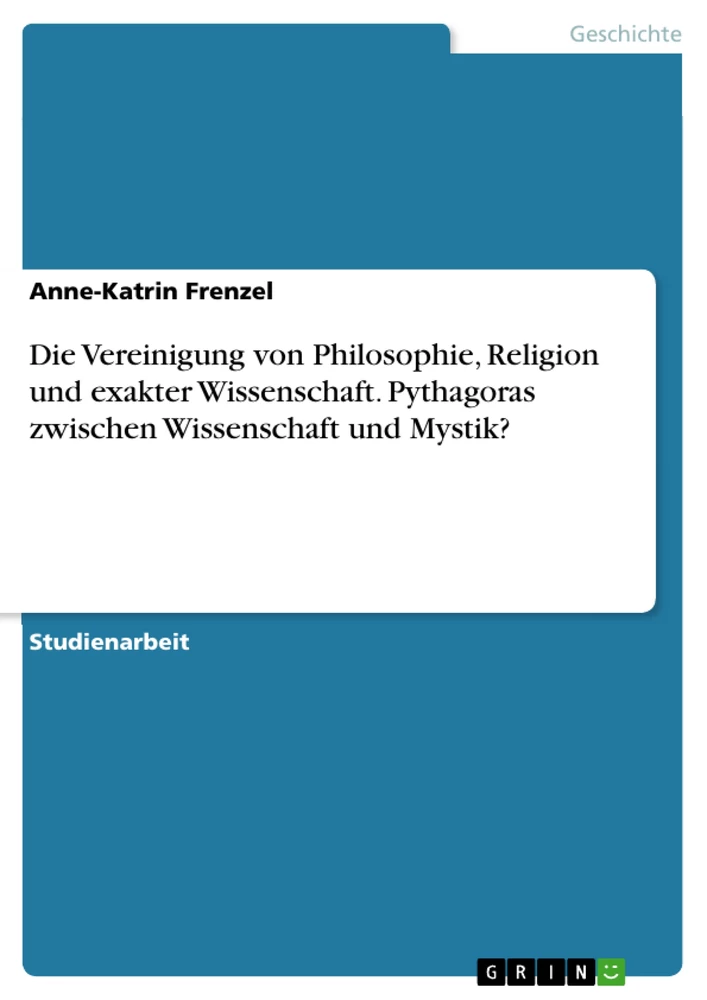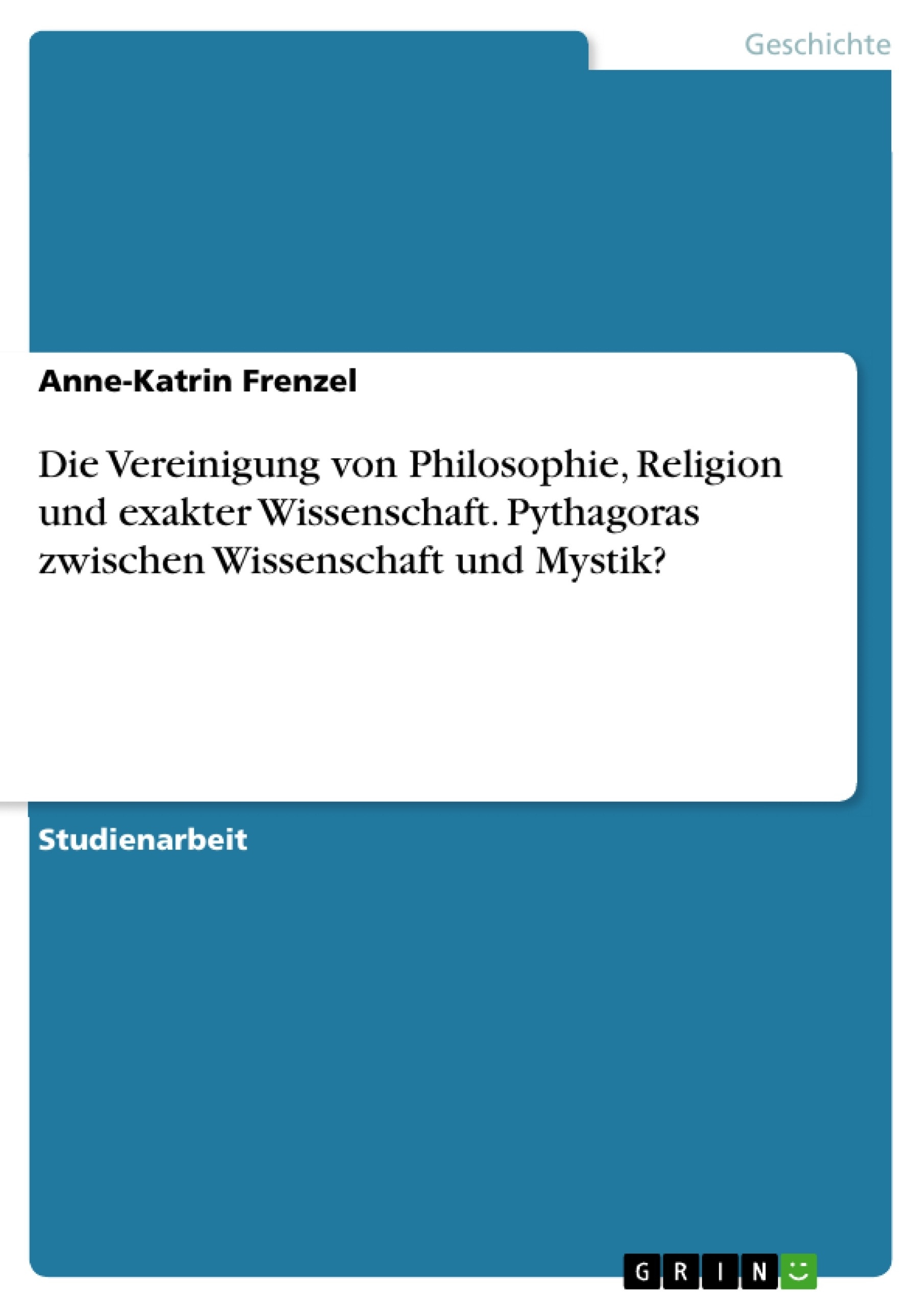Woraus legitimierte sich Pythagoras' Ansehen und wie erreichte er eine so enorme Anziehungskraft, dass er massenhaft Schüler und Gelehrte um sich versammelte, obwohl er bereits bei einigen Denkern seiner Zeit als Scharlatan und Pseudowissenschaftler verrufen wurde? Neben diesen Aspekten versucht diese Hausarbeit zu klären, wie Pythagoras es geschafft hat, Philosophie, Religion und zumindest im Ansatz exakte Wissenschaft zu vereinen.
Um auf diese Fragestellung eingehen zu können, ist es notwendig die Lehren des Pythagoras genauer zu beleuchten. Besonders die Lehre der Seelenwanderung und die Akusmata, welche das Leben im Pythagoreeischen Kult bestimmte, werden dabei die wichtigsten Inhalte, die zur Beantwortung der Fragen nötig sind. In dem Kapitel „Akusmata“ wird der Zusammenhang der Seelenlehre im Vordergrund stehen. Des weiteren sollen auch die Sichtweisen anderer Gelehrter und zeitlich nahestehenden Personen über Pythagoras und dessen Lehren an Hand verschiedener Quellen erläutert werden, damit die Gespaltenheit um seine Person verdeutlicht wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Seelenlehre des Pythagoras
- Quellenlage zu Pythagoras
- Seelenlehre
- Die gesellschaftliche Wirkungskraft und Darstellung des Pythagoras
- Der Kult um Pythagoras
- „Avtòç čqa“: Pythagoras und seine Anhänger
- Das Leben im pythagoreischen Kult: Die Akusmata
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Person des Pythagoras und seiner Lehren. Sie zielt darauf ab, ein umfassendes Bild des Pythagoreismus zu zeichnen, indem sie sowohl die wissenschaftlichen Aspekte seiner Lehre als auch den Einfluss des religiösen Kults auf seine Anhänger beleuchtet.
- Die Quellenlage zu Pythagoras und die Schwierigkeit, seine Person und Lehren von der Legende zu trennen
- Die Seelenlehre des Pythagoras und der Einfluss der Seelenwanderung auf seine Philosophie
- Die gesellschaftliche Wirkungskraft des Pythagoras und seine Rolle in der Entwicklung der Philosophie
- Der pythagoreische Kult und die Akusmata als Ausdruck der Lebensweise seiner Anhänger
- Die Auseinandersetzung mit dem Pythagoreismus in der Geschichte der Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik des Pythagoras und seiner Bedeutung als einflussreicher Vorsokratiker ein. Sie beleuchtet die Schwierigkeit, ihn historisch zu erfassen, da seine Lehren größtenteils aus mündlicher Überlieferung und Legenden stammen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Seelenlehre des Pythagoras. Die Quellenlage wird kritisch betrachtet und es werden die Kernpunkte seiner Lehre über die Seelenwanderung und die Unsterblichkeit der Seele erläutert.
Das dritte Kapitel analysiert die gesellschaftliche Wirkungskraft des Pythagoras und seinen Einfluss auf die Entwicklung der Philosophie. Die Positionierung des Pythagoras im Kontext der ionischen Naturphilosophie wird aufgezeigt.
Das vierte Kapitel untersucht den Kult um Pythagoras und das Leben in der pythagoreischen Bruderschaft. Die Akusmata, die Lebensregeln der Anhänger, werden in Bezug auf die Seelenlehre erklärt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Pythagoras, Pythagoreismus, Seelenwanderung, Akusmata, Vorsokratiker, Philosophie, Religion, Wissenschaft, Quellenlage, Kult, Geschichte der Philosophie, Antike.
Häufig gestellte Fragen
War Pythagoras ein Wissenschaftler oder ein Mystiker?
Die Arbeit zeigt, dass Pythagoras beides vereinte: Er legte Grundlagen für exakte Wissenschaften (Mathematik), führte aber gleichzeitig einen religiösen Kult an.
Was besagt die Lehre der Seelenwanderung?
Pythagoras lehrte, dass die Seele unsterblich ist und nach dem Tod in andere Körper (Menschen oder Tiere) wiedergeboren wird.
Was sind die „Akusmata“?
Es handelt sich um mündlich überlieferte Lebensregeln und Sprüche, die den Alltag und die moralische Lebensweise im pythagoreischen Kult bestimmten.
Warum war Pythagoras schon zu seiner Zeit umstritten?
Einige Denker sahen in ihm einen Scharlatan, da seine enorme Anziehungskraft und sein Kultstatus oft die Grenzen zwischen Wissen und Mythos verwischten.
Was bedeutet der Ausspruch „Autos epha“?
Es bedeutet „Er selbst hat es gesagt“ und verdeutlicht die unantastbare Autorität, die Pythagoras innerhalb seiner Anhängerschaft genoss.
- Quote paper
- Anne-Katrin Frenzel (Author), 2010, Die Vereinigung von Philosophie, Religion und exakter Wissenschaft. Pythagoras zwischen Wissenschaft und Mystik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308914