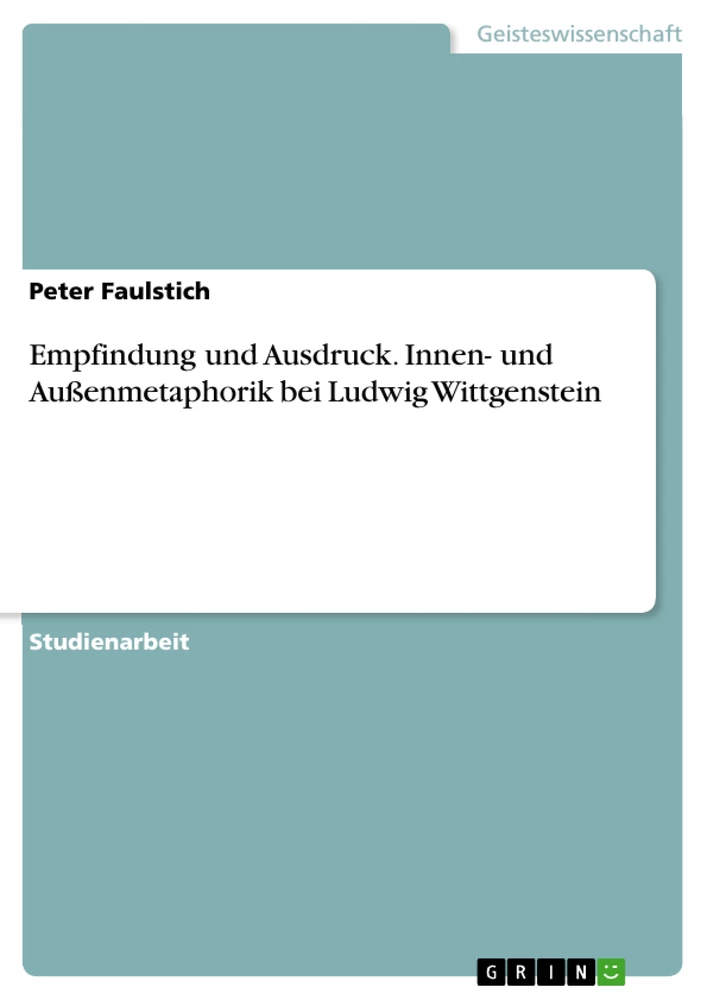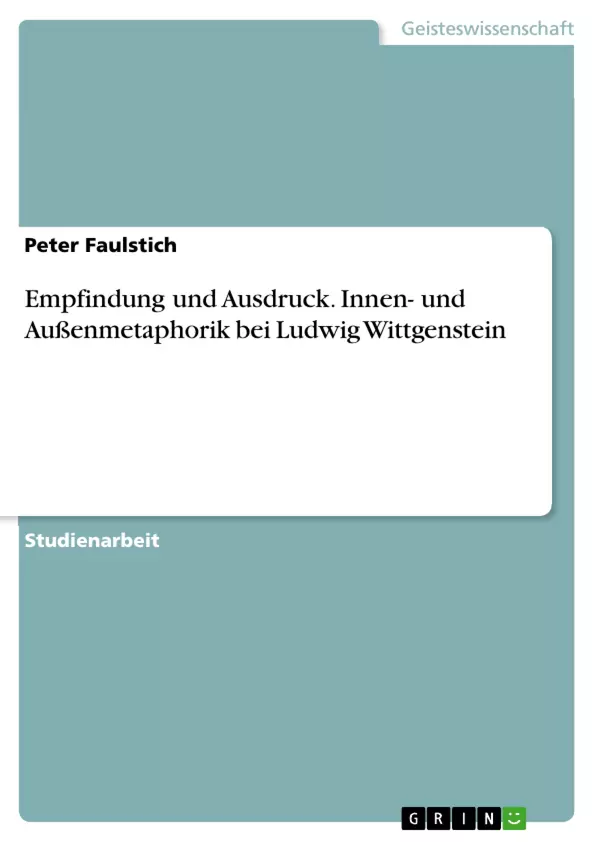Beginnen möchte ich mit kurzen Erläuterungen zu Wittgensteins Methode und Verständnis von philosophischen Problemen sowie dem wichtigen „Gegenstand“ des Privatsprachenarguments, nämlich dem inneren Zustand. Daran anschließend die Frage, was das Innere nach Wittgenstein ist und in welchem Verhältnis es zum Äußeren steht. Nachdem der sprachphilosophische Ansatz Wittgensteins skizziert wurde, sollen kurz mögliche Einwände desselben angedeutet werden. II. Methode und Gegenstand.
Theorien, was denn die Seele oder das Innere sei, gibt es zahlreiche, von der antiken Philosophie angefangen, über Descartes bis hin zur Psychologie des 20. Jahrhunderts. Ihnen allen ist eines gemeinsam, sie beschreiben ihre Gegenstände der Untersuchung, innere Zustände, mit einer Sprache, die unabhängig von dem beschriebenen Gegenstand etwas zum Ausdruck bringen soll, nämlich was der zu untersuchende Gegenstand ist. Demzufolge steht auf der einen Seite die Sprache mit ihren Begriffen und Bezeichnungen, derer wir uns bei der Beschreibung des Objekts der Untersuchung und Formulierung einer Theorie bedienen und auf der anderen Seite steht der Gegenstand, der bezeichnet wird. Beide Seiten, Sprache und Bezeichnetes, werden so behandelt, als seien diese unabhängig voneinander, so als würde man den Gegenständen eine Namenstafel umhängen und dadurch erst eine Beziehung von Sprache und Gegenstand herstellen.
Was wäre aber, wenn wir in die zu untersuchenden Objekte durch die Sprache erst das hineinlegen, was wir eigentlich untersuchen wollen? Wie wäre es, wenn wir durch unsere Sprache „Gegenstände“ erzeugen, zu denen wir nur durch sie gelangt sind? Von welcher Art wären dann diese „Gegenstände“? Legen wir uns nicht mit einem bestimmten Blickwinkel durch die damit verbundenen Voraussetzungen bereits vor der Untersuchung fest, was schließlich heraus kommen soll? Solche, oder so ähnliche Fragen könnten Ludwig Wittgenstein geplagt haben und ihn dazu gebracht haben, es einmal anders zu versuchen a n philosophische Probleme heranzutreten. Eine bekannte Metapher, die seine Auffassung und Herangehensweise an philosophische Problemen wiedergibt, findet sich in den PU, die „Fliegenglas“ Metapher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methode und Gegenstand
- Ausdruck des Inneren
- Was ist das Innere?
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der Empfindung und des Ausdrucks, insbesondere mit dem Verhältnis von „Innen“ und „Außen“ in Bezug auf die Metaphorik bei Ludwig Wittgenstein. Sie analysiert Wittgensteins Kritik am Konzept der „privaten Sprache“ und untersucht die Rolle des sprachlichen Ausdrucks in der Beschreibung und dem Verständnis von inneren Zuständen.
- Wittgensteins Kritik am Konzept der „privaten Sprache“
- Das Verhältnis von Empfindung und Benehmen
- Die Bedeutung von Sprache für das Verständnis des „Inneren“
- Die Rolle der Metaphorik im Kontext des „Inneren“ und „Äußeren“
- Die Frage, ob wir durch unsere Sprache „Gegenstände“ erzeugen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Themengebiet „Empfindung und Ausdruck, Innen und Außen Metaphorik“ vor und begrenzt den Fokus auf den ersten Teil der Philosophischen Untersuchungen (PU), insbesondere die Paragraphen §§ 304-315. Es werden die wichtigsten Primärtexte Wittgensteins genannt, die in der Arbeit verwendet werden.
- Methode und Gegenstand: Dieses Kapitel analysiert Wittgensteins methodischen Ansatz in der Philosophie und behandelt die Frage, wie Sprache zur Beschreibung und zum Verständnis von „inneren Zuständen“ verwendet werden kann. Es wird die „Fliegenglas“ Metapher eingeführt, um Wittgensteins Auffassung von philosophischen Problemen zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die zentralen Themen der „Philosophischen Untersuchungen“ von Ludwig Wittgenstein, insbesondere auf das „Privatsprachenargument“ und die damit verbundenen Fragestellungen. Zu den Schlüsselbegriffen zählen: „Empfindung und Ausdruck“, „Innen und Außen“, „Sprache und Bedeutung“, „Metaphorik“, „private Sprache“, „innere Zustände“ und „Wittgensteins Gebrauchstheorie der Sprache“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Privatsprachenargument bei Wittgenstein?
Wittgenstein argumentiert, dass eine Sprache, die sich nur auf innere Empfindungen bezieht und nur vom Sprecher selbst verstanden werden kann, unmöglich ist, da Sprache soziale Regeln und Kriterien zur korrekten Verwendung benötigt.
Was besagt die „Fliegenglas“-Metapher?
Die Metapher beschreibt das Ziel der Philosophie: „Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“ Sie verdeutlicht, dass philosophische Probleme oft sprachliche Verwirrungen sind, aus denen man sich befreien muss.
Wie stehen „Innen“ und „Außen“ bei Wittgenstein im Verhältnis?
Für Wittgenstein ist das „Innere“ (Empfindungen) nicht unabhängig vom „Äußeren“ (Benehmen, Ausdruck). Wir lernen Begriffe für Gefühle erst durch die Beobachtung von Reaktionen in der sozialen Welt.
Erzeugen wir durch unsere Sprache „Gegenstände“?
Wittgenstein regt zum Nachdenken darüber an, ob wir durch die Art, wie wir über das „Innere“ sprechen, erst die Vorstellung von eigenständigen Objekten in unserem Kopf kreieren, die es so vielleicht gar nicht gibt.
Was ist Wittgensteins Gebrauchstheorie der Sprache?
Sie besagt, dass die Bedeutung eines Wortes nicht in einem Gegenstand liegt, den es bezeichnet, sondern in seinem Gebrauch innerhalb einer Lebensform oder eines Sprachspiels.
- Arbeit zitieren
- Peter Faulstich (Autor:in), 2004, Empfindung und Ausdruck. Innen- und Außenmetaphorik bei Ludwig Wittgenstein, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30897