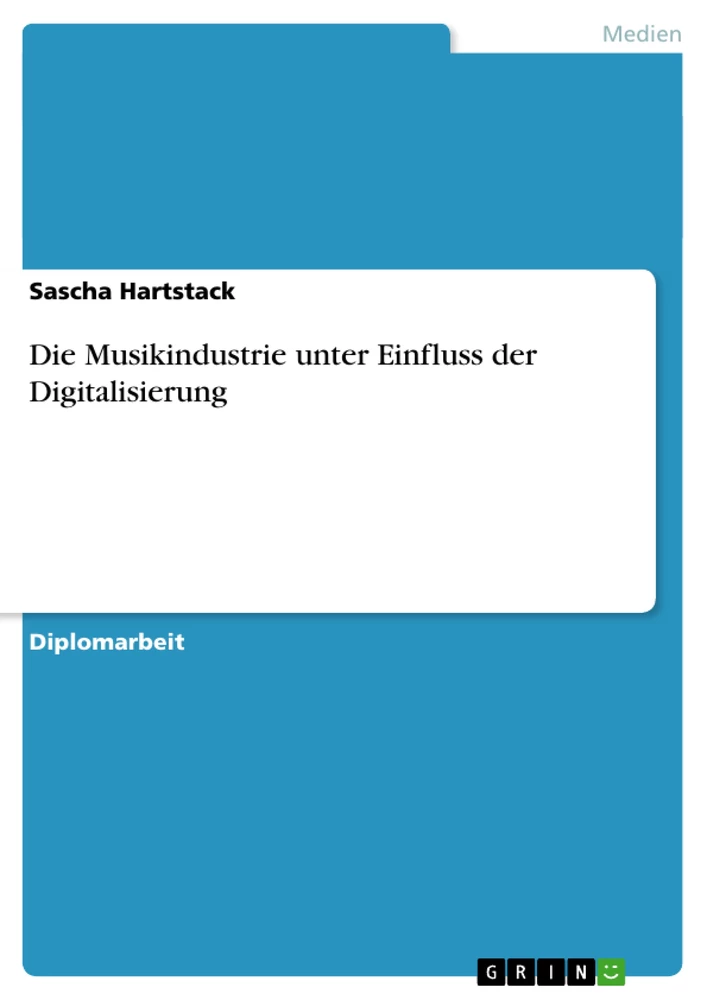Musik [gr.], bei den Griechen zunächst die Bildung von Gemüt u. Geist (im Ggs. Zur Gymnastik); erst nach der klass. Zeit die Tonkunst als Ausdrucksmittel des menschl. Seelen- u. Gefühlslebens. Gestaltungsmerkmale der M. sind Rhythmus, Melodie, Harmonie, ferner Tonstärken- u. Zeitmaßverhältnisse sowie die Instrumentation. Nach den Darstellungsmitteln teilt man die M. ein in Gesang (Vokal-M.) u. Instrumental-M. Werden viele versch. M.-Instrumente verwendet, spricht man von Orchester-M., kommen einige wenige Instrumente zum Einsatz, von Kammer-M. Man unterscheidet ferne u.a. Volks-M., Kunst-M., Kirchen-., Unterhaltungs-M., Tanz-M., Jazz-M. M. in Verbindung mit Darstellungen auf der Bühne: Oper , Operette, Musical, Singspiel.
Nach antikem Mythos ist die Musik ein Geschenk Apolls und der Musen an den Menschen. Gesellschaften und Kulturen besitzen ihre eigene Musik, aber nur in wenigen Sprachen gibt es ein eigenes Wort dafür, weil die Musik meist in Zusammenhang mit Tanz, Sprache und Kult steht. In der griechischen Antike bezeichnete der Begriff musiké die Einheit von Poesie, Tanz und Musik. Musik war und ist für alle Gesellschaften und zu allen Zeiten von Bedeutung. Sie besteht in einer Vielfalt von Stilen, die jeweils charakteristisch beispielsweise für eine geographische Region, eine geschichtliche Epoche oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen sind. Musik ist eine zentrale Kategorie, die aus dem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Musik ist nicht zuletzt durch ihre massenmediale Verbreitung in der heutigen Zeit ein allgegenwärtiges ästhetisches Phänomen. Mit dieser Allgegenwärtigkeit hat sich aber zugleich das Verhältnis zur Musik dramatisch gewandelt. War man in früheren Zeiten, etwa im 17. oder 18. Jahrhundert, daran interessiert, Musik zu genießen, war man darauf angewiesen, einen Musiker einzuladen, oder man musste selber musizieren. Das damalige Massenmedium für Musik war die „stille Form der Musik“ in Form von gedruckten Noten. Diese konnte man aktiv in erklingende Musik umwandeln oder man begab sich dort hin, wo Musik gemacht wurde. Zu dieser Zeit war „Musik erleben“ fast immer ein interpersonales Ereignis. Heute ist die fast allgegenwärtige, massenmedial verbreitete Form der Musik in ihrer akustischen Originalform oft allenfalls ein aurales Genussmittel oder akustisches Ambiente, das möglicherweise beschwingt und die Sinne mehr oder weniger zielgerichtet anregt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlegung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Begriffskennzeichnung
- 1.3.1 Musikindustrie
- 1.3.2 Digitalisierung
- 1.4 Anmerkungen zur Datengrundlage und Terminologie
- 2 Die Musikindustrie
- 2.1 Die Struktur der Musikindustrie
- 2.2 Akteure der Musikindustrie
- 2.2.1 Künstler
- 2.2.2 Plattenfirmen
- 2.2.3 Tonträgerhersteller
- 2.2.4 Musikverlag
- 2.2.5 Verwertungsgesellschaften
- 2.2.5.1 GEMA
- 2.2.5.2 GVL
- 2.3 Der Tonträgerhandel
- 2.4 Vertriebsstrukturen
- 2.4.1 Vertriebe
- 2.4.2 Systemgroßhandel, Rackjobber
- 2.4.3 Zentral operierende Handelsketten
- 2.4.4 Dezentral organisierte Einzelhändler
- 2.4.5 Versand, Internet
- 2.3.6 Sonstige
- 2.3.7 Alternative Vertriebswege
- 2.5 Umsatz- und Absatzentwicklung des Tonträgermarktes
- 2.5.1 Umsatzentwicklung
- 2.5.2 Tonträgerabsatz
- 2.5.3 Käuferreichweite und Käuferintensität
- 2.5.4 Internationale Umsatz- und Absatzentwicklung
- 3 Wandel der Musikindustrie
- 3.1 Der „Siegeszug“ von mp3
- 3.1.1 Entwicklung des Dateiformats mp3
- 3.1.2 Die ersten Musikdownloads
- 3.2 Tonträger-Piraterie
- 3.2.1 Arten der traditionellen Tonträgerpiraterie
- 3.2.1.1 Bootleg
- 3.2.1.2 Raubkopien
- 3.2.1.2.1 Die (klassische) Raubkopie
- 3.2.1.2.2 Die Raubkopplung
- 3.2.1.2.3 Der Raub-Mix
- 3.2.1.3 Die Identfälschung (Counterfeit)
- 3.2.2 Neue Formen der Tonträgerpiraterie
- 3.2.2.1 Online-Piraterie
- 3.2.2.1.1 http-Angebote
- 3.2.2.1.2 ftp-Angebote
- 3.2.2.1.3 Filesharing
- 3.2.2.2 Schulhofpiraterie
- 3.2.3 Umsatzverluste durch Onlinepiraterie und private Vervielfältigung
- 3.3 Napster als Synonym für das Zeitalter der Tauschbörsen
- 3.4 Gegenstrategien der Musikindustrie
- 3.4.1 Vorgehen gegen Betreiber von Musik-Tauschbörsen
- 3.4.1.1 Rechtliche Schritte gegen zentral organisierte Tauschbörsen
- 3.4.1.2 Rechtliche Schritte gegen dezentrale Netzwerke
- 3.4.2 Maßnahmen zur Eindämmung der Nutzerzahlen von Tauschbörsen
- 3.4.2.1 Vorgehen gegen Hochschulen und Unternehmen
- 3.4.2.2 Vorgehen gegen einzelne Nutzer
- 3.4.2.3 Sabotageaktionen
- 3.4.3 Angebote der Musikindustrie
- 4 Chancen für die Musikindustrie durch Digitalisierung
- 4.1 Digitalisierung des Vertriebs von Tonträgern
- 4.1.1 Vorteile
- 4.1.2 Akteure
- 4.1.3 Auswirkungen
- 4.2 Nutzen von Konvergenztechnologien
- 4.2.1 Einsatz in der Musikindustrie
- 4.2.2 Herausforderungen an die Musikindustrie
- 4.2.3 Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette
- 4.2.4 Anpassungsstrategien der Musikindustrie
- 4.2.4.1 Ausrichtung auf den Kunden
- 4.2.4.1.1 Verbesserung des Leistungsangebotes
- 4.2.4.1.2 Konvergente Portale
- 4.2.4.2 Denken in Wertschöpfungsnetzwerken
- 4.3 Digital Rights Management
- 4.3.1 Funktionsweise von DRM
- 4.3.1.1 Schutz durch Kryptographie
- 4.3.1.2 Schutz durch Wasserzeichen
- 4.3.2 Herausforderungen an ein DRM-System
- 5 Schlussbetrachtung
- Die Entwicklung und Auswirkungen digitaler Musikformate auf die Musikindustrie
- Die Herausforderungen der Tonträgerpiraterie und Online-Piraterie für die Musikindustrie
- Die Gegenstrategien der Musikindustrie zur Eindämmung von Piraterie und Filesharing
- Die Chancen der Digitalisierung für den Vertrieb und die Vermarktung von Musik
- Die Rolle von Digital Rights Management (DRM) im digitalen Musikmarkt
- Kapitel 1: Grundlegung: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Arbeit. Es beinhaltet eine Einleitung, die den Aufbau der Arbeit und die Relevanz des Themas darlegt. Zudem werden die Begriffe "Musikindustrie" und "Digitalisierung" definiert und die verwendeten Datenquellen und Terminologien erläutert.
- Kapitel 2: Die Musikindustrie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Struktur und den Akteuren der Musikindustrie. Es analysiert den Tonträgerhandel, die Vertriebsstrukturen und die Umsatz- und Absatzentwicklung des Tonträgermarktes.
- Kapitel 3: Wandel der Musikindustrie: Dieses Kapitel beleuchtet die Veränderungen, die sich durch die Verbreitung des MP3-Formats und die Entwicklung von Filesharing-Plattformen ergeben haben. Es analysiert die Tonträger-Piraterie und die Gegenstrategien der Musikindustrie.
- Kapitel 4: Chancen für die Musikindustrie durch Digitalisierung: Dieses Kapitel untersucht die Chancen, die sich durch die Digitalisierung für die Musikindustrie ergeben. Es beleuchtet die Digitalisierung des Vertriebs von Tonträgern, die Nutzung von Konvergenztechnologien und die Rolle von Digital Rights Management (DRM).
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Musikindustrie. Der Fokus liegt dabei auf den Veränderungen, die sich durch die Verbreitung digitaler Musikformate wie MP3 und die damit verbundene Entwicklung von Filesharing-Plattformen ergeben haben. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die sich für die Musikindustrie aus diesen Entwicklungen ergeben, und beleuchtet gleichzeitig die Chancen, die die Digitalisierung für die Branche bietet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Musikindustrie, Digitalisierung, MP3, Filesharing, Online-Piraterie, Tonträgerpiraterie, Digital Rights Management (DRM), Konvergenztechnologien, Vertrieb, Vermarktung, Musikdownloads, Tauschbörsen.
- Arbeit zitieren
- Sascha Hartstack (Autor:in), 2004, Die Musikindustrie unter Einfluss der Digitalisierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30914