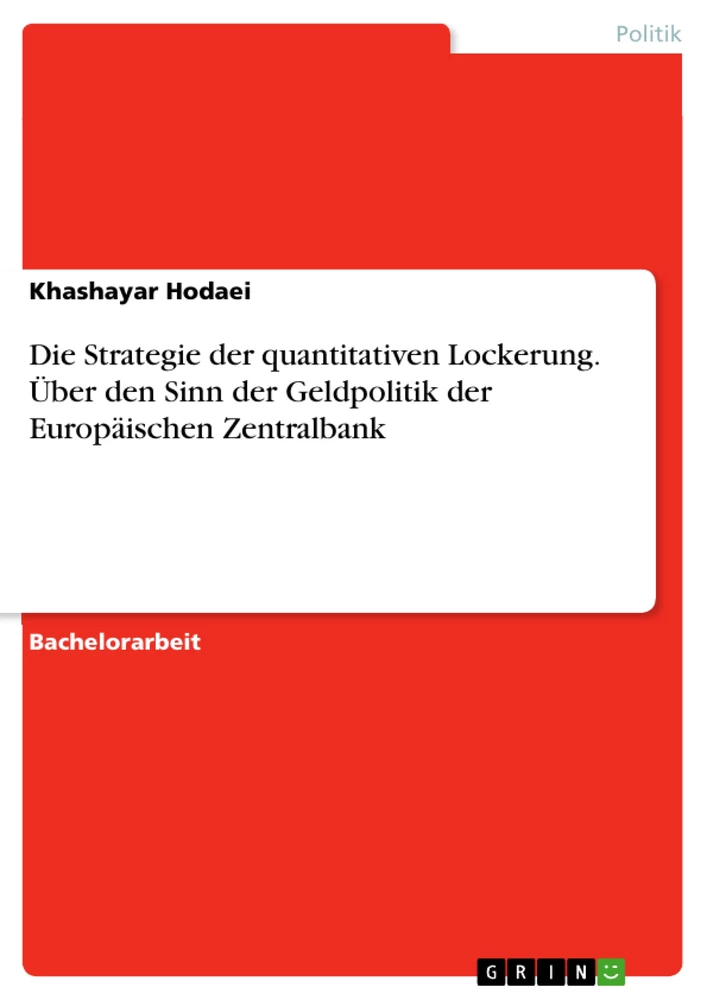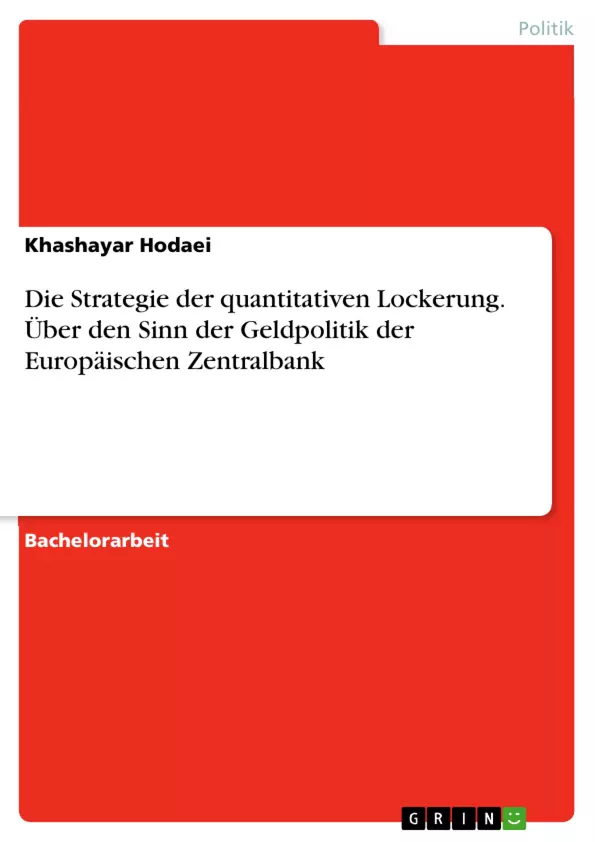Die Notenbanken der Industrieländer haben es seit dem Sommer 2007 mit geldpolitischen Problemstellungen zu tun, mit denen sie und ein Großteil der Finanzexperten nicht gerechnet hatten. Im Verlauf der Finanz- und Schuldenkrise zeigte sich, dass sich das primäre geldpolitische Ziel der Preisstabilität nicht mehr wirksam alleine durch Variationen konventioneller Geldpolitik erreichen lässt. Anpassungen des Leitzinses, der kurzfristigen Bankenliquidität, der Mindestreserven und der Wechselkurse haben sich in einer Situation von Inflationsraten nahe der Nullzins-Grenze als unzureichend herausgestellt.
In dieser Situation beschloss der EZB-Rat im Rahmen einer quantitativen Lockerung ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten ab März 2015 bis mindestens September 2016 im Gesamtvolumen von 1140 Mrd. Euro zu starten. Die Absicht hinter dem Ankaufprogramm für Vermögenswerte bestand darin, monetäre Anreize für die Wirtschaft in einem Umfeld, in dem die Leitzinsen der EZB ihre Untergrenze erreicht hatten, zu schaffen.
Spätestens nach Bekanntgabe im Januar 2015, dass die EZB im Rahmen des erweiterten Ankaufprogramms für Vermögenswerte Staatsanleihenkäufe plant, verschärfte sich die ohnehin schon heftige Kritik an den unkonventionellen Maßnahmen der EZB. Die heftigen Kontroversen verdeutlichen einerseits die Fortsetzung der überwiegend negativen Bewertung der EZB-Geldpolitik und andererseits, wie unterschiedlich die Argumente teilweise sind.
Doch manche dieser Kritikpunkte erweisen sich bei genauerer Betrachtung in sich widersprüchlich und unlogisch. Der Versuch, zu erklären, worin die Widersprüche in den kritischen Argumenten verborgen sind, ist das Ziel dieser Arbeit. Die Fragestellung, ob der Strategiewechsel der EZB hin zu einer expliziten Geldpolitik der quantitativen Lockerung sinnvoll war, soll dabei helfen. Das zweite Kapitel folgt einem deskriptiven Ansatz, in dem zunächst der Unterschied zwischen konventionellen und unkonventionellen Maßnahmen der Geldpolitik aufgezeigt wird. Das dritte Kapitel behandelt die Auseinandersetzung mit den Kritikpunkten der vermeintlichen Gegner der EZB-Geldpolitik. Die Kriterien, nach denen die Frage nach der Sinnhaftigkeit der geldpolitischen Entscheidung der EZB beantwortet werden kann, ergeben sich meines Erachtens aus der Analyse der vorgebrachten Argumente. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen eine abschließende Einschätzung über die Sinnhaftigkeit der geldpolitischen Entscheidung der EZB.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Quantitative Lockerung
- 2.1. Konventionelle Geldpolitik und ihre Grenzen
- 2.2. Unkonventionelle Geldpolitik
- 2.3. Internationale Anwendungsbeispiele expansiver Geldpolitik
- Bank of Japan (BoJ)
- Federal Reserve System (FED)
- Bank of England (BoE)
- 2.4. Erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten
- Geldpolitische Einordnung
- Kritik an der geldpolitischen Maßnahme der EZB
- 3. Untersuchung der kritischen Argumente
- 3.1. Die drohende Deflation
- 3.2. Das ungeeignete Instrument
- 3.3. Blasenbildung und Moral Hazard Verhalten
- 4. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Sinnhaftigkeit der quantitativen Lockerung, einer geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Arbeit analysiert die konventionellen und unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen im Kontext der Finanz- und Schuldenkrise und bewertet die Kritik an der EZB's Vorgehensweise.
- Konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik
- Die Grenzen konventioneller Geldpolitik im Kontext der Finanzkrise
- Internationale Beispiele expansiver Geldpolitik
- Kritik an der quantitativen Lockerung der EZB
- Bewertung der Wirksamkeit der quantitativen Lockerung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die geldpolitischen Herausforderungen ein, mit denen Industrieländer seit 2007 konfrontiert sind. Sie beschreibt das Versagen konventioneller Maßnahmen angesichts von Inflationsraten nahe der Nullzinsgrenze und den Wunsch nach Schuldenabbau bei Haushalten, Banken und Finanzministern. Der Fokus liegt auf der Entscheidung der EZB, ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Rahmen der quantitativen Lockerung zu starten und der darauf folgenden Kritik an den unkonventionellen Maßnahmen.
2. Quantitative Lockerung: Dieses Kapitel beleuchtet die konventionelle Geldpolitik und ihre Grenzen im Kontext der Finanzkrise. Es beschreibt unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen und analysiert internationale Beispiele wie die Vorgehensweisen der Bank of Japan (BoJ), des Federal Reserve System (FED) und der Bank of England (BoE). Der Schwerpunkt liegt auf dem erweiterten Programm der EZB zum Ankauf von Vermögenswerten, seiner geldpolitischen Einordnung und der Kritik an dieser Maßnahme.
3. Untersuchung der kritischen Argumente: Dieses Kapitel analysiert die Kritikpunkte an der quantitativen Lockerung. Es untersucht die Argumente der drohenden Deflation, der Ungeeignetheit des Instruments und der Gefahr von Blasenbildung und Moral Hazard. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den ökonomischen und politischen Implikationen der einzelnen Kritikpunkte wird vorgenommen.
Schlüsselwörter
Quantitative Lockerung, Europäische Zentralbank (EZB), Konventionelle Geldpolitik, Unkonventionelle Geldpolitik, Deflation, Preisstabilität, Finanzkrise, Nullzinsgrenze, Moral Hazard, Blasenbildung, Internationale Anwendungsbeispiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Quantitative Lockerung der EZB
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit der quantitativen Lockerung (QE) als geldpolitische Maßnahme der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kontext der Finanz- und Schuldenkrise. Sie analysiert die Kritik an diesem Vorgehen und bewertet dessen Wirksamkeit.
Welche Aspekte der quantitativen Lockerung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik, die Grenzen konventioneller Maßnahmen in der Finanzkrise, internationale Beispiele expansiver Geldpolitik (BoJ, FED, BoE), die Kritik an der EZB's QE und eine Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die geldpolitischen Herausforderungen seit 2007, das Versagen konventioneller Maßnahmen und die Kritik an der EZB's QE. Kapitel 2 (Quantitative Lockerung): Konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik, internationale Beispiele und detaillierte Analyse der EZB's QE-Programm inklusive Kritikpunkte. Kapitel 3 (Untersuchung der kritischen Argumente): Detaillierte Analyse der Kritik an der QE, einschließlich der Argumente der drohenden Deflation, der Ungeeignetheit des Instruments und der Gefahr von Blasenbildung und Moral Hazard. Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Quantitative Lockerung, Europäische Zentralbank (EZB), Konventionelle Geldpolitik, Unkonventionelle Geldpolitik, Deflation, Preisstabilität, Finanzkrise, Nullzinsgrenze, Moral Hazard, Blasenbildung, Internationale Anwendungsbeispiele.
Welche internationalen Beispiele für expansive Geldpolitik werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Vorgehensweisen der Bank of Japan (BoJ), des Federal Reserve System (FED) und der Bank of England (BoE).
Welche Kritikpunkte an der quantitativen Lockerung der EZB werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Kritikpunkte der drohenden Deflation, der Ungeeignetheit des Instruments als Reaktion auf die Krise und die Gefahr von Blasenbildung und Moral Hazard Verhalten.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis befindet sich im Anfangsteil der Arbeit und beinhaltet neben der Einleitung und dem Fazit auch ein Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis und ein Literaturverzeichnis.
- Quote paper
- Khashayar Hodaei (Author), 2015, Die Strategie der quantitativen Lockerung. Über den Sinn der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309158