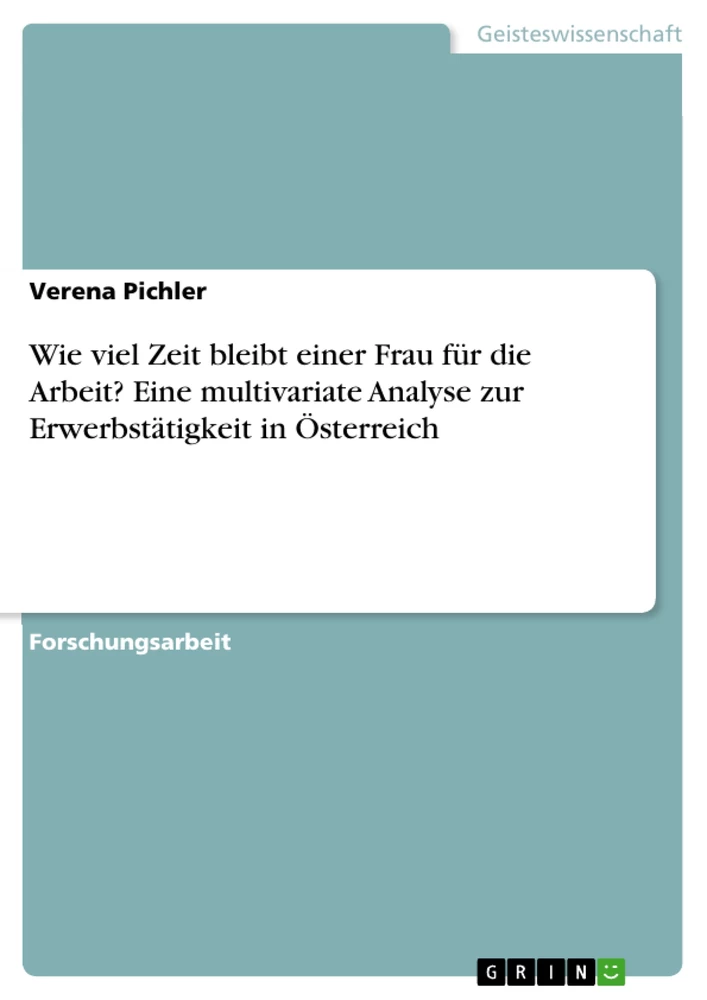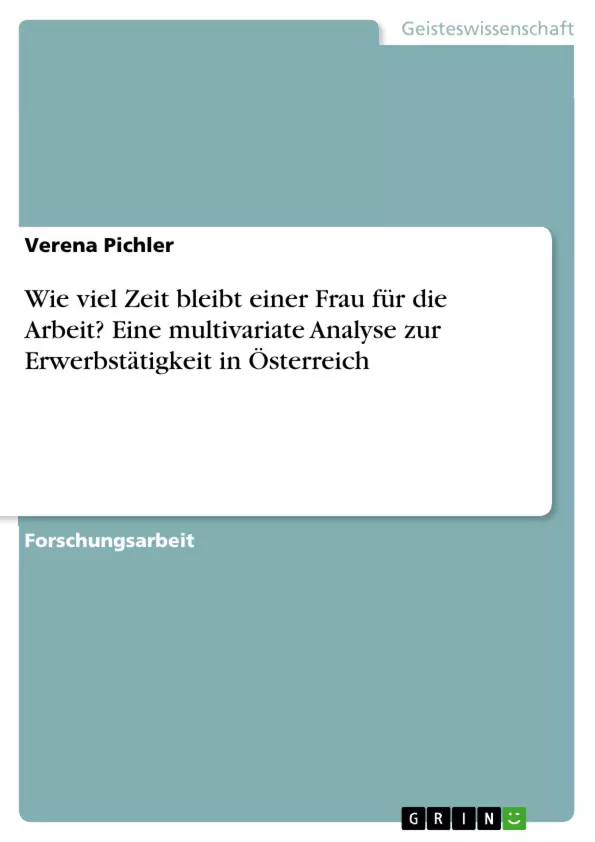Seit der Jäger und Sammlergesellschaft hat sich viel verändert. Die Arbeit und das „Geld verdienen“ unterliegt einem ständigen Wandel. Vor der Industrialisierung war es üblich, dass die Frau sich zuhause um die Kinder kümmerte und der Mann Erwerbstätig war und das Geld verdiente. Unentgeltlich arbeiteten die Frauen zuhause und kümmerten sich um das Wohl der Familie. Da der Mann für seine Tätigkeit jedoch belohnt wurde (in Form eines Gehalts), nahm seine Arbeit einen höheren Stellenwert an, als die der Frau.
Lange Zeit war es selbstverständlich für eine Frau nicht für ihre Arbeit entlohnt zu werden und sich den Gesellschaftlichen Normen, Pflichten und Werten zu fügen. Einige Ausnahmen gibt es hier jedoch auch, wie Anne McClintock unter Beweis stellt mit der Geschichte von Hannah Cullwick. Denn obwohl es zu dieser Zeit, wie bereits erwähnt üblich war, dass die Frau Zuhause bleibt, wollte Hannah Cullwick sich von ihrem Mann für ihre Arbeit entlohnen lassen, und ging später selber einem Beruf nach.
Dies stellt jedoch eine Ausnahme dar. Während die Entwicklung der Männer eher linear war, denn Frauen mussten sich mehr „erkämpfen“. Es dauerte sehr lange bis es Frauen möglich war, denselben Berufen nachzugehen wie Männer. Auch wenn Männer in Österreich heutzutage im Durschnitt für dieselbe Arbeit 21% mehr Lohn erhalten als Frauen (Bundeskanzleramt), sind Frauen was das „Recht auf Arbeit“ angeht, mit den Männern gleichgesetzt. Des Weiteren, haben Frauen mit der Doppelbelastung Haushalt vs. Arbeit zu kämpfen, daher stellt sich die Frage: Wie viel Zeit bleibt einer Frau wirklich für die Arbeit?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Operationalisierung
- 2.2.1 Die Normalarbeitszeit
- 2.2.2 Die Teilzeitarbeit
- 2.2.3 Geringfügige Beschäftigung
- 3. Methoden
- 3.1 Hypothesen
- 3.2 Datensatz und Methode
- 3.3 Methodisches Vorgehen
- 4. Univariate Beschreibung der Merkmale
- 5. Ergebnisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Frage, wie viel Zeit einer Frau wirklich für die Arbeit bleibt, unter Berücksichtigung des Anstiegs der Erwerbsquote von Frauen und der damit verbundenen Doppelbelastung von Haushalt und Beruf. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Formen von Arbeitszeit und deren Auswirkungen auf die finanzielle und zeitliche Situation von Frauen.
- Entwicklung der Erwerbsquote von Frauen
- Steigende Teilzeitquote
- Doppelbelastung von Haushalt und Beruf
- Auswirkungen der verschiedenen Arbeitszeitmodelle auf die finanzielle Situation
- Eingeschränkte Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die historische Entwicklung der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau dar. Sie zeigt, dass Frauen lange Zeit nicht für ihre Arbeit entlohnt wurden und sich den gesellschaftlichen Normen anpassen mussten. Die Einleitung stellt auch die aktuelle Situation dar und stellt die Forschungsfrage nach der verfügbaren Zeit für die Arbeit von Frauen.
- Theoretischer Hintergrund: Dieser Abschnitt beleuchtet den Frauenbericht 2010 und analysiert die Entwicklung der Erwerbsquote von Frauen, den Anstieg der Teilzeitarbeit und die Auswirkungen der Geburt eines Kindes auf die berufliche Karriere von Frauen. Er stellt verschiedene Formen von Arbeitszeit wie Normalarbeitszeit, Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung vor.
- Methoden: Dieses Kapitel erläutert die Forschungsmethodik, die zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendet wird. Es beschreibt die Hypothesen, den Datensatz und das methodische Vorgehen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Erwerbsarbeit von Frauen, Arbeitszeitmodelle, Doppelbelastung, Teilzeitarbeit, Geringfügige Beschäftigung, Frauenbericht, Erwerbsquote, und Gender-Aspekte in der Arbeitswelt.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in Österreich?
Männer verdienen in Österreich im Durchschnitt für dieselbe Arbeit etwa 21% mehr als Frauen (laut Bundeskanzleramt).
Was bedeutet "Doppelbelastung" für erwerbstätige Frauen?
Es beschreibt die Herausforderung, gleichzeitig den Anforderungen des Berufs und der unbezahlten Haus- und Familienarbeit gerecht werden zu müssen.
Welche Arbeitszeitmodelle werden in der Analyse unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Normalarbeitszeit, Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäftigung.
Welchen Einfluss hat die Geburt eines Kindes auf die Karriere von Frauen?
Die Analyse zeigt, dass die Geburt eines Kindes oft zu einem Wechsel in Teilzeitarbeit oder zu Unterbrechungen führt, was die finanzielle Situation und Aufstiegschancen beeinflusst.
Warum ist die Teilzeitquote bei Frauen in Österreich so hoch?
Die Arbeit untersucht dies im Kontext gesellschaftlicher Normen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Frauen oft in zeitlich flexiblere, aber schlechter bezahlte Jobs drängt.
- Quote paper
- Verena Pichler (Author), 2013, Wie viel Zeit bleibt einer Frau für die Arbeit? Eine multivariate Analyse zur Erwerbstätigkeit in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309172