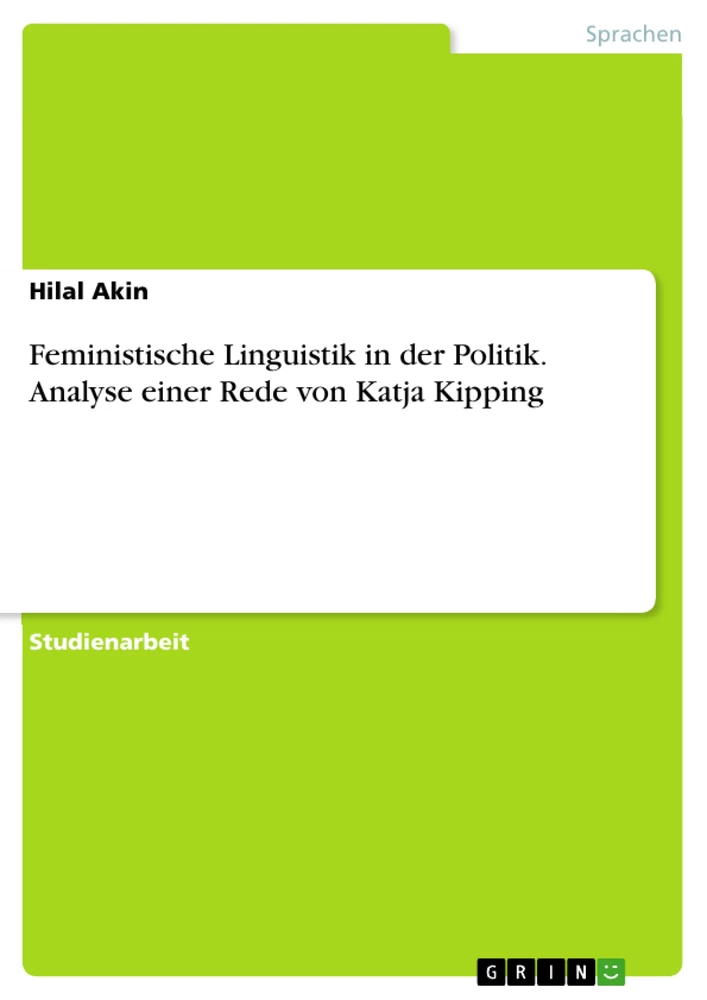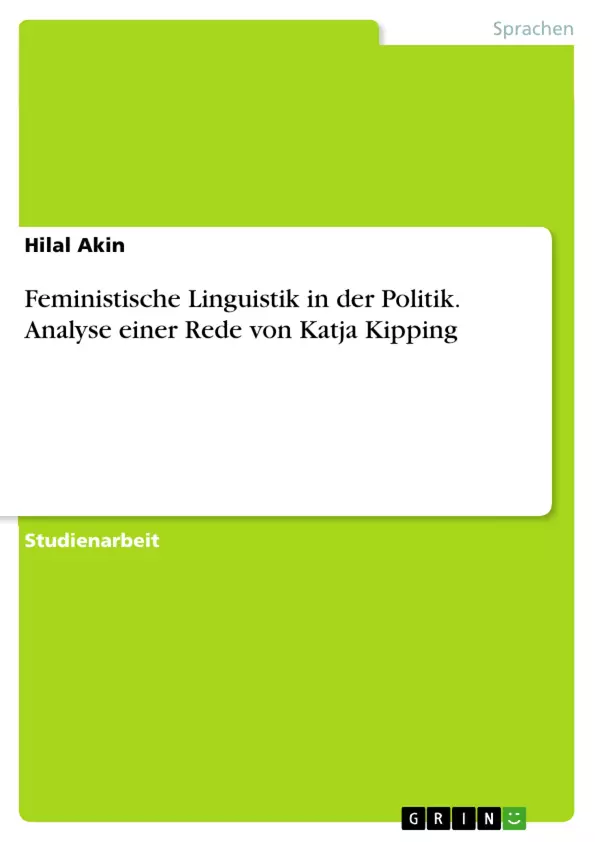Es stellt sich die Frage, wie feministische Sprachwissenschaftlerinnen sich eine geschlechtergerechte Sprache vorstellen und ob diese Sprache auch in politischen Reden realisierbar ist. Vorab werden die für den praktischen Teil relevanten theoretischen Grundlagen der feministischen Linguistik, mit dem Schwerpunkt auf ihrer Sprachkritik und den sprachpolitischen Maßnahmen vorgestellt.
Im praktischen Teil dieser Arbeit wird, aufbauend auf den theoretischen Teil, die Anwendung der idealen Sprache, nach der die Feministinnen sich sehnen, mit Hilfe einer Analyse der Rede „Feminismus rettet Leben“, gehalten von der DIE LINKE-Parteivorsitzenden Katja Kipping auf der Bundesfrauenkonferenz 2013 in Berlin, in der Politik veranschaulicht.
Es wurde ein Extremfall als Beispiel für die Analyse ausgewählt um die gewünschten Ziele des durch feministische Sprachpolitik eingeleiteten Sprachwandels zu veranschaulichen. Abschließend folgt ein resümierendes Fazit mit dem Ziel die erarbeiteten Ergebnisse kompakt darzustellen. Diese Arbeit beschränkt sich auf den deutschen Sprachgebrauch. Aufgeführt werden nur Aspekte, die auch im deutschen wiederzufinden sind und für den Analyseteil relevant sind.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1.) Einleitung
- 2.) Feministische Linguistik
- 2.1) Sprachkritik aus feministischer Sicht
- 2.1.1) Das generische Maskulinum
- 2.1.2) Ansätze für eine sprachliche Gleichstellung der Geschlechter
- 2.2) Sprachpolitische Maßnahmen
- 3.) „Feminismus rettet Leben“-Analyse
- 3.1) Anredeformen
- 3.2) Geschlechterspezifikation
- 3.3) Pronomen
- 4.) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Anwendung feministischer Sprachtheorien in der politischen Rede, insbesondere im Kontext der Rede „Feminismus rettet Leben“ von Katja Kipping. Der Fokus liegt darauf, die Anwendung der idealen Sprache, die von Feministinnen gefordert wird, in einer politischen Rede zu analysieren und die angestrebten Ziele des durch feministische Sprachpolitik gesteuerten Sprachwandels zu veranschaulichen.
- Die Entwicklung und Kritik feministischer Sprachtheorie
- Sprachliche Geschlechterdiskriminierung und ihre Auswirkungen
- Sprachliche Strategien zur Förderung von Gleichstellung
- Die Anwendung feministischer Sprachtheorien in der Politik
- Analyse der Rede „Feminismus rettet Leben“ von Katja Kipping
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die feministische Linguistik ein und beschreibt ihren Ursprung in der Neuen Frauenbewegung. Sie stellt die zentralen Akteure und ihre Theorien vor, insbesondere die Kritik an sprachlichen Asymmetrien und die Suche nach alternativen, geschlechterinklusiven Sprachformen.
Kapitel 2 behandelt die feministische Linguistik im Detail. Zuerst wird die Sprachkritik aus feministischer Sicht erläutert, die sich auf die Aufdeckung der Benachteiligung von Frauen in der Sprache konzentriert. Dann werden die wichtigsten sprachpolitischen Maßnahmen vorgestellt, die darauf abzielen, die Sprache gerechter und inklusiver zu gestalten.
Kapitel 3 analysiert die Rede „Feminismus rettet Leben“ von Katja Kipping. Dabei werden die Anredeformen, die Geschlechterspezifikation und die Verwendung von Pronomen untersucht, um festzustellen, wie sich die Sprache der Rede mit den Prinzipien der feministischen Linguistik verhält.
Schlüsselwörter (Keywords)
Feministische Linguistik, Sprachkritik, Sprachpolitische Maßnahmen, Geschlechtergerechte Sprache, Sprachwandel, Sprachliche Diskriminierung, Anredeformen, Geschlechterspezifikation, Pronomen, Katja Kipping, „Feminismus rettet Leben“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der feministischen Linguistik?
Ziel ist eine geschlechtergerechte Sprache, die die Benachteiligung von Frauen in der Sprache aufdeckt und alternative, inklusive Sprachformen fördert.
Was ist die Kritik am generischen Maskulinum?
Feministische Linguistinnen kritisieren, dass Frauen bei der Verwendung männlicher Formen lediglich „mitgemeint“, aber gedanklich oft nicht präsent sind.
Wie setzt Katja Kipping feministische Sprache in ihrer Rede um?
Die Analyse untersucht Kippings Verwendung von Anredeformen, Geschlechterspezifikationen und Pronomen in ihrer Rede „Feminismus rettet Leben“.
Welche sprachpolitischen Maßnahmen werden vorgeschlagen?
Dazu gehören Splitting-Formen (z.B. „Bürgerinnen und Bürger“), neutrale Formulierungen oder die Verwendung des Gender-Sternchens.
Ist geschlechtergerechte Sprache in der Politik realisierbar?
Die Arbeit veranschaulicht am Beispiel Kippings, dass ein bewusster Sprachwandel in politischen Reden möglich ist und als Instrument der Gleichstellung dient.
- Arbeit zitieren
- Hilal Akin (Autor:in), 2015, Feministische Linguistik in der Politik. Analyse einer Rede von Katja Kipping, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309230