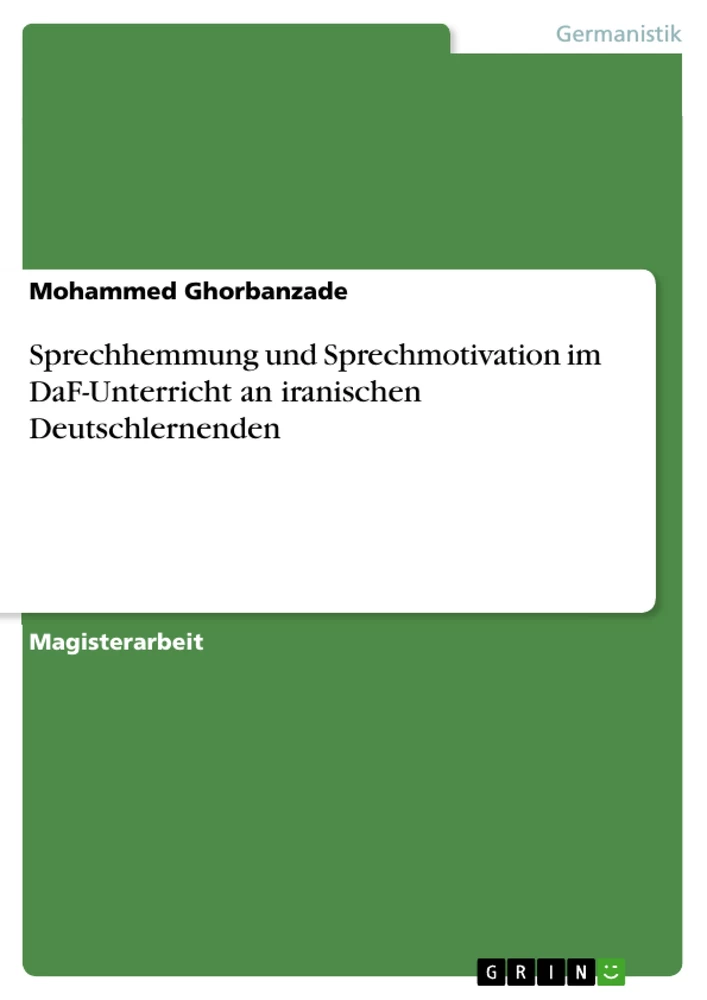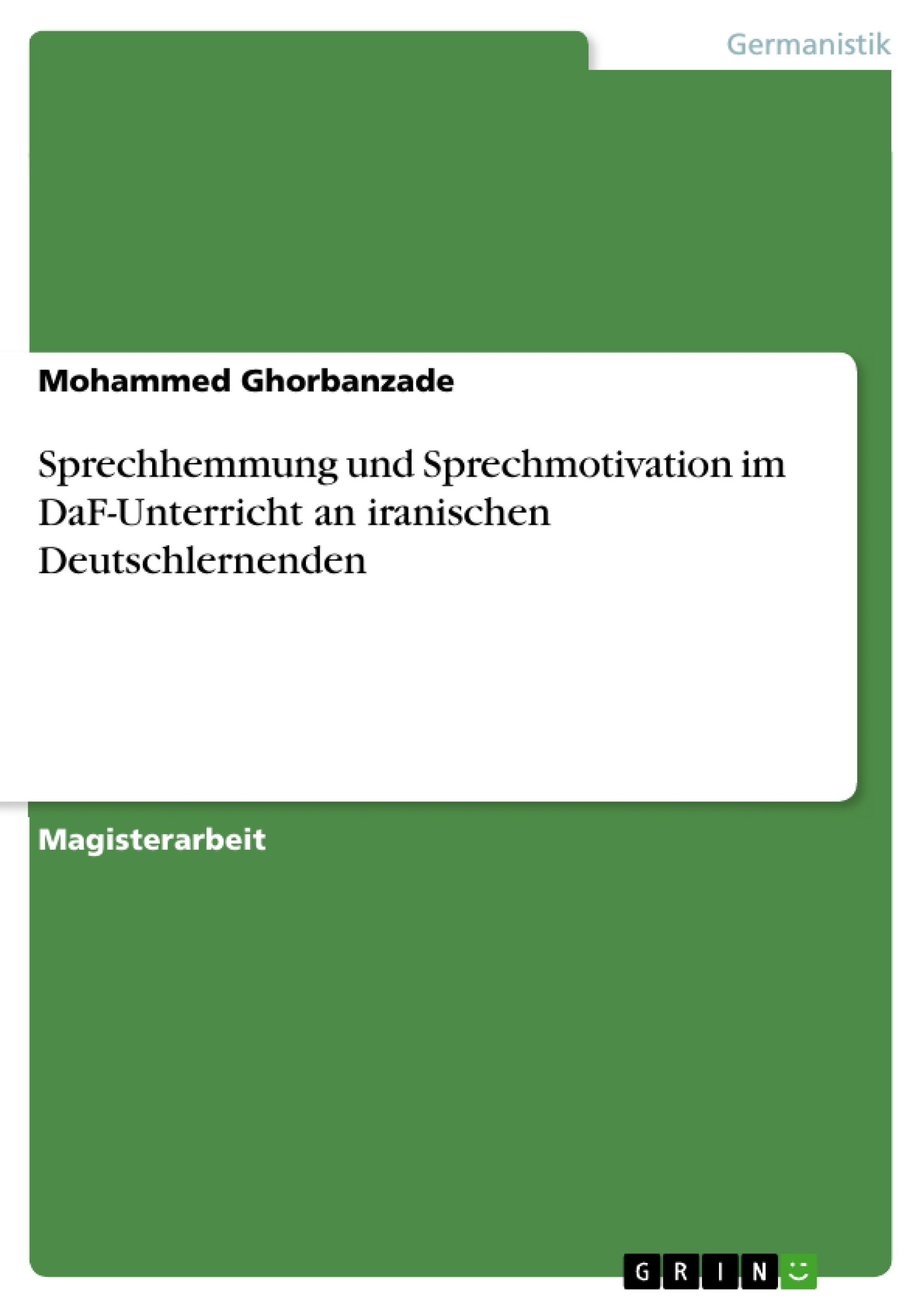Beim Lernen von Fremdsprachen verursachen solche psychischen Lagen der Sprechangst ein großes Problem, indem sie den Weg zur Fremdsprachenbeherrschung versperren und fast unmöglich machen. Diese Forschungsarbeit verdeutlicht, inwieweit sich Sprechangst und Sprechmotivation auf die mündliche Kompetenz bzw. Sprachproduktion der DaF-Studierenden auswirken.
Der erste und wichtigste Anlass, der mich zur Auswahl des Themas ››Sprechangst bzw. –hemmung und Sprechmotivation im DaF-Unterricht an iranischen Deutschlernenden‹‹ angeregt hat, ist diese Sache, dass die Mehrheit der Studierenden in der Mittel- und Oberstufe im DaF-Unterricht vorwiegend Schwierigkeiten haben, Deutsch anzuwenden, d.h. sie im ››Sprechen‹‹ insbesondere im Gespräch Hemmungen haben, Deutsch zu sprechen. Aus diesem Grund habe ich dieses Thema ausgewählt, um den Studierenden und natürlich mir selbst zu helfen, solche Angst beim Deutschsprechen zu überwinden.
››Diese Arbeit will nicht nur die Untersuchungsergebnisse bekanntgeben, sondern die Probleme der heutigen Situation einbeziehen und daraus neue Vorschläge machen.‹‹
Ich hoffe, dass ich mit dieser Forschungsarbeit zur Lösung dieses Problems beitragen und und die DaF-Lehrenden beim Erreichen der einzelnen Niveaustufen optimal unterstützen kann, damit sie sehr schnell in der Lage sein können, die deutsche Sprache aktiv und kreativ anzuwenden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Danksagung
- Abstrakt
- Vorwort
- Bemerkung
- Einleitung – ein kurzer Blick über die Arbeit
- THEORETISCHER TEIL
- 1. lerntheoretische Hintergründe
- 1.1. Lernen und Lerntheorien
- 1.1.1. behavioristische Lerntheorie
- 1.1.1.1. Lehrmethode und Rolle des Lehrers
- 1.1.1.2. Lernprozess und Rolle der Lernenden
- 1.1.1.3. Kritik
- 1.1.2. kognitivistische Lerntheorie
- 1.1.2.1. Lehrmethode und Rolle des Lehrers
- 1.1.2.2. Lernprozess und Rolle der Lernenden
- 1.1.2.3. Kritik
- 1.1.3. konstruktivistische Lerntheorie
- 1.1.3.1. Lehrmethode und Rolle des Lehrers
- 1.1.3.2. Lernprozess und Rolle der Lernenden
- 1.1.3.3. Kritik
- 1.1.4. Vergleiche und Unterschiede zwischen Lerntheorien
- 1.2. Lernen und Erwerben von Sprachen
- 1.3. Einflussfaktoren auf das Erlernen des Deutschen als Fremdsprachenlernen
- 1.3.1. lernerinterne Faktoren im Sprachlernprozess
- 1.3.2. lernerexterne Faktoren im Sprachlernprozess
- 1.4. die vier Fertigkeiten
- 1.4.1. der Begriff ››Fertigkeit‹‹
- 1.4.2. das Verhältnis der vier Fertigkeiten zueinander
- 1.4.3. die schriftlichen und mündlichen Fertigkeiten
- 2. Faktoren von Ursprünge, Ursachen und Behandlung von ››Sprechangst‹‹
- 2.1. der psychologische und philosophische Begriff ››Angst‹‹
- 2.2. Angst und Ängstlichkeit
- 2.3. die verschiedene Ängste im Unterricht
- 2.4. Angst beim Sprechen
- 2.5. Manifestationsebenen von Redeangst
- 2.5.1. kognitive Ebene
- 2.5.2. behaviorale Ebene
- 2.5.3. physiologische Ebene
- 2.6. Einfluss der Sprechangst bzw. –hemmung auf Fremdsprachenlernprozess
- 3. zum Begriff, Stellenwert und zur Bedeutung und Funktion ››Motivation‹‹ beim Fremdsprachenlernen
- 3.1. die Begriffserklärung ››Motivation‹‹
- 3.2. Motiv, Motivierung, Motivation
- 3.3. Motivationstypen
- 3.3.1. instrumentelle und integrative Motivation
- 3.3.2. intrinsische und extrinsische Motivation
- 3.3.3. erweiterte Motivationskonzeptionen
- 3.4. Lernmotivation
- 3.4.1. selbstbestimmte Lernmotivation
- 3.4.2. Bedingungen der Lernmotivation im Untericht
- 3.5. Motivieren im fremdsprachlichen Klassenzimmer
- 3.5.1. Motivieren in der pädagogischen Psychologie
- 3.5.2. Motivationskonstrukt
- 3.5.3. Motivationsprobleme im Studium
- 3.5.4. lernerinterne Faktoren der Motivation beim Fremdsprachenlernen
- 3.5.5. lernerexterne Faktoren der Motivation beim Fremdsprachenlernen
- 3.5.6. die Motivation des Lehrers
- 3.5.7. Förderung von Lern- und Leistungsmotivation in der Schule
- 4. Stellenwert ››autonomes Lernen‹‹ im Fremdsprachenlernen
- 4.1 die Ursprünge und der Begriff ››Autonomie‹‹
- 4.2. die Begriffserläuterungen ››autonomes Lernen‹‹, ››Lernerautonomie‹‹ und ››selbstgesteuertes Lernen‹‹
- 4.3. Gründe für das autonome Lernen
- 4.3.1. gesellschaftliche Gründe
- 4.3.2. konstruktivistisch–lerntheoretische Begründung
- 4.3.3. kognitivistische Begründung
- 4.3.4. sprachlerntheoretische Begründung
- 4.3.5. Recht auf Autonomie als Begründung
- 4.4. Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht
- 4.4.1. Aspekte der Lernerautonomie
- 4.4.2. Entwicklung von Lernerautonomie in der Fremdsprachenforschung
- 4.5. Voraussetzungen für das autonome Lernen
- 4.5.1. Voraussetzung der Lehrkräfte für das autonome Lernen
- 4.5.2. Voraussetzungen der Lerner für das autonome Lernen
- 4.5.3. Voraussetzungen der Lernumgebung für das autonome Lernen
- 4.6. Lernerautonomie und Motivation
- PRAKTISCHER TEIL
- 5. empirische Untersuchung Sprechhemmung bzw. –angst und -motivation im DaF-Unterricht an iranischen Deutschlernenden
- 5.1. Untersuchungsmethode, Vorgehensweise und Dürchführung der Arbeit
- 5.2. die deutsche Sprache im iranischen Schulsystem - ein kurzer Überblick
- 5.3. Datenanalyse des Fragebogens
- 5.4. Auswertung und Erhebung der Fragebögen
- 6. Fazit
- 6.1. zusammenfassende Darstellung von Ergebnissen aus der Auswertung und Erhebung
- 6.2. Untersuchungsergebnisse
- 7. Verzeichnisse von Tabellen, Abbildungen und Abkürzungen
- 7.1. Tabellen
- 7.2. Abbildungen
- 7.3. Abkürzungen
- 8. Glossar
- 9. Anhang
- 9.1. DaF-Studierenden-Fragebogen
- 9.2. Übersicht
- 9.3. Schlagwörter
- Literaturverzeichnis
- Internetverzeichnis
- Quote paper
- Magister Mohammed Ghorbanzade (Author), 2015, Sprechhemmung und Sprechmotivation im DaF-Unterricht an iranischen Deutschlernenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309319