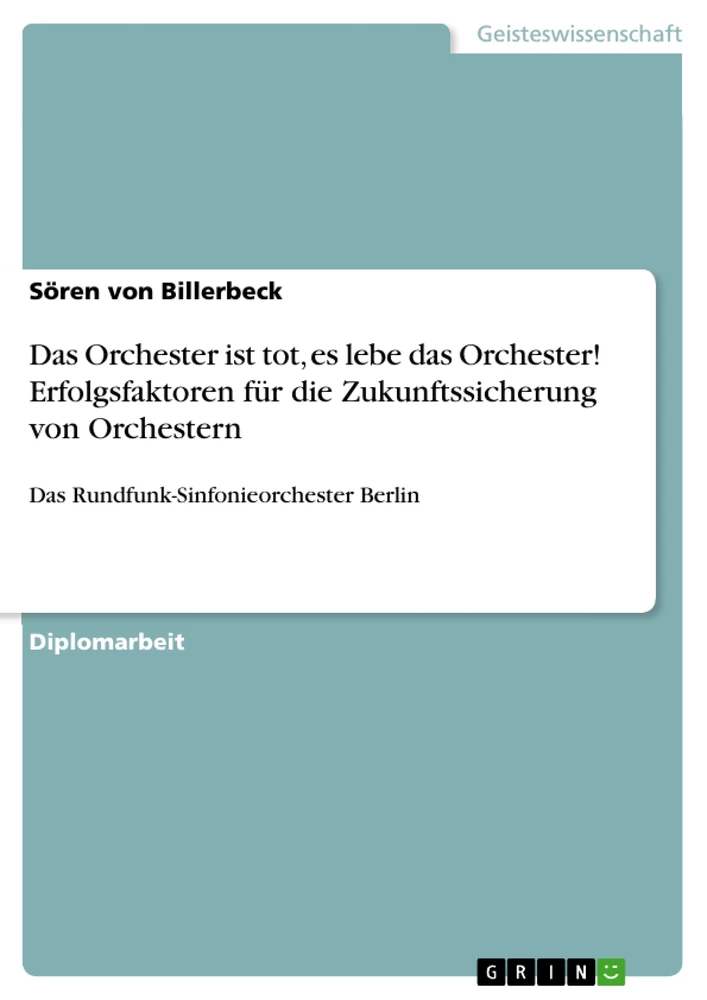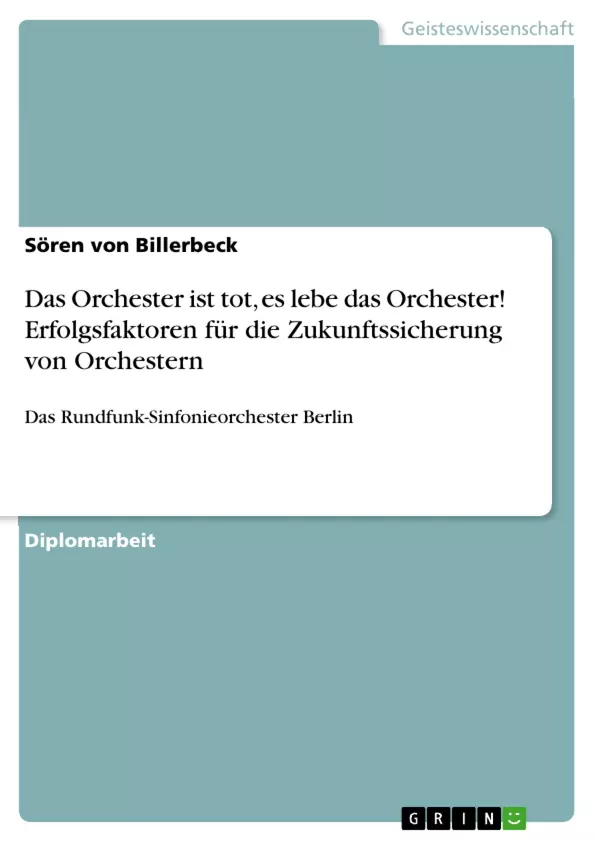Die Situation der deutschen Orchester hat sich innerhalb der letzten fünfundzwanzig Jahre drastisch verändert. Einerseits wuchs die Zahl der Kulturorchester durch die politische Wiedervereinigung Deutschlands. Andererseits sind seitdem 39 Ensembles aufgelöst bzw. fusioniert worden. Bei den Rechtsformen zeigt sich mittlerweile ein Trend hin zu mehr Eigenständigkeit und Arbeit unter wirtschaftlichen Bedingungen. Eigenbetriebe, Stiftungen und GmbHs wurden gebildet, um Kosten zu sparen und die nötige Flexibilität beim Betrieb der Orchester zu erreichen. Insgesamt ist zu beobachten, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse über Kulturmanagementprozesse, beispielsweise aus den USA mit ihrer vergleichsweise sehr geringen öffentlichen Finanzausstattung, hierzulande durchsetzen. Spielpläne unterliegen oft nicht mehr nur der künstlerischen Planung, sondern berücksichtigen viel mehr als früher auch Besucherbedürfnisse. Da sich das Orchesterpublikum in seiner Altersstruktur wandelt, müssen neue Wege der Besucherbindung gefunden werden, um diesem Prozess entgegen zu wirken.
Um nicht irgendwann vor leeren Konzertsälen zu spielen, ist es unabdingbar, neue Besucherschichten durch angepasste Programmatik zu gewinnen, ohne die künstlerische Identität aufzugeben. Daraus resultiert eine Gratwanderung im Spannungsfeld zwischen Besucherzahlen, Mainstream, Anspruch und Kulturauftrag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1: Situation der deutschen Orchesterlandschaft
- 1. Orchesterland Deutschland - eine Bestandsaufnahme
- 1.1. Situation nach der deutschen Wiedervereinigung
- 1.2. Orchesterarten
- 1.2.1. Opernorchester
- 1.2.2. Konzertorchester
- 1.2.3. Rundfunkorchester
- 1.3. Organisationsformen
- 1.4. Finanzierung
- Teil 2: Erfolgsfaktoren für die Zukunftssicherung von Orchestern
- 2. Kulturmanagement: Ansätze/ Instrumente/ Maßnahmen
- 2.1. Marketing/ Kulturmarketing
- 2.2. Kombinierte ganzheitliche Maßnahmen
- Teil 3: Strategie am Beispiel Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
- 3. Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin - „Das Wesentliche ist die Musik“
- 3.1. Einleitung
- 3.2. Kulturmarketing
- 3.3. Education
- 3.4. Programmgestaltung und Produktplanung
- 3.5. Fazit Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Erfolgsfaktoren für die Zukunftssicherung deutscher Orchester, insbesondere am Beispiel des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Sie untersucht die Veränderungen der deutschen Orchesterlandschaft seit der Wiedervereinigung, die verschiedenen Organisations- und Finanzierungsformen sowie strategische Ansätze des Kulturmanagements zur nachhaltigen Sicherung der Orchester.
- Veränderungen der deutschen Orchesterlandschaft seit der Wiedervereinigung
- Analyse verschiedener Organisations- und Finanzierungsmodelle deutscher Orchester
- Erfolgsfaktoren im Kulturmanagement für die Zukunftssicherung von Orchestern
- Strategische Maßnahmen des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin zur Zukunftssicherung
- Bewertung der angewandten Strategien und deren Übertragbarkeit auf andere Orchester
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die drastischen Veränderungen der deutschen Orchesterlandschaft in den letzten 25 Jahren, gekennzeichnet durch Auflösungen, Fusionen und Rechtsformänderungen. Sie hebt die zunehmende Bedeutung von Kulturmanagement-Strategien und die Notwendigkeit der Anpassung an ein sich wandelndes Publikum hervor. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: eine Bestandsaufnahme der deutschen Orchesterlandschaft, die Darstellung möglicher Instrumente des Kulturmanagements und die Analyse des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin als Fallbeispiel.
Teil 1: Situation der deutschen Orchesterlandschaft: Dieser Teil bietet einen umfassenden Überblick über die deutsche Orchesterlandschaft. Er analysiert die Situation nach der Wiedervereinigung, die verschiedenen Orchesterarten (Konzert-, Opern- und Rundfunkorchester), verschiedene Organisationsformen (Eigenbetriebe, Stiftungen, GmbHs etc.) und die Finanzierungsmodelle. Die Analyse zeigt die Herausforderungen auf, denen sich die Orchester angesichts stagnierender Einnahmen und steigender Kosten gegenübersehen.
Teil 2: Erfolgsfaktoren für die Zukunftssicherung von Orchestern: Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene Instrumente des Kulturmanagements, die für die Zukunftsfähigkeit von Orchestern entscheidend sind. Der Fokus liegt auf Marketing- und Kommunikationsstrategien, innovativem Konzertpädagogik und der Entwicklung neuer Konzertformate. Es werden verschiedene Maßnahmen wie Sponsoring, Fundraising und die Nutzung neuer Medien diskutiert, um neue Zielgruppen zu erreichen und die Besucherbindung zu stärken.
Teil 3: Strategie am Beispiel Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin: Dieser Teil analysiert die Strategien des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin zur Sicherung seiner Zukunftsfähigkeit. Es werden die Markenbildung, Besucherbindungsmaßnahmen, die Zusammenarbeit mit Partnern und innovative Bildungsprogramme untersucht. Der Fokus liegt auf der erfolgreichen Implementierung von Kulturmanagement-Instrumenten und deren Beitrag zum Erfolg des Orchesters.
Schlüsselwörter
Orchesterlandschaft, Deutschland, Kulturmanagement, Zukunftssicherung, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Finanzierung, Organisationsformen, Marketing, Besucherbindung, Konzertpädagogik, Innovation, Strategie.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Zukunftssicherung deutscher Orchester
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Erfolgsfaktoren für die Zukunftssicherung deutscher Orchester, insbesondere am Beispiel des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Sie untersucht die Veränderungen der deutschen Orchesterlandschaft seit der Wiedervereinigung, verschiedene Organisations- und Finanzierungsformen sowie strategische Ansätze des Kulturmanagements zur nachhaltigen Sicherung der Orchester.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Bestandsaufnahme der deutschen Orchesterlandschaft nach der Wiedervereinigung, eine Betrachtung verschiedener Orchesterarten (Konzert-, Opern- und Rundfunkorchester) und Organisationsformen. Sie analysiert Finanzierungsmodelle, erörtert Erfolgsfaktoren im Kulturmanagement, untersucht die Strategien des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin und bewertet deren Übertragbarkeit auf andere Orchester. Schwerpunkte sind Marketingstrategien, innovative Konzertpädagogik und die Entwicklung neuer Konzertformate.
Welche Struktur hat die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil 1 bietet eine Bestandsaufnahme der deutschen Orchesterlandschaft. Teil 2 beleuchtet Instrumente des Kulturmanagements für die Zukunftsfähigkeit von Orchestern. Teil 3 analysiert die Strategien des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin als Fallbeispiel. Zusätzlich enthält die Arbeit eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Fazit.
Welche Herausforderungen für deutsche Orchester werden angesprochen?
Die Arbeit zeigt die Herausforderungen auf, denen sich deutsche Orchester angesichts stagnierender Einnahmen und steigender Kosten gegenübersehen. Es werden die Notwendigkeit von Anpassung an ein sich wandelndes Publikum und die zunehmende Bedeutung von Kulturmanagement-Strategien hervorgehoben.
Welche Instrumente des Kulturmanagements werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Instrumente des Kulturmanagements, darunter Marketing- und Kommunikationsstrategien, innovative Konzertpädagogik, Sponsoring, Fundraising, die Nutzung neuer Medien, die Entwicklung neuer Konzertformate und Maßnahmen zur Besucherbindung.
Welche Rolle spielt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin in der Arbeit?
Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin dient als Fallbeispiel, um die erfolgreichen Implementierungen von Kulturmanagement-Instrumenten und deren Beitrag zum Erfolg des Orchesters zu analysieren. Die Arbeit untersucht dessen Markenbildung, Besucherbindungsmaßnahmen, die Zusammenarbeit mit Partnern und innovative Bildungsprogramme.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Übertragbarkeit der im Fallbeispiel analysierten Strategien auf andere Orchester. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Fazit der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Orchesterlandschaft, Deutschland, Kulturmanagement, Zukunftssicherung, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Finanzierung, Organisationsformen, Marketing, Besucherbindung, Konzertpädagogik, Innovation, Strategie.
- Arbeit zitieren
- Sören von Billerbeck (Autor:in), 2014, Das Orchester ist tot, es lebe das Orchester! Erfolgsfaktoren für die Zukunftssicherung von Orchestern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309708