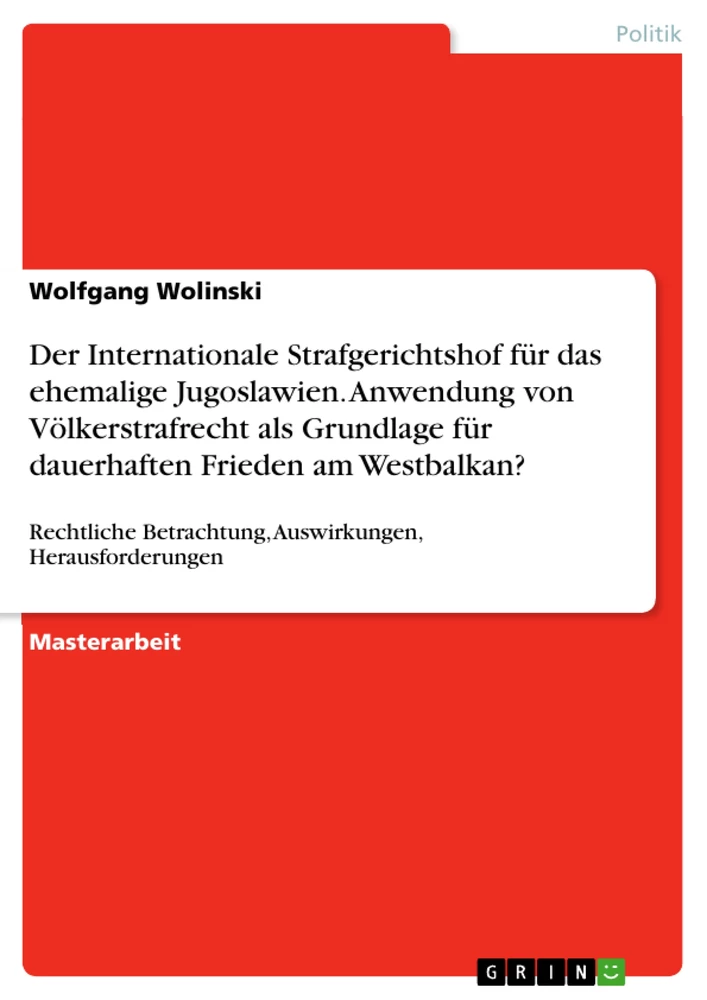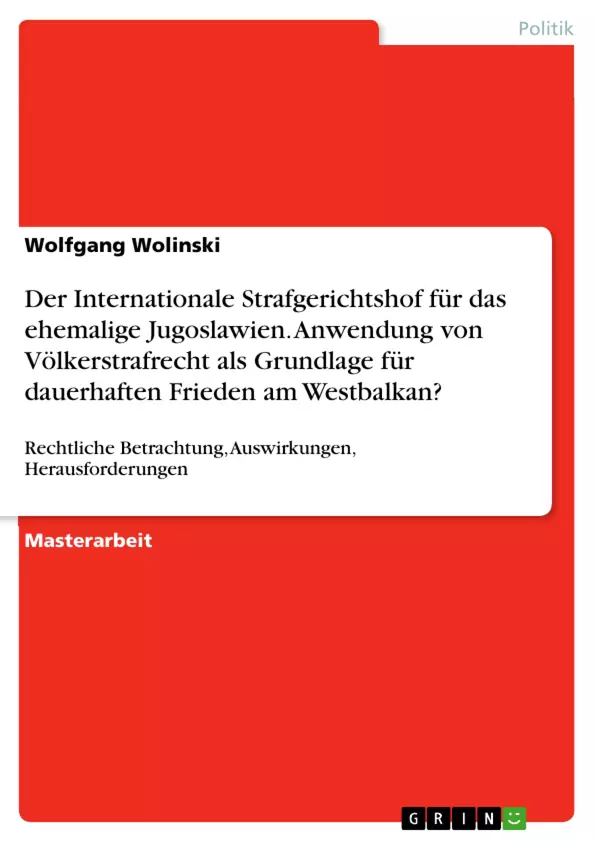Das „Internationale Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien“, im folgenden ICTY, Haager Tribunal oder Tribunal, ist am 25. Mai 1993 auf Grundlage der Resolutionen 808 und 827 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, in Den Haag errichtet worden, nachdem die in Bosnien-Herzegowina verübten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit als „Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit“ eingestuft wurden.
In seiner Funktion als Ad-hoc-Gerichtshof erhielt das ICTY vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen weitreichende Aufgaben, die einerseits die strafrechtliche Verfolgung, Aufklärung und Ahndung der seit 1991 im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen völkerrechtlichen Verbrechen umfasste und andererseits die nationale Versöhnung und Befriedung forcieren und dadurch zukünftige Menschenrechtsverletzungen verhindern sollten.
Am 22.10.2010 wurde vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen der „International Residual Mechanism“ geschaffen. Es handelt sich dabei um jene Einrichtung, welche es ermöglicht, die wesentlichsten Funktionen des Tribunals auch nach der Beendigung des Mandates des ICTY weiterzuführen. Damit verbunden sind ein stufenweiser Abbau des Personals und der finanziellen Ressourcen und damit ein Auslaufen der Tätigkeit des ICTY. Wann genau dies sein wird, ist ungewiss, aber ein Ende mit Ablauf das Jahres 2017 scheint realistisch. Grundlage für das Inkrafttreten des „International Residual Mechanism“ ist der Abschluss der letzten ausstehenden Verfahren gegen Radovan Karadzić und Ratko Mladić.
Insofern erscheint es nach mehr als 20 Jahren Tätigkeit des ICTY bzw. mit der Einstellung der Ermittlungs- bzw. Anklagetätigkeit angebracht, die tatsächliche Bilanz des Tribunals im Rahmen dieser Studie zu untersuchen. Das bedeutet für die Region des ehemaligen Jugoslawien, sich in erster Linie mit den Ursachen und den Auswirkungen des Krieges und den möglicherweise noch nicht überwundenen oder gänzlich neuen Konflikten zu befassen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Kapitel 1: Der Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien
- 1.1. Einleitung
- 1.2. Der Zusammenbruch der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ)
- 1.3. Die Kriege auf dem Gebiet der ehemaligen SFRJ
- 1.3.1. Slowenien
- 1.3.2. Kroatien
- 1.3.3. Bosnien
- 1.3.4. Kosovo
- 1.4. Die Rolle der Internationalen Gemeinschaft
- 1.5. Friedensverträge
- 1.5.1. Das ,,Dayton-Abkommen“
- 1.5.2. Das gescheiterte Rambouillet-Abkommen
- 1.5.3. Zusammenfassung
- Kapitel 2: Verfolgung von Kriegsverbrechern nach dem Völkerstrafrecht
- 2.1. Einleitung
- 2.2. Grundlagen des Völkerrechts
- 2.3. Das Verhältnis zw. humanitärem Völkerrecht und Menschenrechten
- 2.4. Der Weg zum ICTY
- 2.4.1. Das Gründung des ICTY
- 2.4.2. Das Statut des ICTY
- 2.4.3. Verfahrens- und Beweisregeln
- 2.4.4. Vorverfahren
- 2.4.5. Hauptverfahren
- 2.4.6. Beweisverfahren
- 2.4.7. Urteil
- 2.4.8. Rechtsmittel
- 2.5. Ausgewählte Entscheidungen des ICTY
- 2.6. Genozid-Verfolgung
- 2.7. Genozid-Klagen vor dem IGH
- 2.8. Errungenschaften und Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts
- Kapitel 3: Completition Strategy
- 3.1. Der Weg zur Beendigung des Tribunals
- 3.2. Übergangsmechanismus
- 3.3. Stärkung der nationalen Justiz zur Verfolgung von Kriegsverbrechern
- 3.4. Kritik, Misserfolge und mangelnde Kooperation
- 3.4.1. Serbien
- 3.4.2. Kroatien
- 3.4.3. Bosnien
- 3.4.4. Kosovo
- 3.5. Erfolge
- 3.6. Outreach-Programme
- Kapitel 4: Transitional Justice
- 4.1. Einleitung
- 4.2. Definition, Ziele und Instrumente der Transitional Justice
- 4.3. Wahrheitskommissionen
- 4.3.1. Versuche der Einrichtung von Wahrheitskommissionen
- 4.4. Gerechtigkeit durch strafrechtliche Aufarbeitung?
- 4.5. Lustration und Sicherheitsüberprüfungen
- 4.6. Entschädigungen und Wiedergutmachung
- 4.7. Medien und Gesten der Versöhnung
- 4.8. Entschuldigungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Master-Thesis untersucht die Rolle des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen und der Anwendung von Völkerstrafrecht als Grundlage für dauerhaften Frieden am Westbalkan. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Aspekte, Auswirkungen und Herausforderungen des ICTY und seiner Arbeit.
- Der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien und seine Folgen
- Die Gründung und die Arbeit des ICTY
- Die Anwendung von Völkerstrafrecht im Kontext des jugoslawischen Konflikts
- Die Herausforderungen der Transitional Justice
- Die Perspektiven für nachhaltigen Frieden am Westbalkan
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 untersucht den Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, die Ursachen des Zusammenbruchs der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) und die Kriege, die sich in den Nachfolgestaaten entwickelten. Es analysiert die Rolle der internationalen Gemeinschaft und die Friedensverträge, insbesondere das Dayton-Abkommen, das den Bosnien-Krieg beendete.
Kapitel 2 befasst sich mit der Verfolgung von Kriegsverbrechern nach dem Völkerstrafrecht. Es beleuchtet die Grundlagen des Völkerrechts, die Entstehung des ICTY und seine Funktionsweise sowie ausgewählte Entscheidungen des Tribunals.
Kapitel 3 analysiert die Completition Strategy des ICTY, den Übergangsprozess zur Beendigung des Tribunals und die Stärkung der nationalen Justiz in den Ländern des Westbalkans. Es bewertet die Erfolge und Misserfolge der Bemühungen zur Verfolgung von Kriegsverbrechern sowie die Bedeutung der Outreach-Programme.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Thema Transitional Justice und untersucht verschiedene Instrumente zur Aufarbeitung von Konflikten, wie z. B. Wahrheitskommissionen, Lustration und Entschädigungen. Es reflektiert die Herausforderungen und Dilemmata der Transitional Justice im Kontext des Westbalkans.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Master-Thesis befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY), Völkerstrafrecht, Kriegsverbrechen, Genozid, Transitional Justice, Wahrheitskommissionen, Lustration, Entschädigungen, Westbalkan, nachhaltiger Frieden.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Aufgabe des ICTY?
Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien sollte Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgen und zur Versöhnung in der Region beitragen.
Was bedeutet „Transitional Justice“?
Es umfasst Maßnahmen zur Aufarbeitung von Unrechtssystemen oder bewaffneten Konflikten, wie Wahrheitskommissionen, Strafverfolgung, Lustration und Entschädigungen.
Welche Rolle spielten Radovan Karadzić und Ratko Mladić?
Sie waren Schlüsselfiguren des Bosnien-Konflikts. Ihre Verfahren gehörten zu den bedeutendsten und letzten großen Prozessen vor dem ICTY.
War das Tribunal für den Frieden am Westbalkan erfolgreich?
Die Bilanz ist gemischt: Während viele Täter verurteilt wurden, bleibt die gesellschaftliche Versöhnung schwierig und die nationale Justiz steht weiterhin vor großen Herausforderungen.
Was ist der „International Residual Mechanism“?
Es ist eine Nachfolgeeinrichtung, die die wesentlichen Funktionen des ICTY (wie Zeugenschutz und Überwachung von Haftstrafen) nach dessen Schließung weiterführt.
- Quote paper
- Wolfgang Wolinski (Author), 2015, Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Anwendung von Völkerstrafrecht als Grundlage für dauerhaften Frieden am Westbalkan?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309728