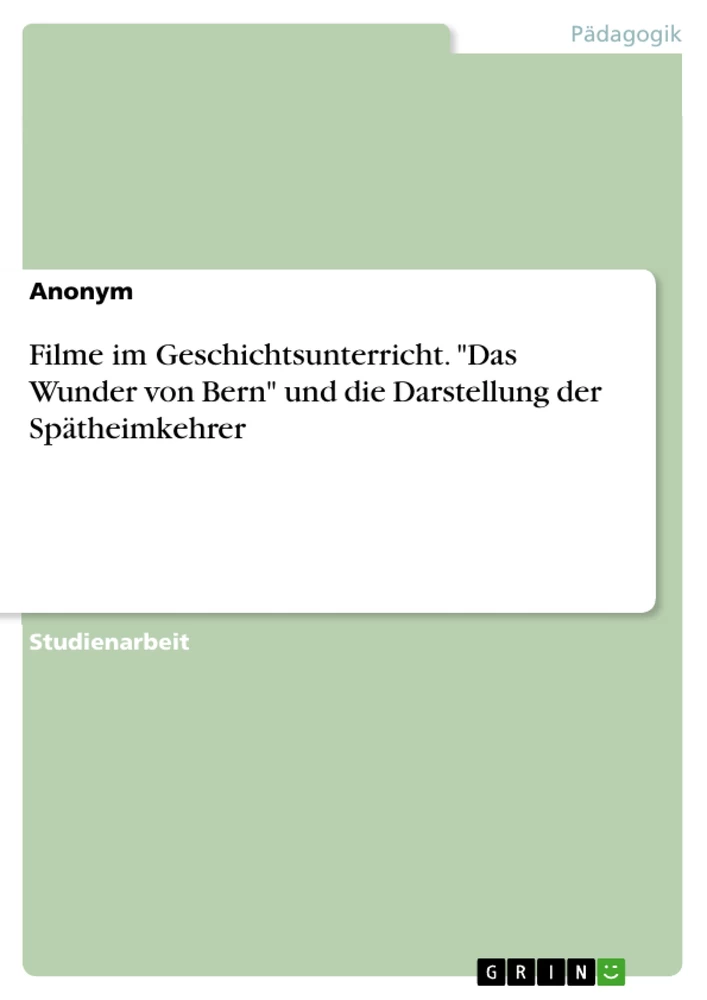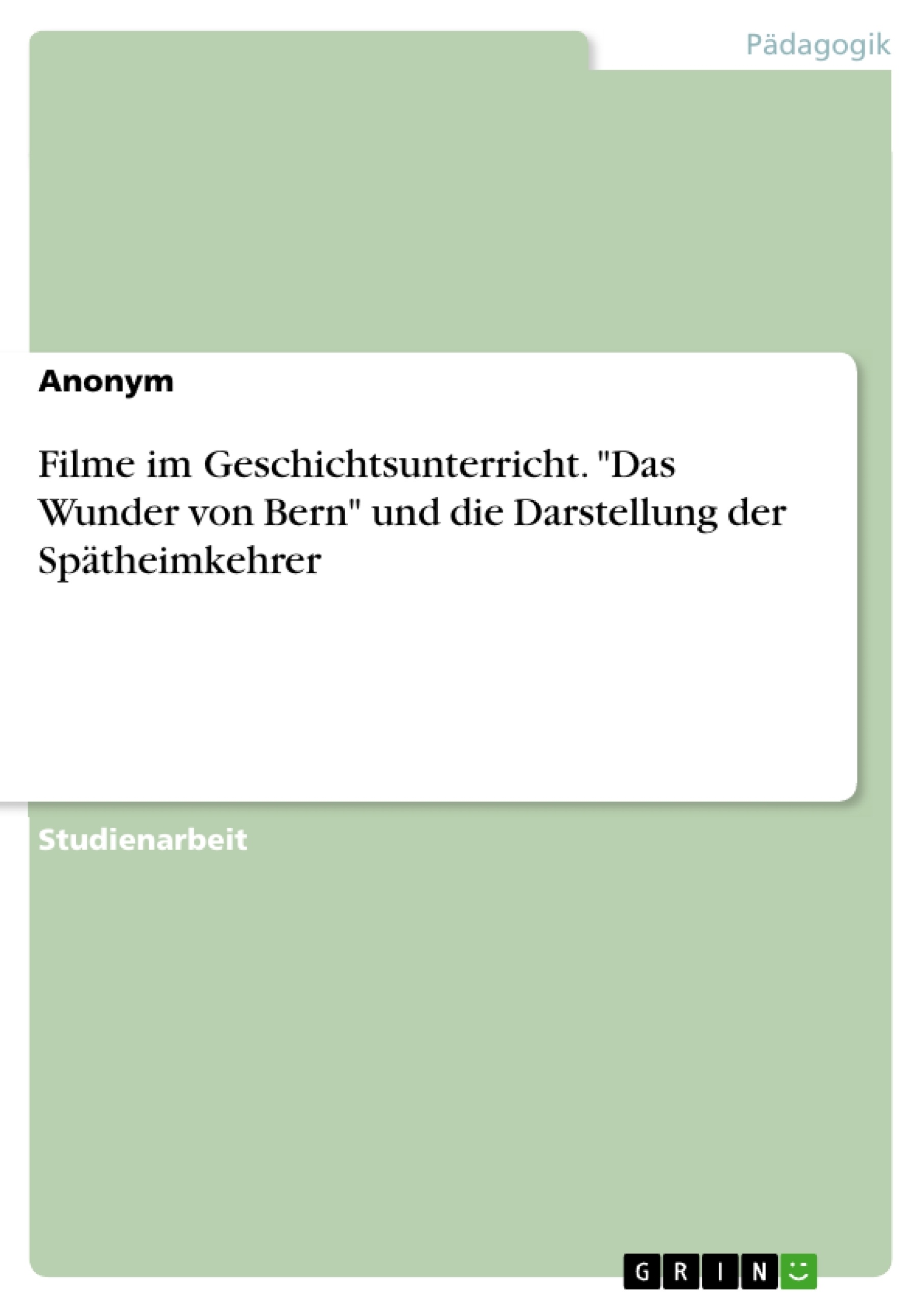Der Einsatz von Medien ist mittlerweile ein fester und wichtiger Bestandteil in der Unterrichtsgestaltung. Natürlich bildet dabei der Geschichtsunterricht keine Ausnahme. Aber gerade die Auswahl des passenden Mediums bereitet einer Lehrkraft oftmals größere Schwierigkeiten. Ein Klassiker im Geschichtsunterricht ist das Vorführen von Filmen. Doch auch hier kann man aufgrund der Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten leicht in Schwierigkeiten geraten.
Neben den klassischen Dokumentationen etablieren sich vor allem immer mehr historische Spielfilme auf dem Markt, die nach Meinung einiger Kritiker unter Umständen für den Einsatz im Unterricht in Frage kommen. In der folgenden Arbeit möchte ich mich mit einem dieser Filme genauer beschäftigen, und zwar mit einem Werk das zumindest viele Schüler wohl nicht zu den typischen Historienfilmen zählen würden. Das Wunder von Bern des deutschen Regisseurs Sönke Wortmann war einer der Kinoerfolge im Jahr 2003.
Da in dem Historiendrama mehrere Handlungsstränge miteinander verknüpft werden und ich den Rahmen der Seminararbeit nicht sprengen möchte, beschränke ich mich auf einen zentralen Aspekt, die Darstellung der Rückkehr in die Familie des deutschen Kriegsgefangenen Richard Lubanski Die Arbeit versucht herauszuarbeiten wie die Heimkehrer-Problematik im Film dargestellt wird. Als Hauptquelle dient deshalb der Film, bei dem man auf Grundlage der zahlreichen neuen Beiträge in der Forschung zahlreiche altgediente Motive erkennen und entlarven konnte. Der Aufbau meiner Arbeit stützt sich auf die These dass Sönke Wortmann sich auf Bilder, Denkmuster und Vorstellungen stützt, die in den 1950er Jahren in der Diskussion um die späten Kriegsheimkehrer nach Deutschland entwickelt worden sind. Ich werde deshalb anhand von ausgewählten Filmszenen aufzeigen dass sich Wortmann an genau diesen typisch altmodischen Denkmustern und Geschichtsbildern bedient.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Kriegsheimkehrer in der Opferrolle
- 2. Die Rückkehr nach Deutschland
- 2.1 Die Kriegsgefangenen und ihre psychischen Probleme
- 2.2 Die Rolle der Frau
- 2.3 Lubanski und die Schuldfrage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Heimkehr deutscher Kriegsgefangener im Film "Das Wunder von Bern" von Sönke Wortmann. Ziel ist es, herauszuarbeiten, wie die Problematik der Spätheimkehrer im Film präsentiert wird und inwiefern sich der Regisseur dabei an gängigen Vorstellungen der 1950er Jahre orientiert.
- Darstellung der Kriegsheimkehrer als Opfer
- Die Rolle der Frauen in der Nachkriegsgesellschaft
- Die Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung
- Die Verwendung von gängigen Denkmustern der 50er Jahre im Film
- Der Film als Medium im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Wahl des Films "Das Wunder von Bern" als Untersuchungsgegenstand. Sie thematisiert die Herausforderungen bei der Auswahl geeigneter Medien im Geschichtsunterricht und hebt die Bedeutung des Films als populäres Medium hervor. Der Fokus wird auf die Darstellung der Rückkehr des Kriegsgefangenen Richard Lubanski und seiner Familie gelegt, wobei die These aufgestellt wird, dass der Film auf den in den 1950er Jahren vorherrschenden Vorstellungen über Spätheimkehrer basiert.
1. Die Kriegsheimkehrer in der Opferrolle: Dieses Kapitel analysiert den Kontext der Nachkriegszeit und die Tendenz, das Leid des deutschen Volkes in den Vordergrund zu stellen. Es wird die Entwicklung einer Opferperspektive im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und der kollektiven Schuldfrage beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Viktimisierung als selektive Erinnerungsform, die das eigene Leid betont und die Tabuisierung des Krieges relativiert. Der Vergleich Deutschlands mit einem Ghetto durch den CSU-Abgeordneten Eugen Gerstenmaier wird als Beispiel für eine öffentliche Propagierung dieser Sichtweise angeführt.
2. Die Rückkehr nach Deutschland: Dieses Kapitel (das die Unterkapitel 2.1, 2.2 und 2.3 umfasst) untersucht die Darstellung der Rückkehr der Kriegsgefangenen nach Deutschland und die damit verbundenen Probleme. Es beleuchtet die psychischen Probleme der Kriegsgefangenen, die Rolle der Frauen in der Nachkriegsgesellschaft und die Auseinandersetzung mit der Schuldfrage am Beispiel von Richard Lubanski. Die Synthese der Unterkapitel zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Herausforderungen der Heimkehrer und ihrer Integration in die Gesellschaft zu liefern, wie sie im Film dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Spätheimkehrer, "Das Wunder von Bern", Geschichtsdidaktik, Nachkriegsdeutschland, Opferrolle, kollektive Schuld, Viktimisierung, Medien im Geschichtsunterricht, Film als Geschichtsquelle, 1950er Jahre.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Darstellung von Kriegsheimkehrern in "Das Wunder von Bern"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Heimkehr deutscher Kriegsgefangener, insbesondere die der Spätheimkehrer, im Film "Das Wunder von Bern" von Sönke Wortmann. Sie untersucht, wie die Problematik der Spätheimkehrer präsentiert wird und inwiefern der Film gängige Vorstellungen der 1950er Jahre widerspiegelt.
Welche Themen werden im Film und in der Analyse behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Kriegsheimkehrer als Opfer, die Rolle der Frauen in der Nachkriegsgesellschaft, die Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung, die Verwendung von gängigen Denkmustern der 1950er Jahre im Film und die Eignung des Films als Medium im Geschichtsunterricht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Figur Richard Lubanski und seiner Familie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, zwei Hauptkapiteln und einem Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Auswahl des Films. Kapitel 1 analysiert die Darstellung der Kriegsheimkehrer als Opfer und die Tendenz zur Viktimisierung im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Kapitel 2 untersucht die Rückkehr der Kriegsgefangenen nach Deutschland, einschließlich der psychischen Probleme der Heimkehrer, der Rolle der Frauen und der Auseinandersetzung mit der Schuldfrage am Beispiel Lubanskis. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spätheimkehrer, "Das Wunder von Bern", Geschichtsdidaktik, Nachkriegsdeutschland, Opferrolle, kollektive Schuld, Viktimisierung, Medien im Geschichtsunterricht, Film als Geschichtsquelle, 1950er Jahre.
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse?
Die Arbeit möchte herausarbeiten, wie die Problematik der Spätheimkehrer im Film "Das Wunder von Bern" präsentiert wird und inwiefern sich der Regisseur dabei an gängigen Vorstellungen der 1950er Jahre orientiert. Sie untersucht auch die Eignung des Films als Medium für den Geschichtsunterricht.
Wie wird die Thematik der Schuldfrage im Film behandelt?
Die Schuldfrage wird am Beispiel von Richard Lubanski und der allgemeinen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit behandelt. Die Analyse untersucht, wie der Film die kollektive Schuld und die individuelle Verantwortung darstellt und welche Perspektive er dabei einnimmt.
Welche Rolle spielen die Frauen im Film und in der Analyse?
Die Rolle der Frauen in der Nachkriegsgesellschaft wird als ein wichtiger Aspekt der Analyse betrachtet. Der Film und die Arbeit untersuchen, wie Frauen mit den Herausforderungen der Nachkriegszeit und der Rückkehr der Kriegsgefangenen umgehen.
Wie wird der Film "Das Wunder von Bern" als Medium im Geschichtsunterricht bewertet?
Die Arbeit erörtert die Eignung des Films als Medium im Geschichtsunterricht, wobei seine Popularität und seine Darstellung historischer Zusammenhänge im Fokus stehen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Filme im Geschichtsunterricht. "Das Wunder von Bern" und die Darstellung der Spätheimkehrer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309858