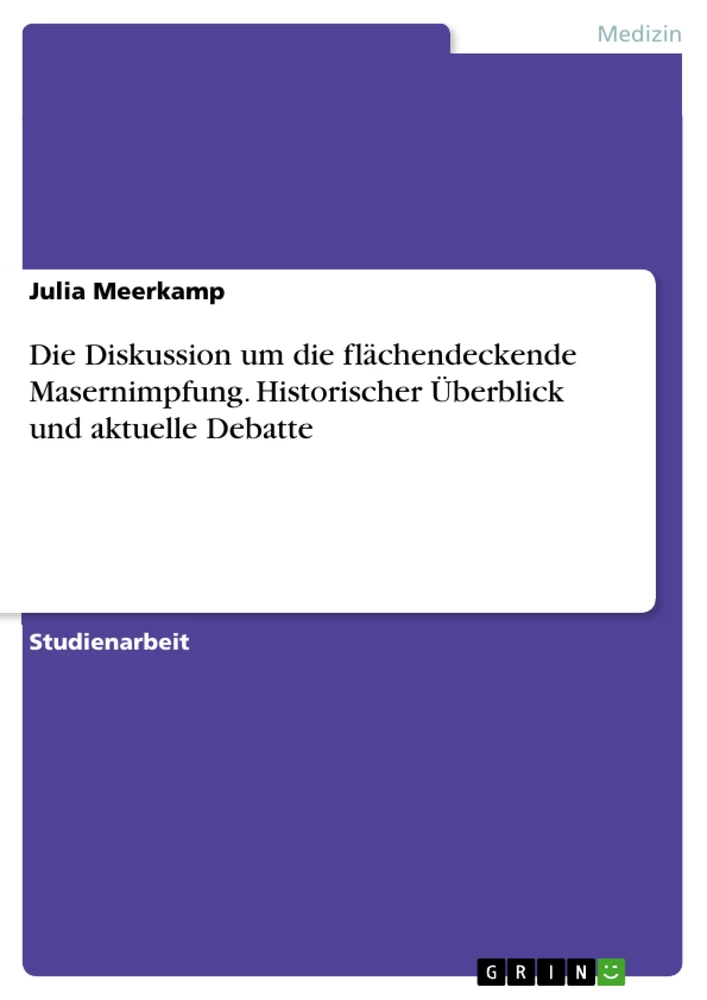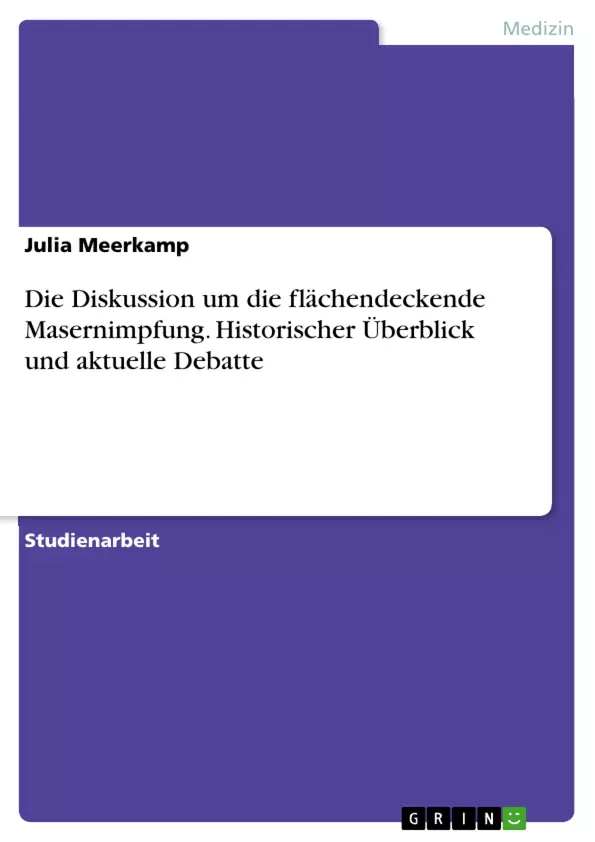Die Masernausbrüche der vergangenen Jahre in Deutschland führen ganz aktuell wieder zu Diskussionen um die mögliche Gefahr, die von dieser Krankheit ausgeht, und um die Einführung einer Impfpflicht. In dieser Abhandlung werden die Folgen der Masernimpfeinführung im geschichtlichen Wandel betrachtet und die Argumente für und gegen diese Impfung diskutiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 EINLEITUNG
- 2 MASERN
- 2.1 Infektionsweg
- 2.2 Symptome
- 2.3 Therapie
- 2.4 Komplikationen
- 2.4.1 Masernotitis
- 2.4.2 Pneumonie
- 2.4.3 Enzephalitis
- 2.4.4 SSPE
- 2.4.5 Pharyngitis
- 2.4.6 Appendizitis
- 2.4.7 Colitis
- 2.4.8 Peri- und Myokarditis
- 2.4.9 Hepatitis
- 2.5 Positive Effekte der Masernerkrankung
- 3 MASERN-IMPFUNG
- 3.1 Allgemein
- 3.2 Komplikationen
- 4 MASERN IM GESCHICHTLICHEN WANDEL
- 4.1 Das Krankheitsimage
- 4.2 Impfpflicht
- 4.3 Herdenschutz und Impfquote
- 4.4 Verschiebung des Infektionsalters
- 5 ZUSAMMENFÜHRUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der flächendeckenden Masernimpfung als gesundheitspolitische Maßnahme. Sie untersucht die aktuelle medizinische Faktenlage der Masernkrankheit, beleuchtet die Impfung und ihren geschichtlichen Verlauf, und führt diese Komponenten kritisch zusammen.
- Die medizinische Faktenlage der Masernkrankheit, inklusive Infektionsweg, Symptome, Therapie und Komplikationen
- Die Funktionsweise und potenziellen Komplikationen der Masernimpfung
- Der geschichtliche Wandel des Krankheitsimages und die Entwicklung der Impfpolitik
- Der Herdenschutzeffekt und die Bedeutung der Impfquote für die Eindämmung der Masern
- Die Verschiebung des Infektionsalters und die daraus resultierenden Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 2: Masern: Dieses Kapitel stellt den aktuellen medizinischen Wissensstand zur Masernkrankheit dar, inklusive Infektionsweg, Symptomen, Therapie und Komplikationen. Es beleuchtet die Bedeutung des Virus und seine Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Außerdem werden potentielle positive Effekte der Erkrankung diskutiert.
- Kapitel 3: Masern-Impfung: Dieses Kapitel erklärt die Funktionsweise der Masernimpfung, einschließlich der Ziele des Individual- und Kollektivschutzes. Es diskutiert auch die potenziellen Komplikationen der Impfung und beleuchtet die aktuelle Diskussion um Impfnebenwirkungen.
- Kapitel 4: Masern im geschichtlichen Wandel: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Krankheitsimages der Masern und die Einführung der Impfpflicht. Es analysiert die Rolle der Impfquote im Zusammenhang mit dem Herdenschutzeffekt und untersucht die Verschiebung des Infektionsalters.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Masern, Masernimpfung, Infektionsweg, Symptome, Komplikationen, Herdenschutz, Impfquote, Impfpflicht, Krankheitsimage, Verschiebung des Infektionsalters, Gesundheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten Komplikationen bei einer Masernerkrankung?
Zu den Komplikationen gehören Mittelohrentzündung (Otitis), Lungenentzündung (Pneumonie), Gehirnentzündung (Enzephalitis) und die lebensgefährliche Spätfolge SSPE.
Wie funktioniert der Herdenschutz (Herdenimmunität)?
Wenn eine ausreichend hohe Impfquote (ca. 95%) erreicht wird, ist der Erreger so stark eingedämmt, dass auch nicht geimpfte Personen indirekt geschützt sind.
Welche Argumente gibt es für und gegen eine Impfpflicht?
Befürworter betonen den Schutz der Allgemeinheit und die Ausrottung des Virus; Kritiker führen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Impfnebenwirkungen an.
Was bedeutet die "Verschiebung des Infektionsalters"?
Durch Impfungen treten Masern seltener im Kindesalter auf, was zu einer Zunahme von Infektionen bei Jugendlichen und Erwachsenen führt, bei denen Komplikationen oft schwerer verlaufen.
Gibt es positive Effekte einer Masernerkrankung?
Die Arbeit diskutiert kritisch Thesen über eine mögliche Stärkung des Immunsystems durch die natürliche Auseinandersetzung mit dem Wildvirus.
- Quote paper
- Julia Meerkamp (Author), 2015, Die Diskussion um die flächendeckende Masernimpfung. Historischer Überblick und aktuelle Debatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309874