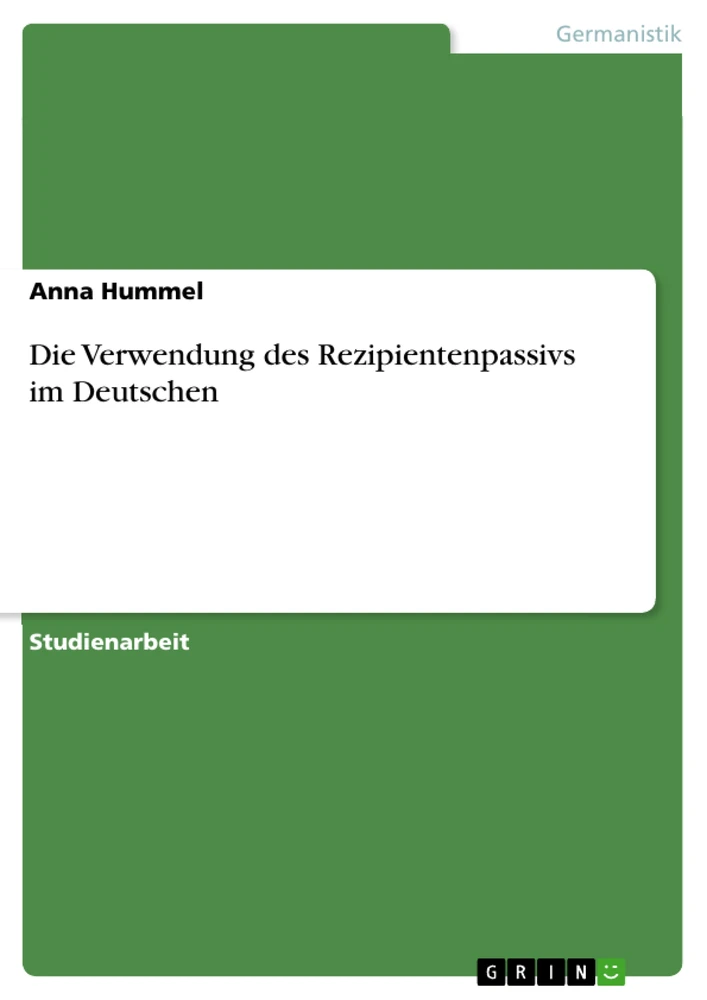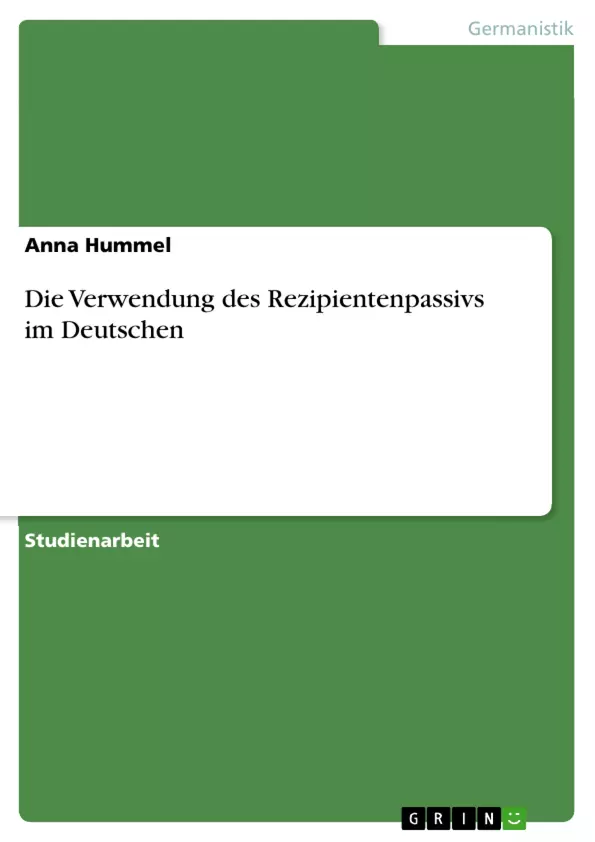Ein ins Zentrum der Forschung gerücktes Phänomen der Sprachwissenschaft ist die Grammatikalisierung. Darunter versteht man einen Prozess des Sprachwandels, bei dem lexikalische Elemente des Wortschatzes zunehmend grammatische Funktionen übernehmen (Leuschner 2005: 1). Von der Entwicklung von Lexemen zu Suffixen (vgl. Werk – Schuhwerk) bis zur Verwendung des englischen Verbs to go, um zukünftige Handlungen auszudrücken (vgl. he is going to Erlangen – he is going to come) gibt es eine große Bandbreite an Grammatikalisierungsprozessen, die in unterschiedlichen Sprachen belegt sind.
In dieser Arbeit soll am Bsp. des sog. Rezipientenpassivs auf dieses Phänomen eingegangen werden, wobei aus den Vollverben bekommen, kriegen und erhalten Hilfsverben zur Passivbildung und somit grammatische Bestandteile der Sprache werden. Neben der Hilfsverbverwendung bleiben die Vollverben aber weiter erhalten, was deutlich macht, dass Grammatikalisierung als gradueller Prozess mit vielen Zwischenphasen einzustufen ist.
Der wissenschaftliche Status des Rezipientenpassivs war lange umstritten, was zum einen am noch vorhandenen semantischen Gehalt der Hilfsverben, zum anderen an der häufigen Verwendung in der Umgangssprache liegt (Pape-Müller 1980: 37). Zifonun (1997: 1824) ordnet daher das 'bekommen-Passiv' „eher der Peripherie der Konstruktion zu, da nicht alle für das Passiv konstitutiven Bedingungen hier erfüllt sind“.
Im Rahmen der Arbeit soll nun der Grammatikalisierungsprozess der drei Konstruktionsverben weiter untersucht werden. Außerdem wird auf Restriktionen in der Verwendung eingegangen, also in welchen Fällen eine Bildung möglich ist und wann nicht, welche Vollverben für eine Konstruktion in Frage kommen bzw. ausscheiden. Gibt es zudem stilistische Aspekte, die das Vorkommen in der geschriebenen und gesprochenen Sprache bedingen? Wann ist das auxiliar verwendete bekommen mit erhalten oder kriegen austauschbar? Auf diese und weitere Fragen soll nun im Folgenden eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des Rezipientenpassivs
- Bildung
- Entstehung
- Grammatikalisierung
- Regeln und Restriktionen in der Verwendung
- Bei Vollverben
- Transitive Verben
- Intransitive Verben
- Bei den Hilfsverben
- Grammatische Aspekte
- Stilistische Unterschiede
- Eigenschaften der 'Mitspieler'
- Bei Vollverben
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Grammatikalisierung am Beispiel des Rezipientenpassivs, auch bekannt als 'bekommen-Passiv'. Ziel ist es, die Entwicklung der Passivbildung mit den Hilfsverben bekommen, kriegen und erhalten zu untersuchen und die grammatischen sowie stilistischen Besonderheiten dieser Konstruktion zu beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung des Rezipientenpassivs im Deutschen
- Die Grammatikalisierung der Hilfsverben bekommen, kriegen und erhalten
- Die Regeln und Restriktionen in der Verwendung des Rezipientenpassivs
- Stilistische Unterschiede in der Verwendung des Rezipientenpassivs
- Die Rolle der 'Mitspieler' im Rezipientenpassiv
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt das Konzept der Grammatikalisierung ein und stellt die Bedeutung des Rezipientenpassivs als Beispiel für diesen Sprachwandelprozess heraus. Die Debatte um den wissenschaftlichen Status des Rezipientenpassivs wird vorgestellt.
- Entwicklung des Rezipientenpassivs: Dieses Kapitel erläutert die Bildung des Rezipientenpassivs und beleuchtet seine Entstehungsgeschichte. Die Entwicklung der Hilfsverben bekommen, kriegen und erhalten wird anhand von Beispielen aus verschiedenen Epochen verdeutlicht.
- Regeln und Restriktionen in der Verwendung: Dieses Kapitel untersucht die grammatischen und stilistischen Einschränkungen des Rezipientenpassivs. Es werden die verschiedenen Verbtypen und ihre Verwendungsmöglichkeiten im Rezipientenpassiv betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Rezipientenpassiv, der Grammatikalisierung, dem Sprachwandel, den Hilfsverben bekommen, kriegen und erhalten, der Passivbildung, den grammatischen Regeln, den stilistischen Unterschieden und der Verwendung in der gesprochenen und geschriebenen Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Rezipientenpassiv?
Das Rezipientenpassiv (auch bekommen-Passiv) ist eine Konstruktion mit den Hilfsverben bekommen, kriegen oder erhalten, bei der das indirekte Objekt (Dativobjekt) des Aktivsatzes zum Subjekt des Passivsatzes wird.
Was bedeutet Grammatikalisierung in diesem Kontext?
Grammatikalisierung beschreibt den Prozess, bei dem Vollverben wie "bekommen" ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren und zunehmend die grammatische Funktion eines Hilfsverbs zur Passivbildung übernehmen.
Wann kann das Rezipientenpassiv nicht verwendet werden?
Es gibt Restriktionen bei bestimmten Verbtypen. Während transitive Verben oft problemlos funktionieren, stoßen intransitive Verben häufig an ihre Grenzen.
Gibt es stilistische Unterschiede zwischen "bekommen" und "kriegen"?
Ja, "bekommen" gilt als standardsprachlich neutral, "erhalten" als eher förmlich/geschrieben, während "kriegen" vorwiegend in der Umgangssprache verwendet wird.
Warum war der wissenschaftliche Status des bekommen-Passivs lange umstritten?
Dies lag am noch vorhandenen semantischen Gehalt der Verben und der Tatsache, dass nicht alle Bedingungen für ein klassisches Passiv (wie beim werden-Passiv) vollständig erfüllt sind.
Sind die Hilfsverben im Rezipientenpassiv immer austauschbar?
Nicht immer. Die Austauschbarkeit hängt von grammatischen Faktoren, dem Kontext und dem gewünschten Stilniveau ab.
- Arbeit zitieren
- Anna Hummel (Autor:in), 2014, Die Verwendung des Rezipientenpassivs im Deutschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309947