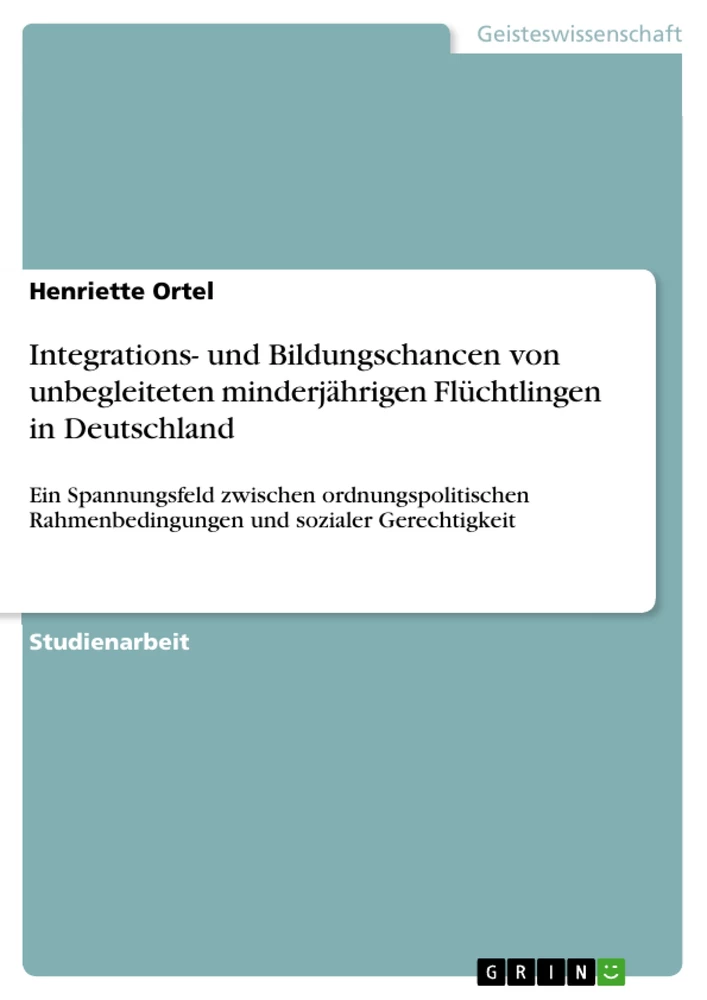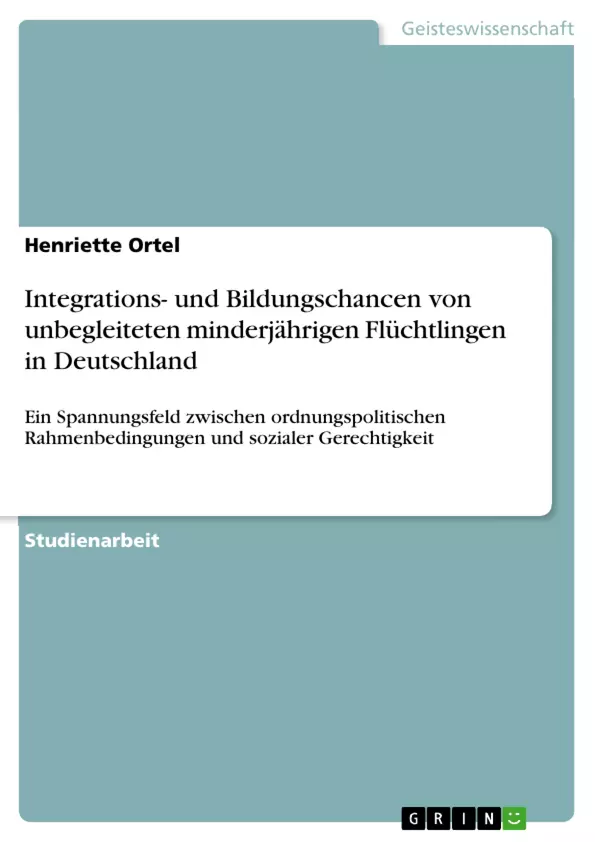Krieg, Folter, Verfolgung, mangelnde Befriedigung der physischen und psychischen Bedürfnisse, Zwangsrekrutierung, Zwangsheirat, Vergewaltigung, Prostitution und/oder der Verlust der Angehörigen bewegen Kinder häufig dazu aus ihrer Heimat zu fliehen. Oft sind sie durch gravierende Einschnitte in ihrer Biografie oder durch Erlebnisse auf der oft langen und bedrohlichen Flucht traumatisiert.
Auch konnte ein Großteil der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge noch nie ein Leben in Sicherheit und „Normalität“, mit regelmäßiger Essensaufnahme, dem täglichen Schulbesuch und ohne wirtschaftliche Notsituationen, erleben. Diese Kinder fliehen vor der Perspektivlosigkeit in ihrem Herkunftsland oder aufgrund der völligen Zerstörung ihrer Existenzgrundlage. Sie suchen Schutz und eine Lebensperspektive in der Bundesrepublik Deutschland.
Aber was erleben diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Deutschland tatsächlich? Nach geltendem Recht stehen ihnen theoretisch wie allen anderen Menschen in Deutschland auch, jene Maßnahmen und Subventionen zu, welche sie vor allem in ihrer speziellen Lebenssituation schützen, fördern und unterstützen sollen. Erfahren diese essenziellen Grundbedürfnisse der unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge in Deutschland aber tatsächlich Berücksichtigung? Wie sieht es speziell mit dem Recht auf (Schul-)Bildung aus?
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich damit auseinander, inwieweit in Bezug auf die Integrations- und Bildungschancen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland von sozialer Gerechtigkeit gesprochen werden kann und welche Rolle diesbezüglich dem Spannungsfeld zwischen der sozialen Gerechtigkeit, wozu auch die eigentlichen sozialpädagogischen Ziele und Aufträgen der Sozialen Arbeit zählen und den Zuschreibungen und Bedingungen einer ordnungspolitisch bestimmten Zuwanderungspolitik in Deutschland, zu Teil wird?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Rechtsgrundlage für den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland
- 1.1. Aufenthaltsstatus
- 1.2. Inobhutnahme/ Clearingverfahren
- 1.3. Fazit
- 2. Spannungsfeld zwischen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und sozialer Gerechtigkeit
- 3. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und ihre schulischen und beruflichen Bildungs- und Ausbildungschancen
- 3.1. Schule
- 3.2. Berufliche Chancen
- 3.3. Fazit Inklusion vs. Exklusion
- 4. Fazit
- 5. Wissenschaftliche Selbstreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit von sozialer Gerechtigkeit in Bezug auf die Integrations- und Bildungschancen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland gesprochen werden kann. Dabei wird das Spannungsfeld zwischen der sozialen Gerechtigkeit und den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen der Zuwanderungspolitik in Deutschland beleuchtet.
- Die Rechtsgrundlagen für den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland
- Das Spannungsfeld zwischen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen und sozialer Gerechtigkeit
- Die schulischen und beruflichen Bildungs- und Ausbildungschancen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
- Die Integration und Inklusion von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext der Integration und Bildung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel der Hausarbeit beleuchtet die Rechtsgrundlagen für den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland. Dabei werden Themen wie der Aufenthaltsstatus, die Inobhutnahme und das Clearingverfahren sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen im Kontext der UN-Kinderrechtskonvention behandelt.
Im zweiten Kapitel wird das Spannungsfeld zwischen den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen der Zuwanderungspolitik und den Zielen der sozialen Gerechtigkeit im Hinblick auf die Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht die schulischen und beruflichen Bildungs- und Ausbildungschancen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland. Dabei werden die Chancen und Herausforderungen in Bezug auf die Integration und Inklusion im Bildungssystem behandelt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Integration, Bildungschancen, soziale Gerechtigkeit, ordnungspolitische Rahmenbedingungen, Zuwanderungspolitik, Kinderrechte, UN-Kinderrechtskonvention, Inklusion, Exklusion, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)?
Es handelt sich um Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Erziehungsberechtigte aus ihrer Heimat geflohen sind, oft aufgrund von Krieg oder Verfolgung.
Welche Rechtsgrundlagen gelten für umF in Deutschland?
Wichtig sind die UN-Kinderrechtskonvention, das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) sowie spezifische Regelungen zur Inobhutnahme und zum Clearingverfahren.
Wie steht es um die Bildungschancen dieser Jugendlichen?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen dem Recht auf Schulbildung und den Hürden der deutschen Zuwanderungspolitik.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Integration?
Sozialpädagogen unterstützen bei der Bewältigung von Traumata und fördern die Inklusion in das Bildungs- und Ausbildungssystem.
Was ist das Clearingverfahren?
Es ist ein Prozess zur Feststellung des Alters, des Gesundheitszustands und des pädagogischen Bedarfs, um die weiteren Schritte der Unterbringung zu planen.
- Quote paper
- Henriette Ortel (Author), 2015, Integrations- und Bildungschancen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310096