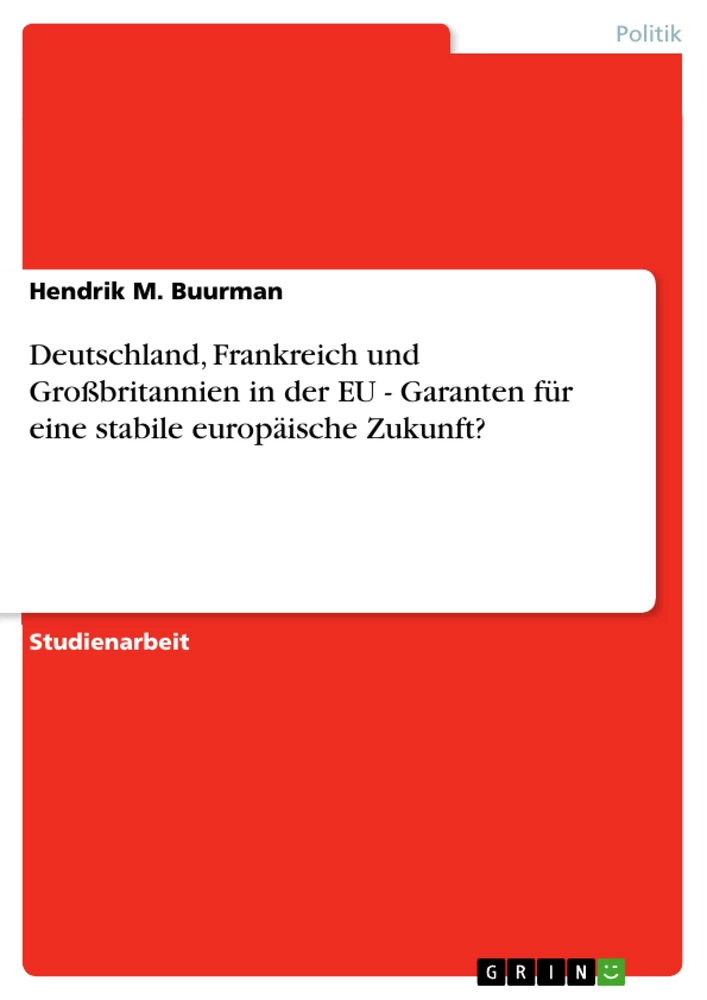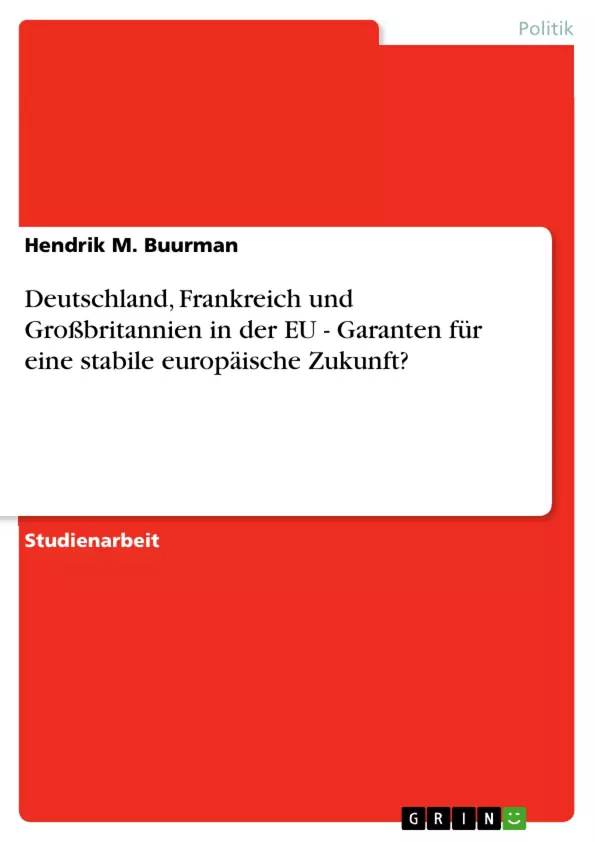Abstract
The paper is headlined „Germany, France and Great Britain in the EU- Guarantors for a stable European future?“ It covers the question whether the integration of the European states still is a worthy aim to try achieving. After a short introduction of the basic history of the European Union and it´s institutions the topic is dealt with by focussing on the economically and politically most powerful Germany, France and Great Britain as representatives for the member states. The interests in the EU and the actions taken for the community by those states will show that integration has proven to meet the needs of the country and is likely to be enhanced in the future. Great Britain builds an exception in some areas though. It becomes clear, that the isle has the biggest problems of the three in ceding powers of sovereignity to the union.
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit trägt den Namen „Deutschland, Frankreich und Großbritannien in der EU- Garanten für eine stabile europäische Zukunft?“ Sie geht der Frage nach, ob die Integration der europäischen Staaten für ihre Mitgliedsländer nach wie vor ein erstrebenswertes Ziel bildet. Nach einem kurzen Rückblick auf die bisherige Verlaufsgeschichte der EU und einer Vorstellung deren Institutionen wird diese Thematik, stellvertretend durch die drei nach wirtschaftlicher und politischer Macht führenden Mitglieder Deutschland, Frankreich und Großbritannien behandelt. Dabei wird durch Aufzeigen der bisher gebrachten Leistungen für die Gemeinschaft und die dahinter stehenden Interessen der Länder, sowie ihre bisherigen symbolischen und konkreten Vorteile, die Frage positiv beantwortet. Es wird außerdem deutlich, daß sich Großbritannien nach wie vor in einer gewissen Außenseiterposition bezüglich des Integrationswillens befindet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. 1) Kurze Geschichte der Europäischen Union
- 2) Die Institutionen der EU
- III. Die Positionen der Länder
- 1) Deutschland
- 2) Frankreich
- 3) Großbritannien
- IV. Schluß
- 1) Abstract
- 2) Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der europäischen Integration zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Abschluss der Amsterdamer Verträge. Im Fokus stehen dabei Deutschland, Frankreich und Großbritannien als wichtige Akteure der EU. Die Arbeit untersucht die Rolle der drei Länder für die europäische Integration, ihre Beiträge zu den Vertragsverhandlungen von Maastricht und Amsterdam sowie ihre jeweiligen Positionen zur weiteren Integration.
- Die Geschichte der Europäischen Union und ihrer wichtigsten Institutionen
- Die Rolle Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens für die europäische Integration
- Die Unterschiede in den Ansätzen und dem Elan der drei Länder zur weiteren Integration
- Die Bedeutung der Vereinbarkeit von weitergehender Integration mit nationalem Interesse
- Die Chancen für eine Fortführung des Integrationsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema der Arbeit und die wichtigsten Akteure. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der europäischen Integration und die Rolle der drei Länder. Der Hauptteil beleuchtet die jeweilige Rolle der drei Länder für Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs, insbesondere die Entwicklungen im direkten Gefolge des Jahres 1945 und die neueren Entwicklungen seit dem Amtsantritt von Mitterand, Kohl und Thatcher. Die Arbeit stellt die Aktionen und Initiativen der drei Länder für die EU dar, insbesondere ihre Beiträge zu den Vertragsverhandlungen von Maastricht und Amsterdam, aber auch ihre eventuellen Berührungsängste vor tiefergehender Integration. Für diverse Standpunkte werden historische Erklärungsmuster herangezogen.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, EU, Maastricht-Vertrag, Amsterdam-Vertrag, nationale Interessen, supranationale Integration, intergouvernementale Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernfrage dieser Arbeit zur EU?
Die Arbeit untersucht, ob die Integration der europäischen Staaten für ihre Mitgliedsländer, insbesondere Deutschland, Frankreich und Großbritannien, nach wie vor ein erstrebenswertes Ziel darstellt.
Wie unterscheidet sich die Position Großbritanniens von der Deutschlands und Frankreichs?
Großbritannien nimmt oft eine Außenseiterrolle ein, da es größere Schwierigkeiten hat, Souveränitätsrechte an die supranationale Union abzutreten.
Welche Verträge waren entscheidend für die Integration?
Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Beiträge der Länder zu den Vertragsverhandlungen von Maastricht und Amsterdam.
Welche Rolle spielten Politiker wie Kohl und Mitterrand?
Sie gelten als Motoren der Integration, die nationale Interessen mit dem Ziel einer tiefergehenden europäischen Gemeinschaft zu vereinbaren suchten.
Ist die europäische Integration laut Fazit vorteilhaft?
Ja, die Arbeit beantwortet die Frage positiv, da die Integration bisher nachweislich den Bedürfnissen der Länder entsprochen und konkrete Vorteile gebracht hat.
- Quote paper
- Hendrik M. Buurman (Author), 2000, Deutschland, Frankreich und Großbritannien in der EU - Garanten für eine stabile europäische Zukunft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3102