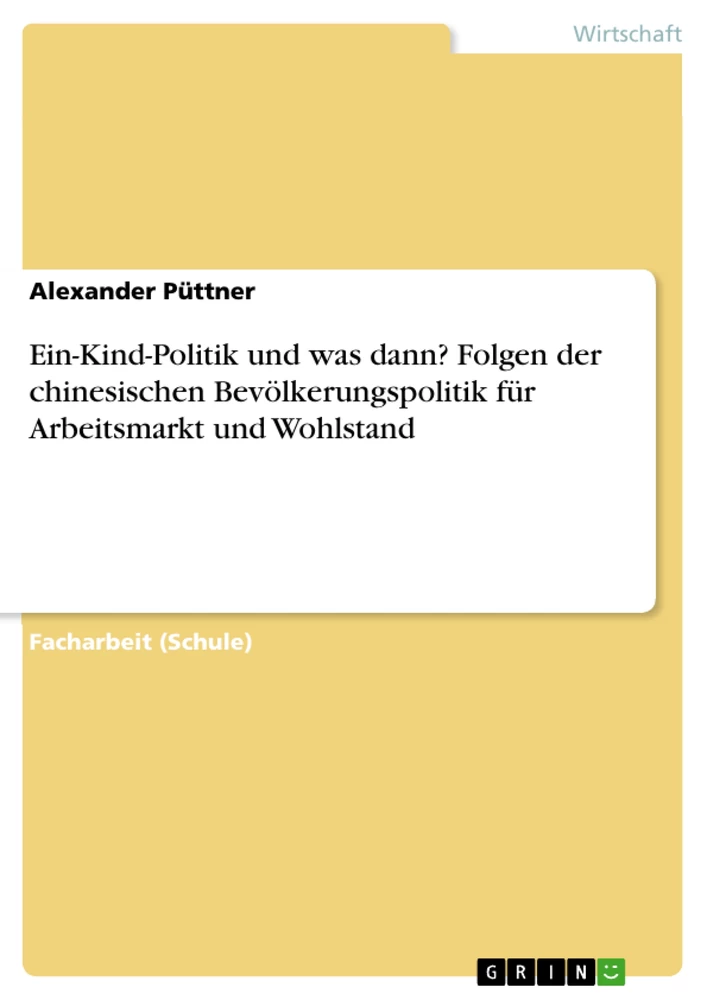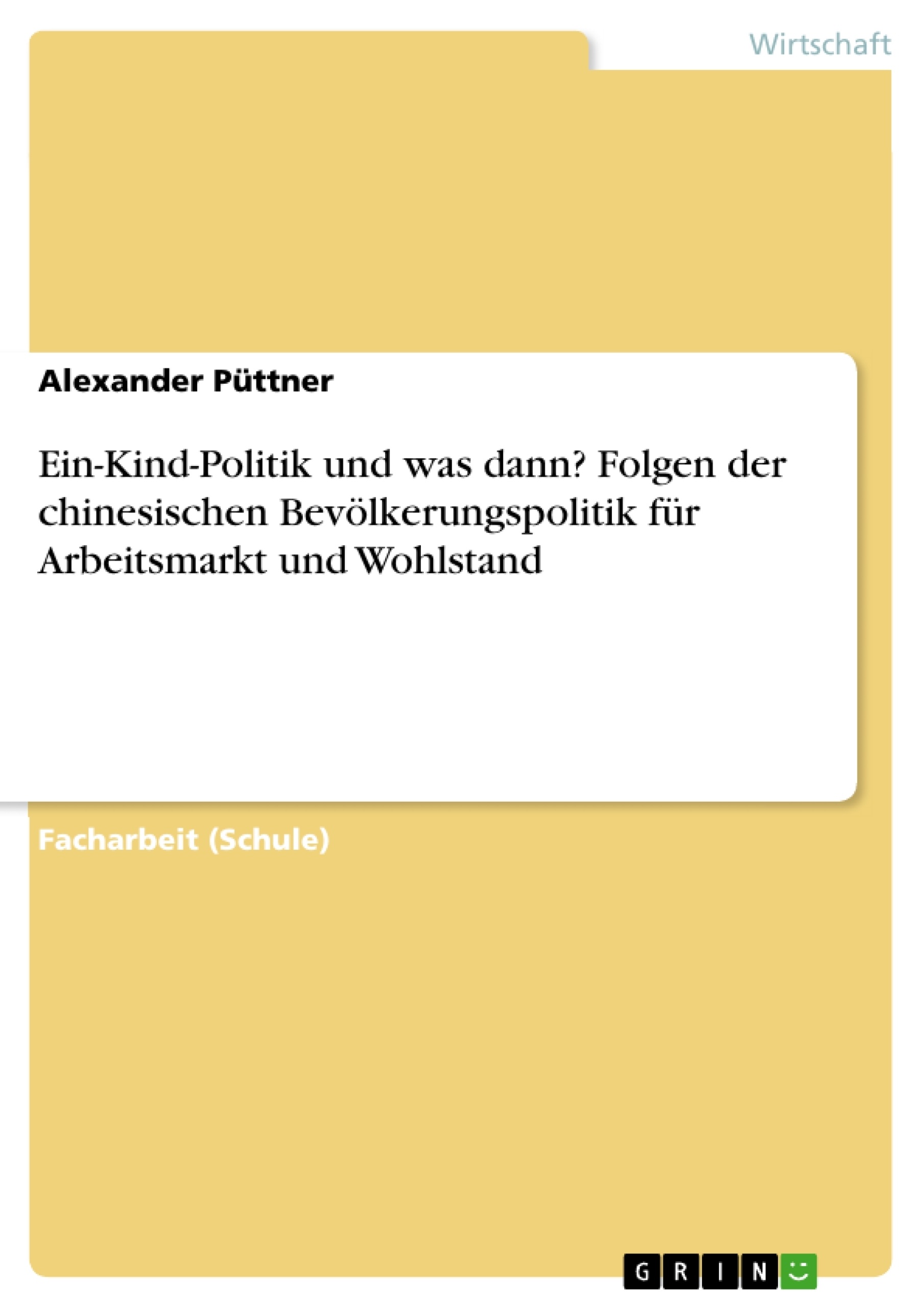Chinas Population wuchs von 582 Millionen in 1953 auf knapp über eine Milliarde in 1982. Experten prophezeiten Überbevölkerung, Hungersnöte und Aufstände. Um diese Entwicklung aufzuhalten wurde 1979 die Ein-Kind-Politik eingeführt. Nach über drei Jahrzehnten beschloss die Regierung nun, Ende Oktober 2015, die selbige aufzugeben und jeder Frau zwei Kinder zu erlauben.
Was ist also in der Zwischenzeit geschehen? Zum einen hat sich die durchschnittliche Kinderzahl von 6 Kindern pro Frau auf eine Fertilitätsrate von 1,55 verringert. Zum anderen ist China älter geworden. Etwa 30% der 1,3 Milliarden Einwohner sind über 50 Jahre alt. China erlebt nun den demographischen Wandel.
Neben den weitreichenden sozialen Problemen, die auf die Ein-Kind-Politik zurückzuführen sind, sind auch die Folgen für die chinesische Wirtschaft bedeutend und beginnen sich nun zu zeigen. Die Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter sank 2012 erstmals um etwa 3 Millionen und läutete somit eine Wende auf dem chinesischen Arbeitsmarkt ein.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Bevölkerungspolitik im Extremen: Die Ein-Kind-Politik
- 2 Die Ein-Kind-Politik: Hintergründe und Durchführung
- 2.1 Anfänge der Ein-Kind Politik und ihre Vorgänger
- 2.2 Mechanismen der Ein-Kind-Politik
- 2.2.1 Kontrazeptiva, Sterilisation und Abtreibungen
- 2.2.2 Materielle Anreize und Sanktionen
- 3 Demographische Auswirkungen
- 3.1 Geburten
- 3.2 Veränderungen in der Geschlechterstruktur
- 3.3 Veränderungen in der Altersstruktur
- 4 Folgen für Arbeitsmarkt und Wohlstand
- 4.1 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
- 4.2 Auswirkungen auf den Wohlstand
- 5 Abschaffung der Ein-Kind-Politik - Chinas Antwort auf die Frage „Und was dann?"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Seminararbeit befasst sich mit der Ein-Kind-Politik in China und ihren Folgen für den Arbeitsmarkt und den Wohlstand. Sie analysiert die Hintergründe und die Durchführung dieser Politik und untersucht die demographischen Auswirkungen sowie die Veränderungen in der Alters- und Geschlechterstruktur.
- Die Ein-Kind-Politik als Maßnahme zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums
- Die Auswirkungen der Ein-Kind-Politik auf die demographische Entwicklung Chinas
- Die Folgen für den chinesischen Arbeitsmarkt im Kontext einer alternden Bevölkerung
- Die Herausforderungen für den Wohlstand und das Sozialsystem Chinas
- Die Abschaffung der Ein-Kind-Politik und ihre potentiellen Folgen für die Zukunft Chinas
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel befasst sich mit der Ein-Kind-Politik als Extremform der Bevölkerungspolitik und stellt sie in den Kontext der demographischen Herausforderungen, die sowohl China als auch Deutschland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erwarten. Es beschreibt die Entwicklung der Bevölkerungspolitik in China und beleuchtet den Hintergrund der Ein-Kind-Politik. Das zweite Kapitel analysiert die verschiedenen Mechanismen der Ein-Kind-Politik, darunter Kontrazeptiva, Sterilisation, Abtreibungen, materielle Anreize und Sanktionen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den demographischen Auswirkungen der Ein-Kind-Politik, insbesondere auf die Geburtenrate, die Geschlechterstruktur und die Altersstruktur der chinesischen Bevölkerung. Das vierte Kapitel untersucht die Folgen der Ein-Kind-Politik für den chinesischen Arbeitsmarkt und den Wohlstand. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch eine alternde Bevölkerung und eine schrumpfende Anzahl an Arbeitskräften ergeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Ein-Kind-Politik in China und ihren Folgen für den Arbeitsmarkt und den Wohlstand. Sie behandelt die Themen Geburtenkontrolle, Bevölkerungspolitik, demographischer Wandel, Altersstruktur, Geschlechterstruktur, Arbeitsmarkt, Wohlstand, soziale Folgen, wirtschaftliche Folgen und die Abschaffung der Ein-Kind-Politik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde in China die Ein-Kind-Politik eingeführt?
Sie wurde 1979 eingeführt, um ein extremes Bevölkerungswachstum zu stoppen, das Experten zufolge zu Hungersnöten, Überbevölkerung und sozialen Unruhen geführt hätte.
Welche demographischen Folgen hatte diese Politik?
Die Fertilitätsrate sank massiv auf ca. 1,55 Kinder pro Frau. Dies führte zu einer schnellen Überalterung der Gesellschaft und einem Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern.
Wie wirkt sich die Politik auf den heutigen Arbeitsmarkt aus?
Seit 2012 sinkt die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter. Dieser Arbeitskräftemangel stellt eine große Herausforderung für das wirtschaftliche Wachstum Chinas dar.
Welche sozialen Mechanismen wurden zur Durchsetzung genutzt?
Die Regierung nutzte eine Kombination aus materiellen Anreizen, Sanktionen sowie drastischen Maßnahmen wie Zwangssterilisationen und Abtreibungen.
Wann wurde die Ein-Kind-Politik beendet?
Ende Oktober 2015 beschloss die chinesische Regierung die Aufgabe der Ein-Kind-Politik und erlaubte fortan jedem Paar zwei Kinder.
Was bedeutet der demographische Wandel für Chinas Wohlstand?
Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung muss für immer mehr Senioren aufkommen. Dies belastet das Sozialsystem und gefährdet die langfristige Steigerung des allgemeinen Wohlstands.
- Quote paper
- Alexander Püttner (Author), 2015, Ein-Kind-Politik und was dann? Folgen der chinesischen Bevölkerungspolitik für Arbeitsmarkt und Wohlstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310348