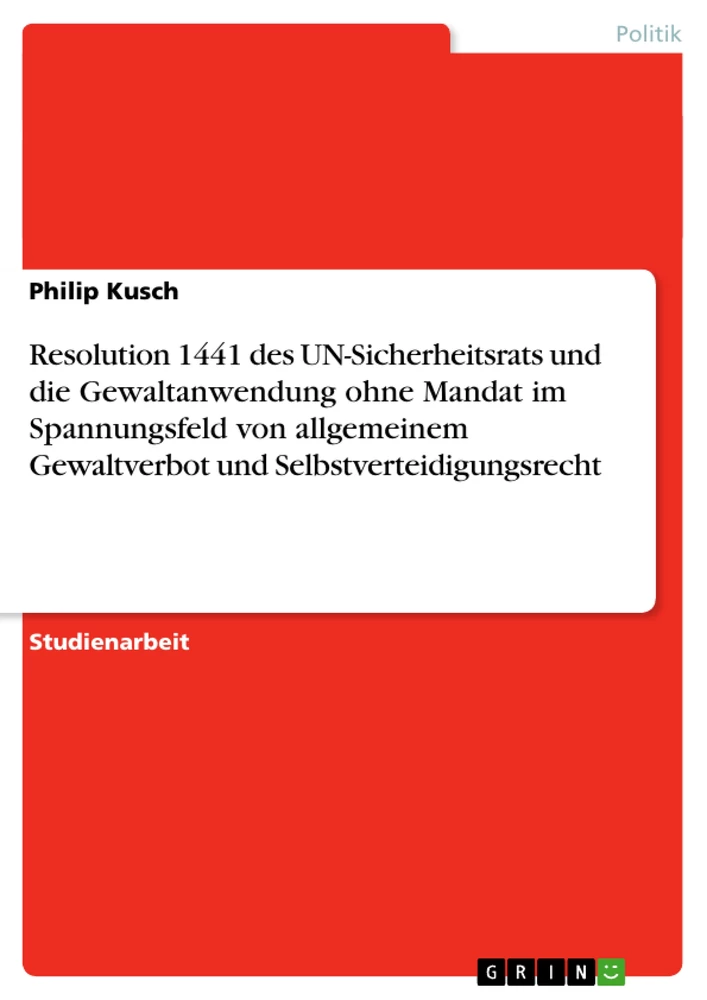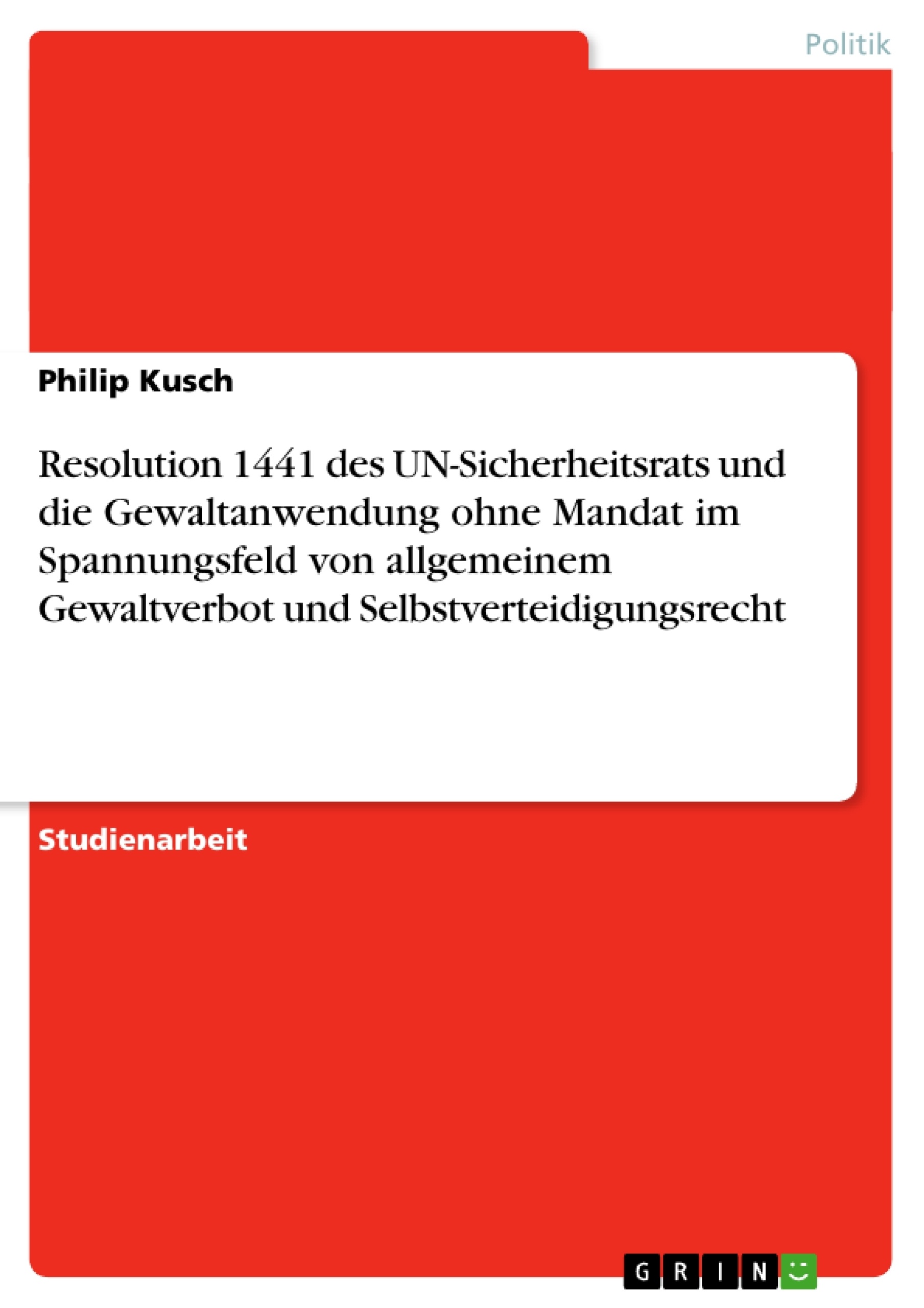Einleitung und Fragestellung
Die Resolution 1441 war der letzte Versuch, mit nichtmilitärischen Mitteln und einem multilateralen Vorgehen im Rahmen der Vereinten Nationen die jüngste Krise um den Irak zu lösen. Die Entwicklung hat gezeigt, dass dies nicht gelungen ist, der Irak wurde durch einen Krieg entwaffnet, der Regimewechsel mit Gewalt herbeigeführt. Im Rahmen der Geschehnisse kamen verschiedenste Fragen auf: Ließ sich aus Resolution 1441 eine Kriegslegitimation ableiten? Haben die USA ihre Doktrin der vorbeugenden Selbstverteidigung wie sie in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie niedergelegt ist tatsächlich angewendet und was würde dies für das Völkerrecht im allgemeinen und das Gewaltverbot im Rahmen der UN-Charta im speziellen bedeuten? Und was sind die Aussichten für die schon des öfteren für irrelevant erklärten oder gar totgesagten Vereinten Nationen? Mit diesen Fragen möchte ich mich in der hier vorgelegten Arbeit beschäftigen. Nach einer kurzen Darstellung der Vorgeschichte von Resolution 1441 folgt eine detaillierte Wortlautanalyse der Resolution sowie die Analyse der Reaktionen auf ihre Verabschiedung. Im weiteren Teil wird die Argumentation der Kriegsalliierten Amerika und Großbritannien beleuchtet und die Bedeutung dieser Argumentation für das System der kollektiven Sicherheit und den Bestand des völkerrechtlichen Gewaltverbotes erörtert. Im Schlussteil folgt neben einem kurzem Fazit ein Ausblick auf die Zukunft der Vereinten Nationen im Hinblick auf die bearbeiteten Fragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Vorgeschichte und Konstellation im Sicherheitsrat vor der Resolution 1441
- 2.1 Frankreich, Russland, China
- 2.2 USA und Großbritannien
- 3. Resolution 1441: Herausarbeitung und Interpretation der wichtigen Artikel und ihrer Zusammenhänge
- 4. Reaktionen auf Resolution 1441
- 5. Die Folgen von Resolution 1441 – Die Argumentation der Kriegsalliierten
- 5.1 Großbritannien
- 5.2 USA
- 6. Auswirkungen auf das System der kollektiven Sicherheit und den Bestand des völkerrechtlichen Gewaltverbots
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Resolution 1441 des UN-Sicherheitsrates und die darauf folgende militärische Intervention im Irak. Sie analysiert, ob die Resolution eine Kriegslegitimation beinhaltete, die Rolle der vorbeugenden Selbstverteidigung und die Konsequenzen für das völkerrechtliche Gewaltverbot und das System der kollektiven Sicherheit.
- Interpretation von Resolution 1441
- Rolle der vorbeugenden Selbstverteidigung
- Positionen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates
- Auswirkungen auf das System der kollektiven Sicherheit
- Zukunft der Vereinten Nationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Legitimität des Irakkrieges im Kontext der Resolution 1441. Sie skizziert die Problematik der Anwendung der Doktrin der vorbeugenden Selbstverteidigung und untersucht die Folgen für das Völkerrecht und die Vereinten Nationen. Die Arbeit kündigt eine detaillierte Analyse der Resolution, der Reaktionen darauf und der Argumentationen der Kriegsalliierten an, um die Auswirkungen auf das internationale Sicherheitssystem zu beleuchten.
2. Vorgeschichte und Konstellation im Sicherheitsrat vor der Resolution 1441: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte des Irakkrieges, beginnend mit der irakischen Invasion Kuwaits 1990 und den darauf folgenden UN-Resolutionen. Es beschreibt die unterschiedlichen Positionen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates vor der Verabschiedung der Resolution 1441. Frankreich und Russland positionierten sich kritisch gegenüber den USA und Großbritannien, während China eine abwartende Haltung einnahm. Die unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen der beteiligten Staaten werden detailliert dargestellt.
3. Resolution 1441: Herausarbeitung und Interpretation der wichtigen Artikel und ihrer Zusammenhänge: Dieses Kapitel analysiert den Wortlaut der Resolution 1441 detailliert. Es hebt wichtige Artikel hervor und interpretiert deren Zusammenhänge im Kontext der vorherigen Resolutionen, insbesondere Resolution 687. Die Analyse konzentriert sich auf die Interpretationsspielräume und die unterschiedlichen Lesarten der Resolution, die zu den gegensätzlichen Reaktionen führten. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Resolution eine Legitimation für den Einsatz militärischer Gewalt enthielt.
4. Reaktionen auf Resolution 1441: Dieses Kapitel untersucht die Reaktionen auf die Verabschiedung der Resolution 1441. Es analysiert die unterschiedlichen Interpretationen und die daraus resultierenden politischen und diplomatischen Bemühungen. Die Reaktionen der beteiligten Staaten und internationaler Organisationen werden detailliert betrachtet, um ein umfassendes Bild der internationalen Reaktion zu schaffen. Die unterschiedlichen Standpunkte bezüglich der Auslegung der Resolution werden präsentiert.
5. Die Folgen von Resolution 1441 – Die Argumentation der Kriegsalliierten: Dieses Kapitel analysiert die Argumentationen der USA und Großbritanniens zur Rechtfertigung ihres militärischen Vorgehens gegen den Irak. Es beleuchtet die unterschiedlichen Schwerpunkte der beiden Länder und ihre jeweilige Interpretation von Resolution 1441. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die beiden Länder die Resolution zur Unterstützung ihres militärischen Vorgehens nutzten und welche rechtlichen und politischen Begründungen sie hierfür anführten.
6. Auswirkungen auf das System der kollektiven Sicherheit und den Bestand des völkerrechtlichen Gewaltverbots: Dieses Kapitel erörtert die Folgen des Irakkrieges für das System der kollektiven Sicherheit und das völkerrechtliche Gewaltverbot. Es analysiert die Auswirkungen der militärischen Intervention auf die Autorität des UN-Sicherheitsrates und die Effektivität des internationalen Rechtssystems. Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen und die Debatte um die Legitimität des Einsatzes militärischer Gewalt ohne ein explizites Mandat des Sicherheitsrats.
Schlüsselwörter
Resolution 1441, Irak-Krieg, UN-Sicherheitsrat, Gewaltverbot, Selbstverteidigungsrecht, kollektive Sicherheit, multilaterales Vorgehen, unilaterale Intervention, Völkerrecht, Internationale Beziehungen, vorbeugende Selbstverteidigung, USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Resolution 1441 des UN-Sicherheitsrates und des Irakkrieges
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Resolution 1441 des UN-Sicherheitsrates und die darauffolgende militärische Intervention im Irak. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Resolution eine Legitimation für den Krieg darstellte, der Rolle der vorbeugenden Selbstverteidigung und den Konsequenzen für das völkerrechtliche Gewaltverbot sowie das System der kollektiven Sicherheit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Interpretation der Resolution 1441, die Rolle der vorbeugenden Selbstverteidigung, die Positionen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates (insbesondere Frankreich, Russland, China, USA und Großbritannien), die Auswirkungen auf das System der kollektiven Sicherheit und die Zukunftsaussichten der Vereinten Nationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung und Fragestellung; Vorgeschichte und Konstellation im Sicherheitsrat vor der Resolution 1441; Resolution 1441: Herausarbeitung und Interpretation der wichtigen Artikel; Reaktionen auf Resolution 1441; Die Folgen von Resolution 1441 – Die Argumentation der Kriegsalliierten; Auswirkungen auf das System der kollektiven Sicherheit und den Bestand des völkerrechtlichen Gewaltverbots; Fazit und Ausblick.
Wie wird die Resolution 1441 analysiert?
Die Resolution 1441 wird detailliert analysiert, wobei wichtige Artikel hervorgehoben und deren Zusammenhänge im Kontext vorheriger Resolutionen (insbesondere Resolution 687) interpretiert werden. Die Analyse konzentriert sich auf Interpretationsspielräume und unterschiedliche Lesarten der Resolution, die zu gegensätzlichen Reaktionen führten. Die zentrale Frage ist, ob die Resolution eine Legitimation für den Einsatz militärischer Gewalt enthielt.
Welche Rolle spielte die präventive Selbstverteidigung?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Doktrin der vorbeugenden Selbstverteidigung im Kontext der Resolution 1441 und des Irakkrieges. Es wird analysiert, inwieweit diese Doktrin zur Rechtfertigung des militärischen Eingreifens herangezogen wurde.
Wie wurden die Positionen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die unterschiedlichen Positionen der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates vor und nach der Verabschiedung der Resolution 1441. Die unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen der beteiligten Staaten (Frankreich, Russland, China, USA und Großbritannien) werden detailliert dargestellt.
Welche Auswirkungen hatte der Irakkrieg auf das System der kollektiven Sicherheit und das Gewaltverbot?
Die Arbeit analysiert die Folgen des Irakkrieges für das System der kollektiven Sicherheit und das völkerrechtliche Gewaltverbot. Es werden die Auswirkungen der militärischen Intervention auf die Autorität des UN-Sicherheitsrates und die Effektivität des internationalen Rechtssystems untersucht. Die Debatte um die Legitimität des Einsatzes militärischer Gewalt ohne explizites Mandat des Sicherheitsrates wird beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Resolution 1441, Irak-Krieg, UN-Sicherheitsrat, Gewaltverbot, Selbstverteidigungsrecht, kollektive Sicherheit, multilaterales Vorgehen, unilaterale Intervention, Völkerrecht, Internationale Beziehungen, vorbeugende Selbstverteidigung, USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China.
- Citar trabajo
- Philip Kusch (Autor), 2004, Resolution 1441 des UN-Sicherheitsrats und die Gewaltanwendung ohne Mandat im Spannungsfeld von allgemeinem Gewaltverbot und Selbstverteidigungsrecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31043