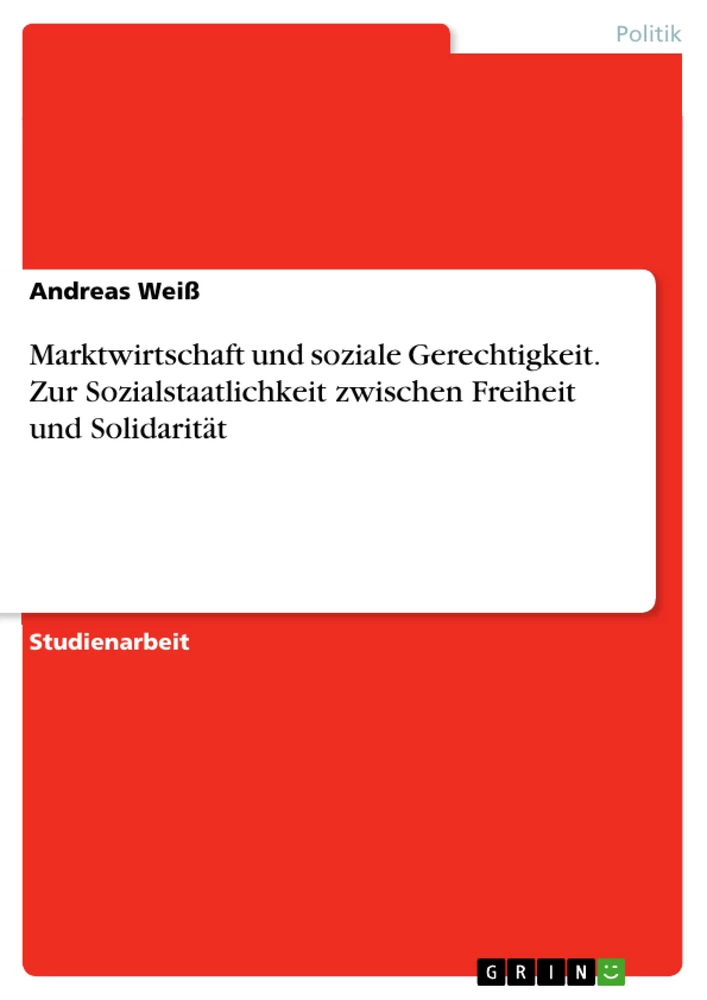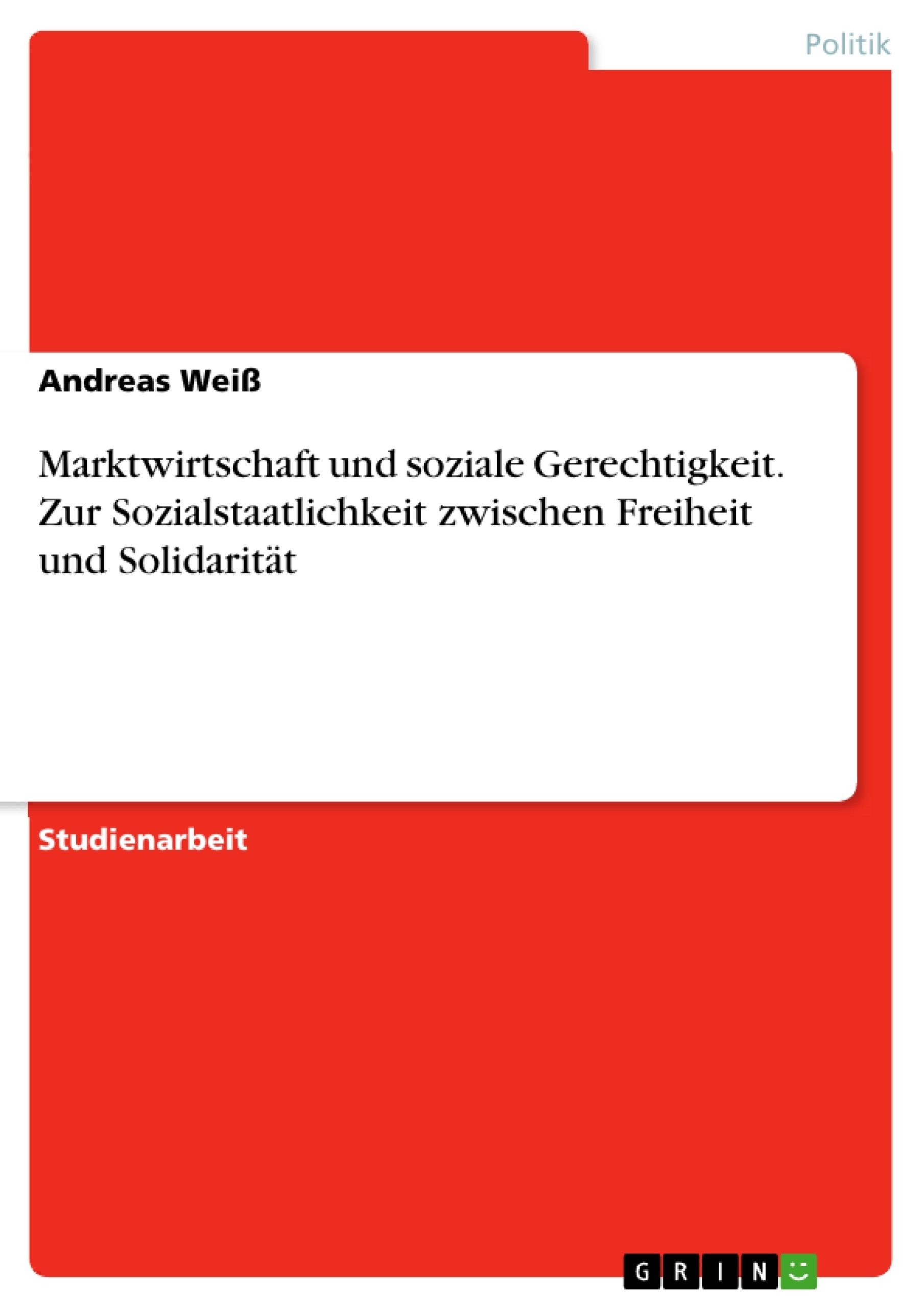Im Rahmen dieser Arbeit soll dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit Kontur und Inhalt verliehen sowie nach der konkreten Umsetzbarkeit gefragt werden. Eine nachhaltige Reform des Sozialstaats erfordert regulative Ideen der sozialen Gerechtigkeit, die unabhängig von kurzfristiger Effizienz und Demoskopie Wege zeichnen sollen für einen erfolgreichen Umbau auf einer konsistenten Basis zwischen Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.
Gesucht sind also nicht nur rein philosophische Verhältnisse zwischen begrifflichen Ideen, sondern auch exemplarische Modelle, die auf einem solchen begründet sind. Es geht nicht mehr nur darum, was wir wollen sollen, sondern ob unser Sollen auch Können impliziert. Diese Fragestellung soll hier anhand folgender These analysiert werden: Damit Marktwirtschaft und soziale Gerechtigkeit Eckpfeiler des demokratischen Sozialstaats bilden können, bedarf es einer Symbiose von Freiheit und Solidarität, welche das Wirkungskonzept der Gleichheit auf die Verhinderung von Chancenlosigkeit richtet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Zur Präzisierung des Gerechtigkeitsbegriffes
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Soziale Gerechtigkeit
- 1.2.1 Neid und Gerechtigkeit
- 1.2.2 Bedeutung sozialer Gerechtigkeit
- 1.2.3 Systematisierung sozialer Gerechtigkeit
- 2 Zur Legitimation des Sozialstaats
- 2.1 Rationalität
- 2.2 Daseinsfürsorge
- 2.3 Reale Freiheit
- 3 Zur Modalität der Sozialstaatlichkeit
- 3.1 Verteilungsgerechtigkeit
- 3.1.1 Zwischen Freiheit und Gleichheit
- 3.1.2 Zwischen Vergleich und Begehrlichkeit
- 3.2 Solidarität
- 3.3 Moralische Intuition
- 3.4 Demokratie und politische Kultur
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit im Kontext des demokratischen Sozialstaats. Die Hauptaufgabe besteht darin, den Begriff der sozialen Gerechtigkeit zu präzisieren und zu analysieren, inwieweit der Sozialstaat aus der Vernunft und der Perspektive der Freiheit gerechtfertigt werden kann. Darüber hinaus wird die Art der Sozialstaatlichkeit im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit, Solidarität, moralische Intuition und politische Kultur untersucht.
- Die Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit in einer sich verändernden Gesellschaft
- Die Legitimation des Sozialstaates aus der Sicht der Vernunft und der Freiheit
- Die Rolle von Verteilungsgerechtigkeit und Solidarität im Sozialstaat
- Der Einfluss von moralischer Intuition und politischer Kultur auf die Gestaltung des Sozialstaates
- Das Spannungsverhältnis zwischen Marktwirtschaft und Sozialstaatlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1 analysiert den Begriff der sozialen Gerechtigkeit unter empirischen und theoretischen Gesichtspunkten. Es werden verschiedene Gerechtigkeitskonzeptionen vorgestellt und die Bedeutung des Gerechtigkeitsbegriffes in der heutigen Gesellschaft diskutiert.
- Kapitel 2 befasst sich mit der Legitimation des Sozialstaates. Es wird untersucht, ob sich ein soziales Sicherungssystem aus der Vernunft rechtfertigen lässt und welche Rolle die Freiheit in diesem Zusammenhang spielt.
- Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Aspekte der Sozialstaatlichkeit, darunter Verteilungsgerechtigkeit, Solidarität, moralische Intuition und politische Kultur. Die Kapitel analysieren, wie diese Elemente den Sozialstaat beeinflussen und prägen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen soziale Gerechtigkeit, Marktwirtschaft, Sozialstaatlichkeit, Freiheit, Gleichheit, Verteilungsgerechtigkeit, Solidarität, moralische Intuition und politische Kultur. Sie untersucht das Spannungsverhältnis zwischen diesen Begriffen und analysiert die Möglichkeit einer Symbiose zwischen Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit im Rahmen des demokratischen Sozialstaats.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert sich soziale Gerechtigkeit im modernen Sozialstaat?
Soziale Gerechtigkeit wird als Symbiose von Freiheit und Solidarität verstanden, wobei Gleichheit primär auf die Verhinderung von Chancenlosigkeit ausgerichtet sein sollte.
Wie lässt sich der Sozialstaat philosophisch legitimieren?
Die Legitimation erfolgt aus der Vernunft und der Daseinsfürsorge, um „reale Freiheit“ für alle Bürger zu ermöglichen, unabhängig von ihrer ökonomischen Ausgangslage.
Was ist der Unterschied zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Neid?
Die Arbeit präzisiert den Gerechtigkeitsbegriff und grenzt ihn von bloßer Begehrlichkeit ab, indem sie objektive Kriterien der Teilhabe und Fairness in den Fokus rückt.
Welche Rolle spielt die Solidarität in der Marktwirtschaft?
Solidarität dient als notwendiges Korrektiv zum Marktwettbewerb, um den sozialen Zusammenhalt und die Stabilität der demokratischen Grundordnung zu sichern.
Kann der Sozialstaat nachhaltig reformiert werden?
Nachhaltige Reformen erfordern laut These regulative Ideen, die über kurzfristige Effizienz hinausgehen und eine konsistente Basis zwischen Freiheit und Gleichheit schaffen.
- Quote paper
- Andreas Weiß (Author), 2007, Marktwirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Zur Sozialstaatlichkeit zwischen Freiheit und Solidarität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310546