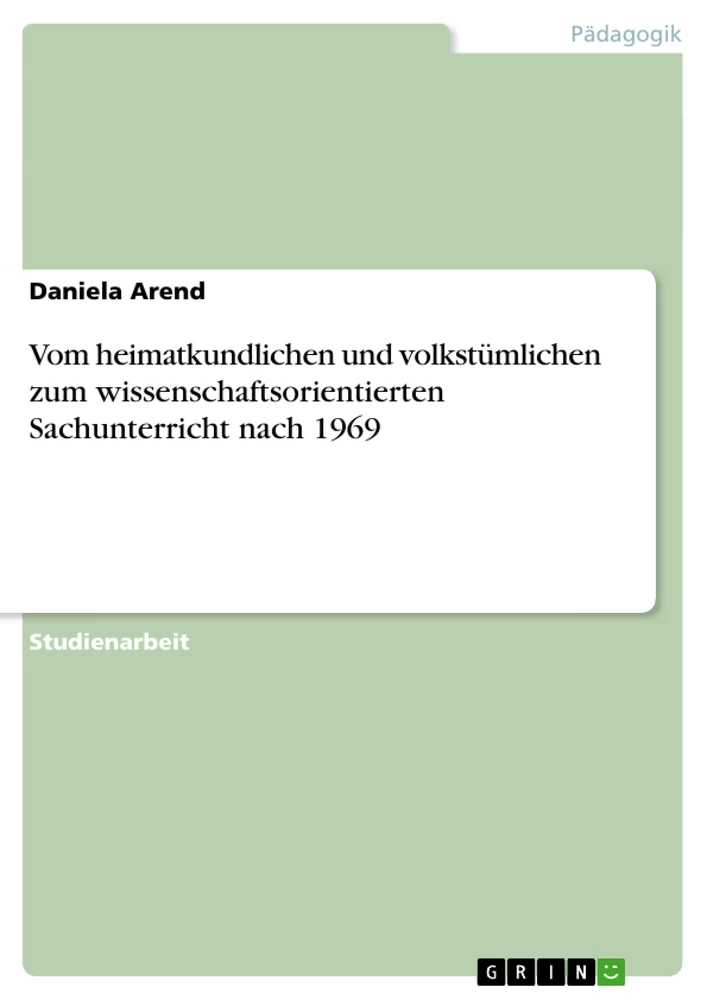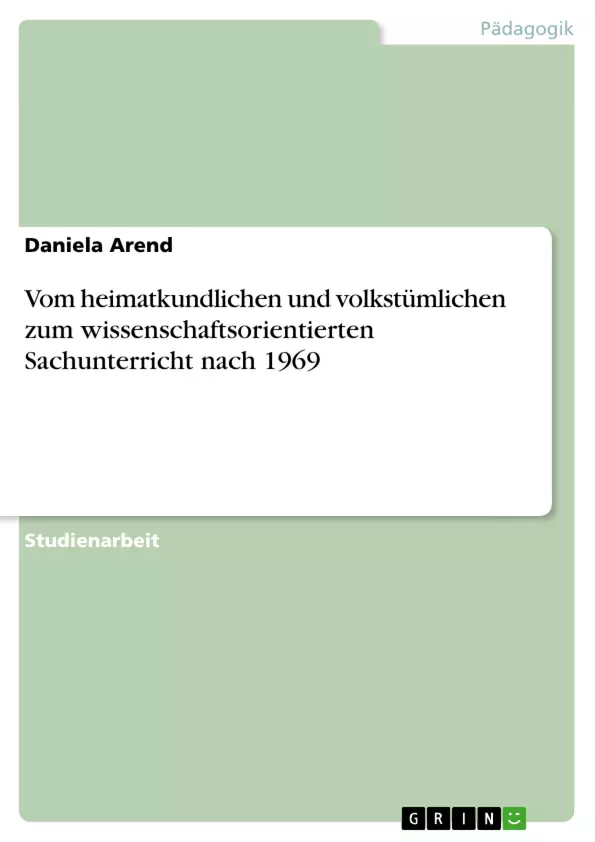Auflistung einiger Definitionsansätze
„Grundschulsachkunde ist nicht ungefächerter Integrationsunterricht, ist aber auch noch nicht Fachunterricht, er ist Propädeutik des nachfolgenden Fächerunterrichts.“ (Kopp, 1970 c, Seite 169) „Sachunterricht… ein situationsgemäßes, lernzielorientiertes und damit fachspezifisches Lehren und Lernen, und dies auf der Grundlage anschaulich konkreter Unterrichtsthemen.“ (Kopp, 1972, Seite 15) „Der Sachunterricht der Grundschule führt die Kinder zu sachgemäßer Auseinandersetzung mit den Gegenständen ihres Erfahrungsraumes. Dabei weckt er ihr Interesse für fachlich ausgerichtete Fragestellungen und schafft die Voraussetzungen für den gefächerten Sachunterricht der weiterführenden Schulen.“ (Kopp, 1972, Seite 15, nach Kitzinger u. a., 1972- 73, Seite 205; zitiert nach Mitzlaff, 1985, Seite 1185) „Sachunterricht ist ein wiss. strukturierter Unterricht, der den Gewinn fachlicher Ordnungssysteme anstrebt und den Heimatkundeunterricht der Grundschule abgelöst hat. Der S. bezieht seine Inhalte aus der Erdkunde, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte und Verkehrserziehung. Die Gefahr des S.s. liegt darin, daß die Frage nach kindgemäßen Stoffen hinter die strukturspezifischen Grundgedanken der einzelnen Wissenschaften zurücktritt.“ (Böhm, 1982)
Inhaltsverzeichnis
- Was ist und was soll Sachunterricht?
- Auflistung einiger Definitionsansätze
- Was sagt der Strukturplan für das Bildungswesen von 1970 zum Sachunterricht?
- Was sagt die Kultusministerkonferenz von 1970 zum Sachunterricht?
- Die Ablösung der Heimatkunde und die Entwicklung eines neuen Sachunterrichts in einer veränderten Grundschule 1969- 1984
- Wie kam es zur Ablösung der Heimatkunde durch den Sachunterricht?
- Die Unterschiede zwischen Heimatkunde und Sachunterricht
- Nähere Erläuterungen einiger Aspekte des Sachunterrichts
- Welche Veränderungen mussten zur Umsetzung eines wissenschaftsorientierten Sachunterrichts vorgenommen werden?
- Wissenschaftsorientierter oder kindorientierter Sachunterricht?
- Vom geschlossenen Curriculum zum offenen Unterricht
- Was ist, entdeckendes Lernen’?
- Integration statt Aufsplitterung
- Vom einseitig kognitiven zu einem mehrdimensionalen persönlichkeitsintegrativen Ansatz
- Theorie der individuellen Optimalförderung im Sachunterricht
- Anlage oder Umwelteinfluss?
- Begabung durch Lernen
- Reifen und Lernen
- gezielte Bildungsförderung
- optimale Passung
- Jean Piagets Bedeutung für die Sachunterrichtsdidaktik
- Stufen der kognitiven Entwicklung
- Stufen der moralischen Entwicklung
- Altersplacierung sachunterrichtlicher Lernziele
- Förderung der Lernmotivation
- lebenslanges Lernen
- Sachunterricht und die kindlichen Bedürfnisse
- Konzeptionen des Sachunterrichts
- strukturorientierter Sachunterricht - Kay Spreckelsen
- verfahrensorientierter Sachunterricht - Göttinger Arbeitsgruppe um Hans Tütken
- mehrperspektivischer Sach- und Grundschulunterricht- Reutlinger CIEL- Gruppe
- situationsorientierter Sachunterricht
- genetischer Sachunterricht - Martin Wagenschein u. a.
- generativer Sachunterricht - Ulrich Fiedler
- Dortmunder Modell einer Bereichsdidaktik für den naturwissenschaftlich-mathematischen Grundschulunterricht und einer bereichsdidaktischen Lehrerausbildung - Wolfram Winnenburg
- Ansätze zu einem,schülerorientierten' Sachunterricht - Jürgen Ziechmann und die Projektgruppe der Universität Bremen
- Ansätze zu einem aspekt- komplementären naturwissenschaftlich-technischen Sachunterricht - Essener Arbeiten von Soostmeyer u. a.
- eigene Stellungnahme und kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Sachunterrichts in Deutschland nach 1969, speziell mit der Ablösung der Heimatkunde und der Einführung eines wissenschaftsorientierten Ansatzes. Dabei werden die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen in der Grundschule im Zeitraum von 1969 bis 1984 beleuchtet.
- Die Ablösung der Heimatkunde durch den Sachunterricht
- Die Entwicklung des wissenschaftsorientierten Sachunterrichts
- Die Relevanz der individuellen Förderung im Sachunterricht
- Die verschiedenen Konzeptionen des Sachunterrichts
- Eine kritische Betrachtung des Sachunterrichts im Kontext der aktuellen Bildungslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Definition und die Zielsetzung des Sachunterrichts und betrachtet verschiedene Definitionsansätze sowie die Rolle des Sachunterrichts im Bildungswesen der 1970er Jahre. Der Fokus liegt dabei auf der Einordnung des Sachunterrichts im Strukturplan des Bildungswesens von 1970 und den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz.
Das zweite Kapitel untersucht die Ablösung der Heimatkunde durch den Sachunterricht und die Entstehung eines neuen Sachunterrichtskonzeptes in der Grundschule. Es werden die Unterschiede zwischen Heimatkunde und Sachunterricht, die wichtigsten Veränderungen und Entwicklungen in den Unterrichtsinhalten sowie die Umgestaltung des Curriculums beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Bedeutung der individuellen Optimalförderung im Sachunterricht. Es werden verschiedene Theorien zur Förderung von Begabung und Lernen sowie die Relevanz von Jean Piagets Erkenntnissen zur kognitiven und moralischen Entwicklung in der Sachunterrichtsdidaktik diskutiert.
Das vierte Kapitel stellt verschiedene Konzeptionen des Sachunterrichts vor, die sich in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt haben. Hier werden die Ansätze von Kay Spreckelsen, Hans Tütken, der Reutlinger CIEL- Gruppe, Martin Wagenschein, Ulrich Fiedler, Wolfram Winnenburg, Jürgen Ziechmann, und Soostmeyer u. a. erläutert.
Schlüsselwörter
Sachunterricht, Heimatkunde, Wissenschaftsorientierung, Individualförderung, Unterrichtskonzeptionen, Didaktik, Strukturplan des Bildungswesens, Kultusministerkonferenz, Curriculum, Entdeckendes Lernen, Grundschule, Jean Piaget, Bildungslandschaft, 1969, 1970, 1984.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich der Sachunterricht von der früheren Heimatkunde?
Der Sachunterricht nach 1969 löste die volkstümliche Heimatkunde ab und setzte auf Wissenschaftsorientierung, fachspezifische Fragestellungen und die Vorbereitung auf weiterführende Schulen.
Was bedeutet „wissenschaftsorientierter Sachunterricht“?
Es ist ein Unterricht, der Inhalte aus Wissenschaften wie Biologie, Physik, Chemie und Geschichte bezieht und fachliche Ordnungssysteme anstrebt, anstatt nur lokale Heimatthemen zu behandeln.
Welche Rolle spielt Jean Piaget für die Sachunterrichtsdidaktik?
Piagets Stufenmodell der kognitiven Entwicklung half dabei, Lernziele altersgerecht zu platzieren und den Unterricht an die kognitiven Fähigkeiten der Kinder anzupassen.
Was versteht man unter „entdeckendem Lernen“ im Sachunterricht?
Es ist ein Ansatz, bei dem Kinder durch eigenes Experimentieren und Forschen Zusammenhänge begreifen, anstatt Wissen nur passiv aufzunehmen.
Welche verschiedenen Konzeptionen des Sachunterrichts gab es?
Es entwickelten sich verschiedene Ansätze, darunter der strukturorientierte, verfahrensorientierte, vielperspektivische und der genetische Sachunterricht (z.B. nach Martin Wagenschein).
Was forderte der Strukturplan für das Bildungswesen von 1970?
Der Strukturplan sah den Sachunterricht als Propädeutik (Vorbereitung) für den späteren Fachunterricht und forderte eine systematische Einführung in wissenschaftliche Denkweisen.
- Quote paper
- Daniela Arend (Author), 2003, Vom heimatkundlichen und volkstümlichen zum wissenschaftsorientierten Sachunterricht nach 1969, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31062