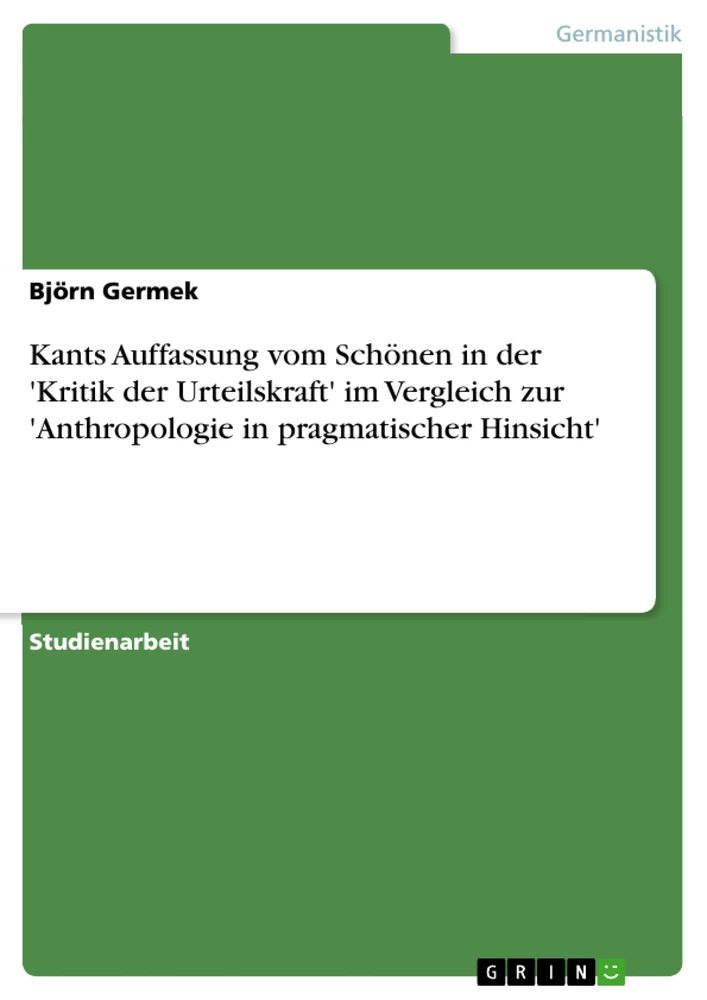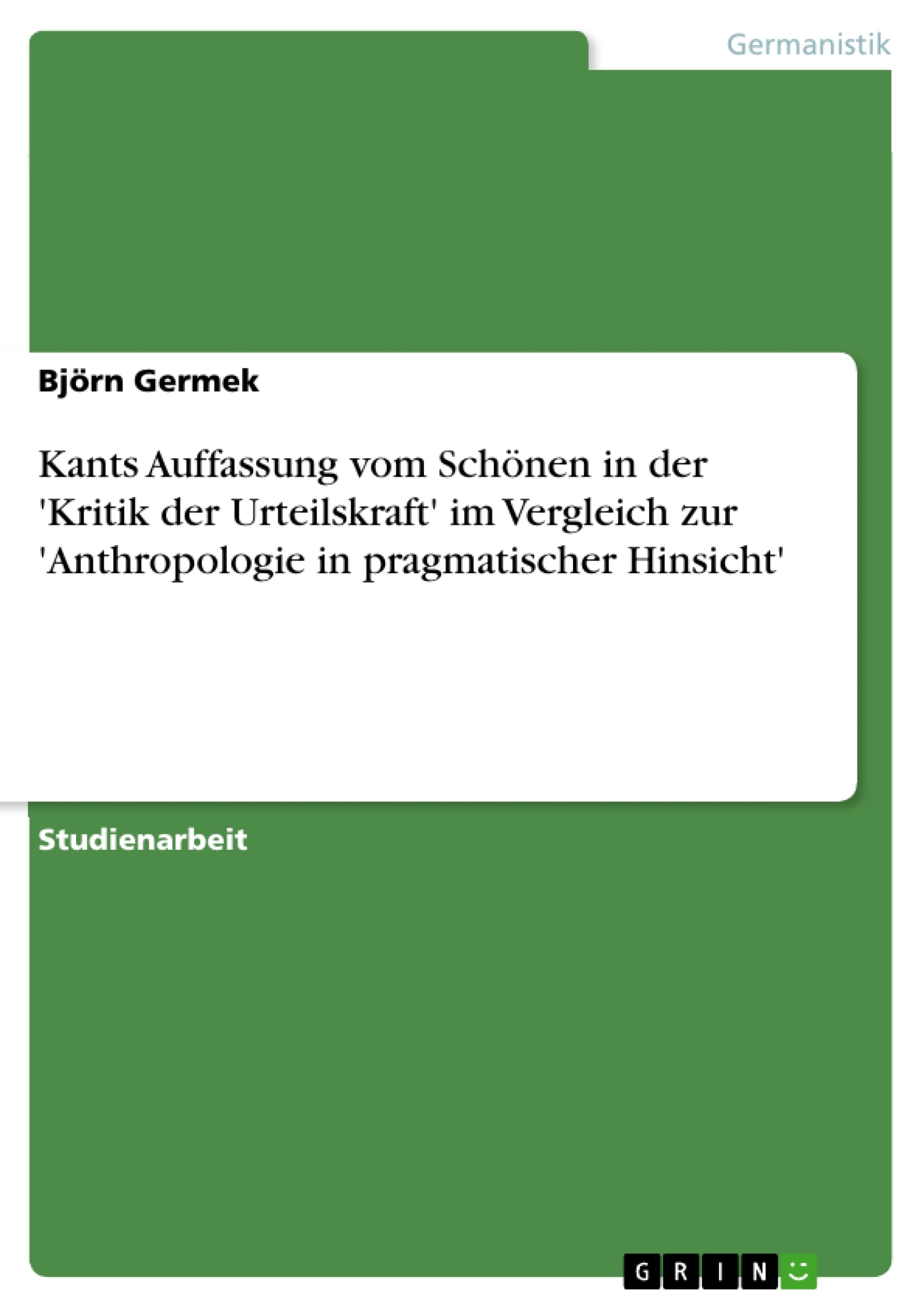Einleitung
Auf die Frage nach der Funktion des Schönen läßt sich mit dem Gefühl beim Anblick desselben antworten: Lust. Lust trägt dazu bei, sich mit etwas zu unterhalten. Wenn ein Gegenstand oder eine Beschäftigung keine Lust entstehen läßt, legt man diesen für gewöhnlich zur Seite und beschäftigt sich mit unterhaltenden Dingen. Je mehr etwas gefällt, desto kürzer wird die Zeit, in der man sich damit befaßt und umgekehrt. Man darf demnach, ganz im Sinne von Kants ‘Anthropologie’, davon ausgehen, daß der Zweck von Schönheit die Verkürzung der Zeit aber auch die Vergemeinschaftung ist. Denn Kant zielt ja in seiner ‘Anthropologie in pragmatischer Hinsicht’ in erster Linie nicht darauf ab, Schönheit zu definieren sondern klarzustellen, wohin die schöne, fortschreitende Kultur die Menschheit führen soll: die Menschen sollen, als „vernünftige Wesen” das Übel, daß sie sich selber antun, spüren und erkennen, daß sie „den Privatsinn (einzelner) dem Gemeinsinn (aller vereinigt)” opfern müssen.1 Die Schönheit, insbesondere die schöne Kunst, hat in dieser Philosophie eindeutig einen ganz bestimmten Zweck.
Allerdings ist die ‘Anthropologie’ bekanntermaßen nicht Kants einzige Abhandlung über das Thema Schönheit. Hält man die ‘Kritik der Urteilskraft’ entgegen, so stellt man fest, daß hier ganz entscheidende Unterschiede auftreten: an der Schönheit darf kein Interesse bestehen, und außerdem darf die Schönheit keinen konkreten Zweck erfüllen, man darf diesen Zweck nur ahnen: „Geschmack ist ein Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen oder Mißfallen ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön” und „Schönheit ist die Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird.”2
Der folgende Text erläutert die Folgen dieses Unterschiedes Interesse/Zweck - Interesselosigkeit/Zwecklosigkeit auf das weitgefächerte Thema der Unterhaltung mit Künsten.
[...]
_____
1.Oelmüller, Willi: Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798). In: Grundkurs philosophische Anthropologie. München (Fink) 1996; S. 114
2. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft [im folgenden: KdU].
Herausgegeben von Karl Vorländer. 6. Auflage, Reprint von 1924
(Philosophische Bibliothek, Band 39a). Hamburg (Meiner) 1959; S. 48 u. 77
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Sinn und die Vernunft
- Die Frage nach dem unterschiedlichen Geschmack
- Die andere Bedeutung von Langeweile
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert Kants Verständnis von Schönheit, wie es in der „Kritik der Urteilskraft" dargestellt wird, im Vergleich zu seiner „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht". Der Text untersucht die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Konzepte auf die Unterhaltung durch Kunst.
- Der Unterschied zwischen dem Interesse an Schönheit in der „Anthropologie" und der Desinteresselosigkeit an Schönheit in der „Kritik der Urteilskraft"
- Die Rolle der Vernunft und des Sinns in der Wahrnehmung von Schönheit
- Die Bedeutung von Raum und Zeit bei der Betrachtung von Kunstwerken
- Die Beziehung zwischen Anschauung, Verstand und Idee in der Entstehung von Geschmack
- Die Frage nach dem Urbild des Geschmacks
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Schönen ein und stellt die unterschiedlichen Konzepte von Schönheit in Kants „Anthropologie" und „Kritik der Urteilskraft" gegenüber.
2. Der Sinn und die Vernunft
Dieses Kapitel vergleicht die Ansätze von Vernunft und Sinn in beiden Werken, wobei die „Anthropologie" die Seelengüte als Zentrum für die Vereinigung von Zielen betont. Die „Kritik der Urteilskraft" hingegen betont die Desinteresselosigkeit an Schönheit und ihre Zwecklosigkeit.
3. Die Frage nach dem unterschiedlichen Geschmack
Das Kapitel behandelt den Unterschied zwischen Geschmack als ästhetischem und Verstandesurteil in der „Kritik der Urteilskraft". Es werden Beispiele für Kunstformen analysiert, die den Anforderungen der „Kritik der Urteilskraft" entsprechen, wie die bildende Kunst und Musik ohne Gesang.
4. Die andere Bedeutung von Langeweile
Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Raum und Zeit bei der Betrachtung von Kunstwerken. Es wird argumentiert, dass die reine Anschauung nicht ausreicht, um die Allgemeingültigkeit von Schönheit zu garantieren. Die „Kritik der Urteilskraft" führt das Konzept der Idee ein, die jeder in sich selbst hervorbringen muss, um Schönheit zu erkennen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Schönheit, „Kritik der Urteilskraft", „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht", Vernunft, Sinn, Geschmack, Interesse, Zwecklosigkeit, Anschauung, Idee, Urbild, Kunst, Unterhaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Kants "Kritik der Urteilskraft" und "Anthropologie"?
In der Anthropologie dient Schönheit einem Zweck (Vergemeinschaftung), während sie in der Kritik der Urteilskraft als "Zweckmäßigkeit ohne Zweck" und interesselos definiert wird.
Warum muss das Wohlgefallen am Schönen laut Kant "interesselos" sein?
Ein ästhetisches Urteil ist nur dann rein, wenn es nicht von persönlichen Bedürfnissen, Besitzwünschen oder moralischen Zwecken beeinflusst wird.
Welche Rolle spielt der Geschmack in der Wahrnehmung von Kunst?
Geschmack ist das Beurteilungsvermögen, das entscheidet, ob ein Gegenstand durch ein Wohlgefallen ohne alles Interesse als schön bezeichnet werden kann.
Was versteht Kant unter "Zweckmäßigkeit ohne Zweck"?
Schönheit wirkt auf uns so, als ob sie für unseren Verstand gemacht wäre (zweckmäßig), ohne dass wir ihr eine konkrete Funktion oder Absicht zuschreiben können.
Wie hängen Raum und Zeit mit der Kunstbetrachtung zusammen?
Der Text untersucht, wie die reine Anschauung in Raum und Zeit durch die Vernunft und Ideen ergänzt werden muss, um die Allgemeingültigkeit von Schönheit zu erkennen.
- Arbeit zitieren
- Björn Germek (Autor:in), 2002, Kants Auffassung vom Schönen in der 'Kritik der Urteilskraft' im Vergleich zur 'Anthropologie in pragmatischer Hinsicht', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3106