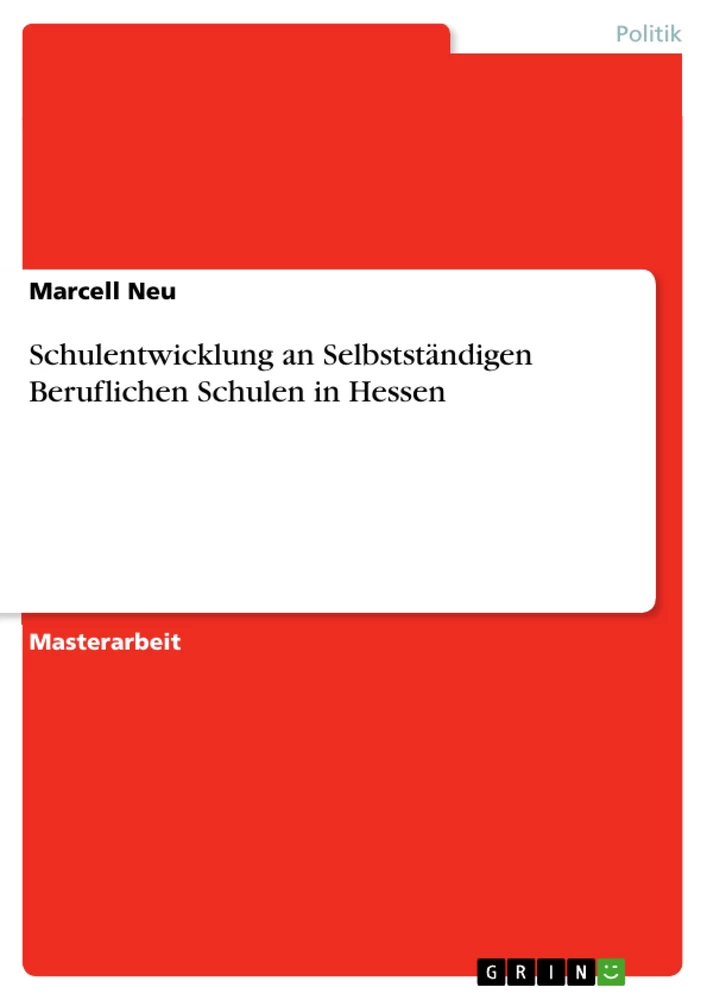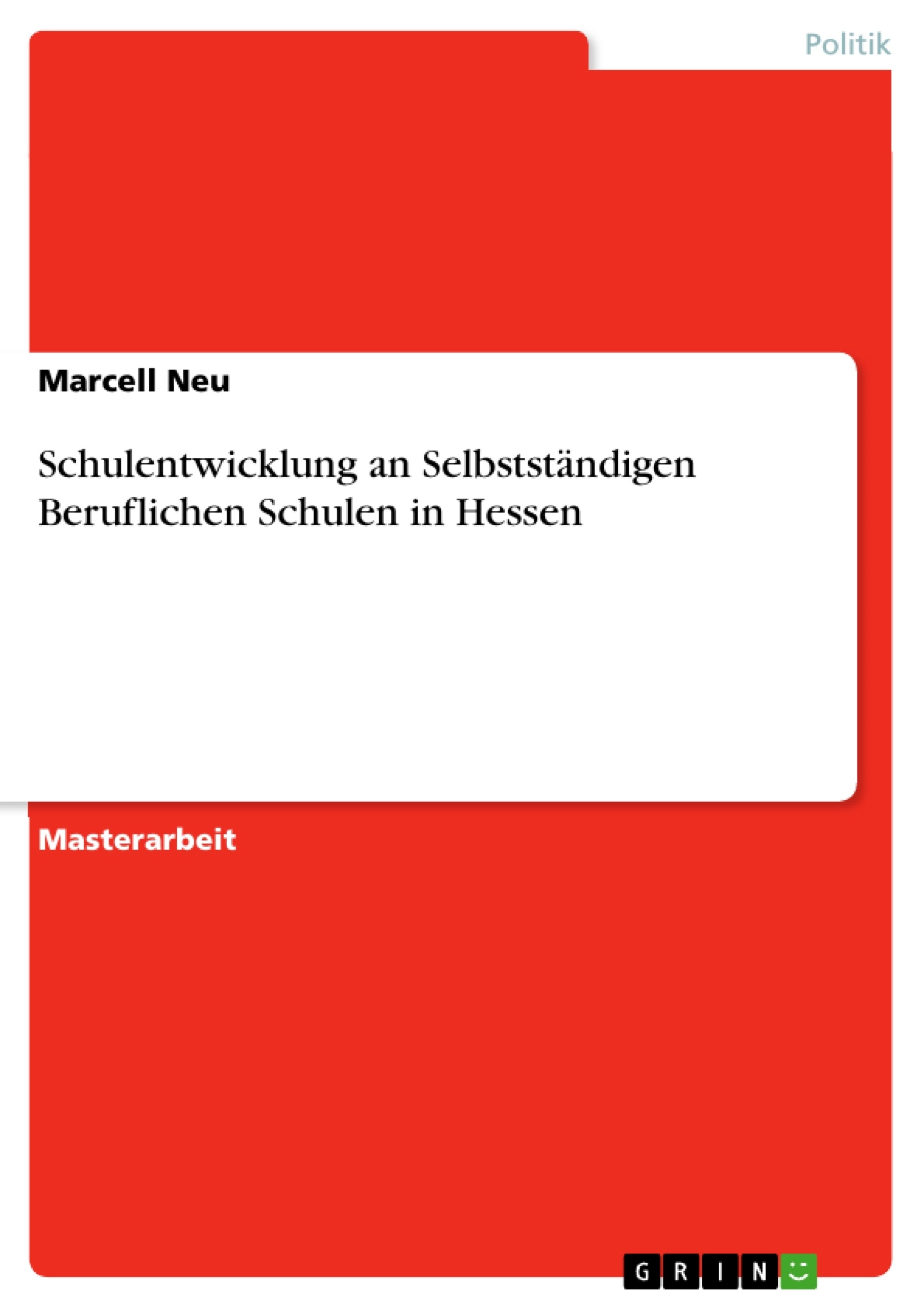Aufgrund der steigenden Individualisierung von Lebenslagen und -stilen sowie der Umstrukturierung sozialer Bezugsräume steht jedem Individuum eine breitere Auswahl an Möglichkeiten zur Lebensgestaltung zur Verfügung. Aufgrund der raschen technischen Weiterentwicklung und des Übergangs von der Industrie- zur Wissensgesellschaft ist ein Bildungs- und Wissensstillstand eines Einzelnen jedoch nicht möglich (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2000, S. 5). Im Fokus stehen nicht mehr Bildungsprozesse, „sondern ein Gebrauchswissen, das sich in der beruflichen Anwendung ökonomisch rechnet“ (Schratz 2007, S. 6). Schule muss daher verstärkt gesellschaftspolitische Wechselbeziehungen berücksichtigen und dementsprechend agieren (vgl. ebd.).
Dieser Veränderungsprozess wird unter dem Begriff „Schulentwicklung“ zusammengefasst. Dieser Begriff lässt sich aber nach äußerer und innerer Entwicklung unterscheiden. Die äußere Schulentwicklung betrifft das Schulwesen, gemeint sind also u.a. das Entstehen neuer Schulformen, Einführung neuer Fächer, Lehrplanveränderungen oder das Entwerfen von Qualitätsstandards. Die innere Schulentwicklung befasst sich mit einer konkreten Schule, also mit der Entwicklung eines Schulprogramms, der Schulklimaverbesserung, der Ausbreitung der Kooperation von Lehrern und der Weiterentwicklung des Unterrichts (vgl. Böhme 2009, S. 91). Veränderungen lassen sich allerdings weder forcieren noch verlaufen sie geradlinig – sie sind nicht abwägbar (vgl. Fullan 1999, S. 25). „Systeme verändern sich nicht von allein, sie werden von Menschen verändert“ (ebd.). Wenn man systemisch mit Veränderungen umgeht, ist es elementar, dass jeder einzelner Lehrer sich „für den Aufbau einer Organisation verantwortlich“ (ebd., S. 75) fühlt. Dazu muss ein Verständnis für den Veränderungsprozess geweckt werden, um den Interessierten „an der Neuorientierung [...] eine [...] Beteiligung zu ermöglichen“ (Schley 1998, S. 27).
Aufgrund ihrer Nähe zur Arbeitswelt und als Partner der Wirtschaft im dualen System der Berufsausbildung sind die berufsbildenden Schulen besonders von der Dynamik im technologischen und ökonomischen Bereich betroffen. Sie stehen unter einem immensen Druck, die Ausbildungsinhalte kontinuierlich den Begebenheiten anzupassen (vgl. Thimet 2013, S. 4). [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Handlungsebenen des Bildungssystems
- Makroebene
- Mesoebene
- Mikroebene
- Eigenverantwortung und Qualitätsmanagementsysteme
- Selbstständige Schule
- Herkunft des Konzepts
- Konzeptionelle Grundlagen und Umsetzung in Hessen
- Kritik an der hessischen Umsetzung
- Qualitätsmanagement in Schulen
- Definition von Qualität
- Hessischer Referenzrahmen Schulqualität
- Qualität durch Evaluation und Entwicklung
- Das Qualitätsmanagementsystem Q2E
- Das Evaluationskonzept QEE
- Qualitätsentwicklung in den anderen Bundesländern
- Selbstständige Schule
- Aspekte der Schulentwicklung
- Definition und Ziele
- Der Schulentwicklungsprozess
- Der Kreislauf des Schulentwicklungsprozesses
- Die Phasen des Schulentwicklungsprozesses
- Elemente der Schulentwicklung
- Organisationsentwicklung
- Schulleitung
- Steuergruppen
- Vom Schulprofil zum Schulprogramm
- Personalentwicklung
- Bestandteile der Personalentwicklung
- Jahresgespräche und Zielvereinbarungen
- Kollegiale Hospitationen und Peer Reviews
- Honorierungsmöglichkeiten
- Teamentwicklung durch professionelle Lerngemeinschaften
- Unterrichtsentwicklung
- Das Konzept der Unterrichtsentwicklung
- Handlungsorientierung und selbstorganisiertes Lernen
- Trainings zur Unterrichtsentwicklung
- Schülerfeedback
- Lernstandserhebungen
- Organisationsentwicklung
- Potenzielle weitere Untersuchung im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie
- Fragestellung und Forschungsdesign
- Datenerhebung
- Aufbau des Fragebogens
- Erstellung des Fragebogens
- Datenauswertung
- Citation du texte
- Marcell Neu (Auteur), 2014, Schulentwicklung an Selbstständigen Beruflichen Schulen in Hessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310812