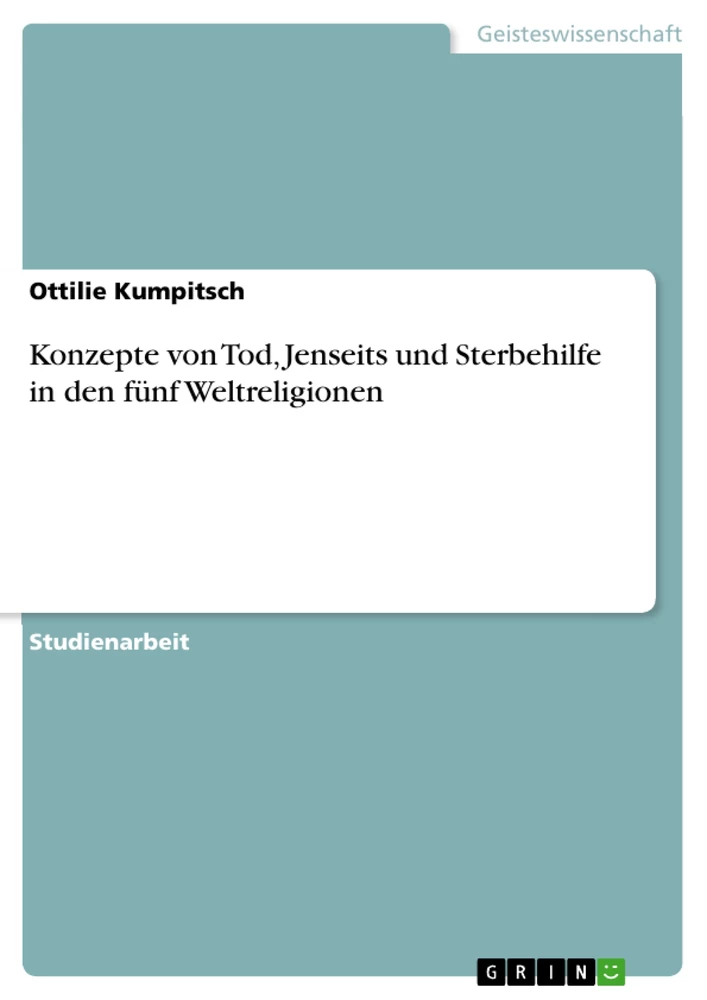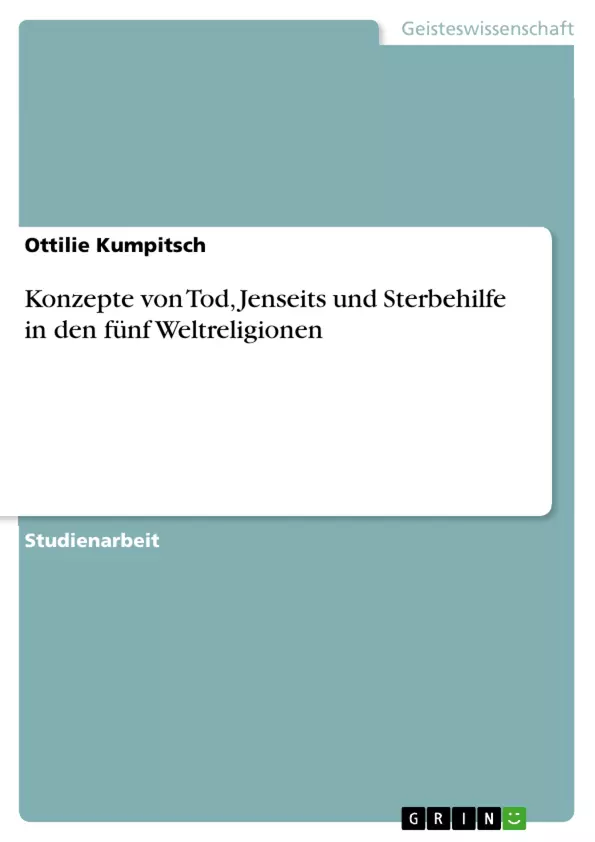Bei der Diskussion über Sterbehilfe prallen auch die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedensten Religionen bzw. Weltanschauungen auf einander. Diese Arbeit präsentiert einen Überblick über die verschiedenen Konzepte von Tod, Sterbehilfe und Jenseits in den Weltreligionen.
Es soll zuerst einmal die Einstellung zum Sterben und Tod der fünf großen Weltreligionen aufgezeigt werden.
Auch der jeweiligen Vorstellung des Lebens nach dem Tode wird Raum gegeben, da sie nicht unbedeutend für Befürwortung oder Ablehnung der Sterbehilfe in ihren verschiedensten Facetten darstellt.
Diesem folgt dann ein Überblick über die jeweiligen ethischen Begründungen bezüglich der Sterbehilfe. Wobei unter aktiver Sterbehilfe das gezielte Töten eines Menschen und unter ärztlich assistierten Suizid das zur Verfügungstellen eines tödlichen Mittels von einem Arzt verstanden werden soll. Im Unterschied dazu ist unter passiver Sterbehilfe der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen und unter indirekter Sterbehilfe die Verabreichung von schmerzlindernden Mitteln unter Inkaufnahme der dadurch verursachten Lebensverkürzung zu verstehen. Abschließend wird noch ein Blick auf die mögliche Einbindung in den Ethikunterricht geworfen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Hinduismus
- Tod Jenseits
- Sterbehilfe
- Buddhismus
- Tod Jenseits
- Sterbehilfe
- Judentum
- Tod Jenseits
- Sterbehilfe
- Christentum
- Tod Jenseits
- Sterbehilfe
- Islam
- Tod Jenseits
- Sterbehilfe
- Ethikunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Frage der Sterbehilfe im Kontext verschiedener Weltreligionen. Sie analysiert die Einstellungen zum Sterben und Tod sowie die Vorstellung des Jenseits in den fünf großen Weltreligionen, um die unterschiedlichen ethischen Begründungen bezüglich Sterbehilfe zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen aktiver Sterbehilfe, ärztlich assistiertem Suizid, passiver Sterbehilfe und indirekter Sterbehilfe.
- Einstellungen zum Sterben und Tod in verschiedenen Religionen
- Vorstellung des Jenseits und seine Relevanz für die Sterbehilfedebatte
- Ethische Begründungen für und gegen Sterbehilfe
- Die Rolle der Gewaltlosigkeit und des Selbstbestimmungsrechts
- Potenziale der Integration in den Ethikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das Kapitel Einleitung stellt die Relevanz der Sterbehilfedebatte im Kontext verschiedener Länder und medizinischer Entwicklungen heraus. Es setzt den Fokus auf die unterschiedlichen Perspektiven von Religionen und Weltanschauungen in Bezug auf Tod und Sterbehilfe.
Das Kapitel Hinduismus beleuchtet die Sichtweise der hinduistischen Religion auf Tod und Jenseits, wobei das Konzept des Karma und der Seelenwanderung im Vordergrund steht. Der Text beschreibt die rituelle Vorbereitung auf den Tod und die Bedeutung von positiven Gedanken für die Wiedergeburt. Zudem wird die Einstellung zum Suizid und die ethische Bewertung von aktiver und passiver Sterbehilfe diskutiert.
Das Kapitel Buddhismus beschäftigt sich mit der buddhistischen Lehre von Tod, Wiedergeburt und Karma. Es zeigt die Bedeutung von Meditation und Achtsamkeit im Angesicht des Todes auf und untersucht die ethische Position des Buddhismus zur Sterbehilfe.
Das Kapitel Judentum behandelt die jüdische Perspektive auf Tod und Jenseits, wobei die Rolle der Tora und die Bedeutung der Bestattung im Vordergrund stehen. Der Text analysiert die Einstellung zum Suizid und beleuchtet die ethischen Aspekte der Sterbehilfe im jüdischen Kontext.
Das Kapitel Christentum diskutiert die christlichen Ansichten zum Tod und Jenseits, insbesondere die Rolle von Jesus Christus und die Bedeutung des Glaubens. Es beleuchtet die ethischen Positionen zum Suizid und zur Sterbehilfe aus christlicher Sicht.
Das Kapitel Islam befasst sich mit der islamischen Vorstellung von Tod, Jenseits und Jüngstem Gericht. Der Text erläutert die Bedeutung des Gebets und der rituellen Waschung im Angesicht des Todes. Zudem wird die Einstellung zum Suizid und die ethische Bewertung der Sterbehilfe aus islamischer Perspektive dargestellt.
Das Kapitel Ethikunterricht analysiert die Möglichkeiten, die Sterbehilfedebatte in den Ethikunterricht einzubinden. Es diskutiert die Bedeutung von Moral und Ethik im Kontext von Tod und Sterben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Sterbehilfe, Tod, Jenseits, Religion, Ethik, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam, Karma, Seelenwanderung, Wiedergeburt, Selbstbestimmung, Gewaltlosigkeit, aktive Sterbehilfe, ärztlich assistierter Suizid, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, Ethikunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe?
Aktive Sterbehilfe ist das gezielte Töten eines Menschen, während passive Sterbehilfe den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen beschreibt.
Wie stehen Hinduismus und Buddhismus zum Tod?
Beide Religionen sehen den Tod als Übergang in einem Kreislauf von Wiedergeburten, der maßgeblich durch das Karma (die Taten im Leben) beeinflusst wird.
Darf ein Muslim Sterbehilfe in Anspruch nehmen?
Im Islam gilt das Leben als Geschenk Gottes, über das der Mensch nicht eigenmächtig verfügen darf. Suizid und aktive Sterbehilfe werden daher strikt abgelehnt.
Welche Rolle spielt die Selbstbestimmung im Christentum?
Obwohl die Würde des Lebens zentral ist, wird im modernen Christentum intensiv über das Recht auf ein würdevolles Sterben und die Grenzen der Apparatemedizin diskutiert.
Warum wird Sterbehilfe im Ethikunterricht thematisiert?
Das Thema ermöglicht es Schülern, sich mit komplexen moralischen Fragen, verschiedenen Weltanschauungen und dem Wert der Selbstbestimmung auseinanderzusetzen.
- Quote paper
- Mag. theol. Ottilie Kumpitsch (Author), 2015, Konzepte von Tod, Jenseits und Sterbehilfe in den fünf Weltreligionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310842