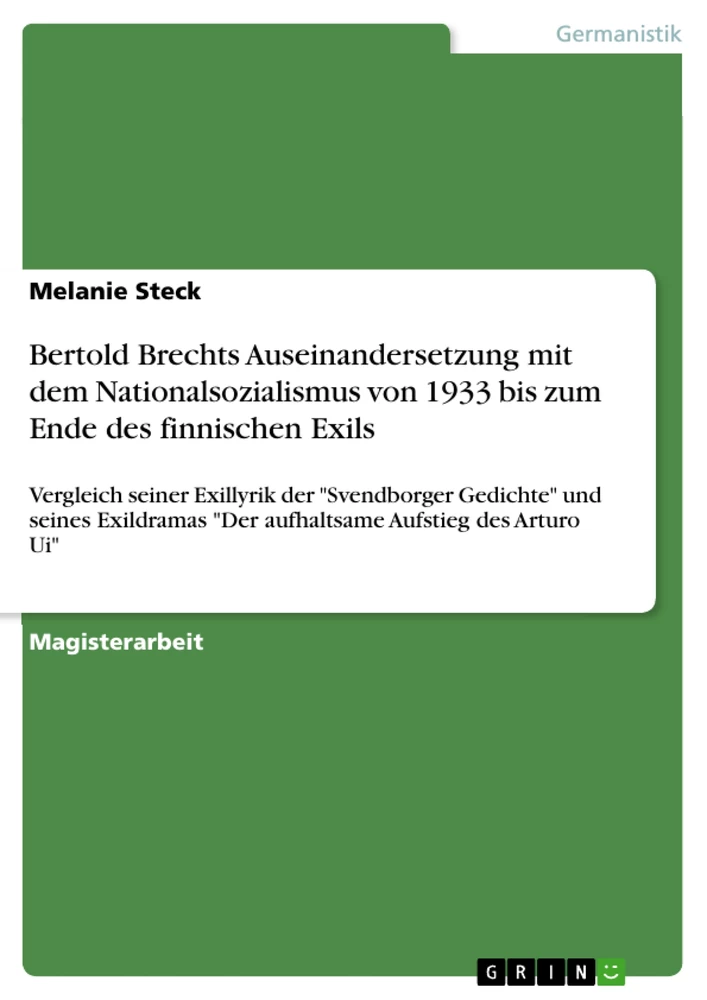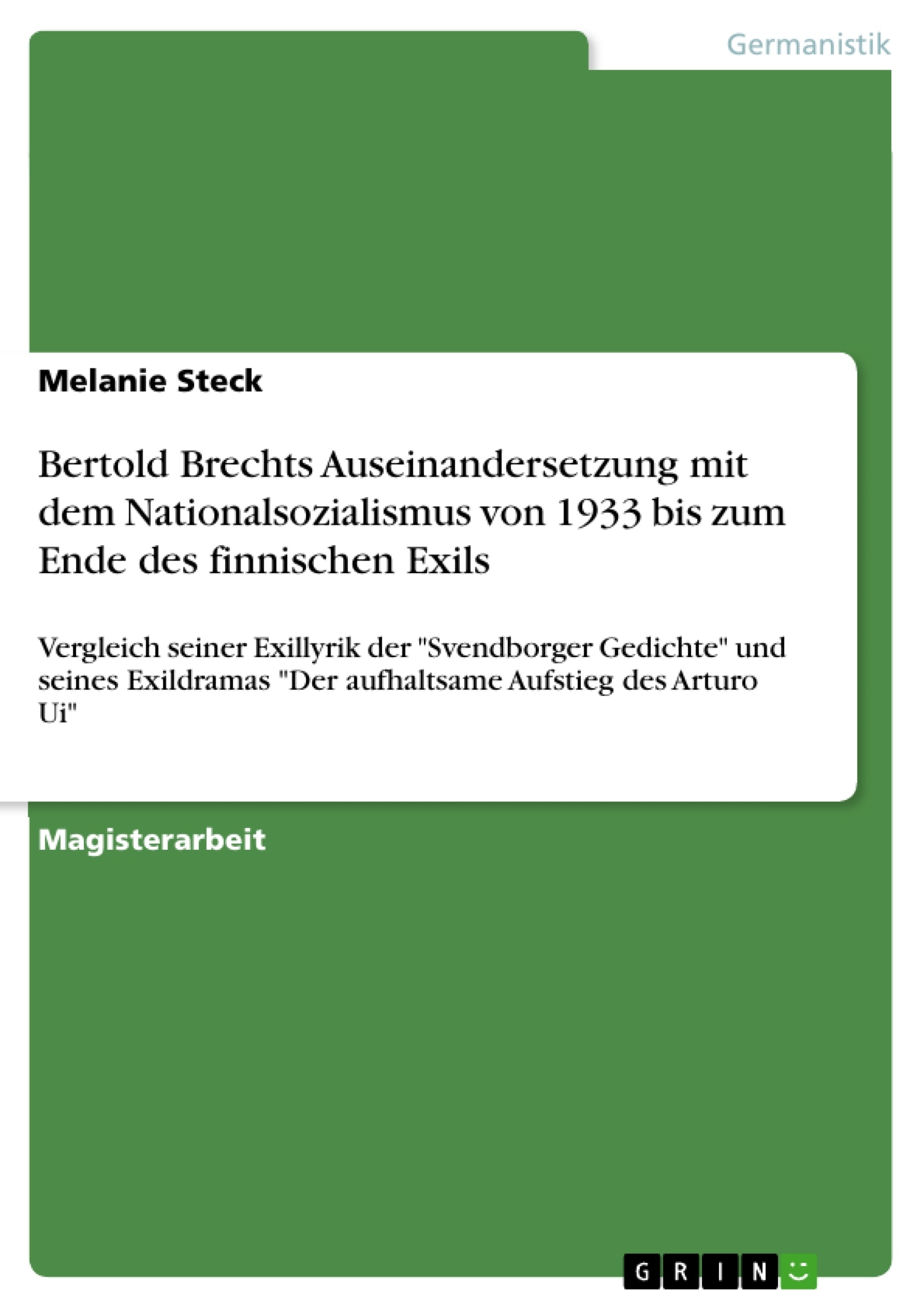Die zeitliche Dimension vorliegender Untersuchung erstreckt sich von 1933 bis zum Jahr 1941. Diese Jahre spiegeln einen geschlossenen Block der Exilzeit in Dänemark über Schweden nach Finnland wider. Im Juli 1941 verlässt Brecht Finnland, da dort durch deutsche Divisionen die Situation immer gefährlicher wurde, und reist über Moskau in das Exil in die USA.
Das Ziel nachstehender Betrachtung von Brechts Exilzeit 1933 bis 1941 ist eine vergleichende Untersuchung seiner Exillyrik am Beispiel der „Svendborger Gedichte“ und dem Exildrama „Der Aufstieg des Arturo Ui“, das während des nordischen Exils als letztes Werk Brechts in Finnland entstanden ist. Aus der reichhaltigen Auswahl der „Svendborger Gedichte“ werden die Gedichte „An die Nachgeborenen“, „Notwendigkeit der Propaganda“ und „Fragen eines lesenden Arbeiters“ interpretiert, da sie trotz unterschiedlicher textimmanenter Inhalte und äußeren Formen die gleiche Kernaussage repräsentieren.
Es soll geprüft werden, inwiefern Brechts Stücke, die im Exil ab 1933 entstanden sind, eine Reaktion auf den Despoten Adolf Hitler und dessen Machtausübung sind.
Dazu werden zunächst die für Brechts literarisches Schaffen von 1933 bis 1941 wichtigen Lebensstationen dargelegt. Denn möchte man Lyrik und Dramatik dieses vor allen Dingen als politischer Autor bekannten Mannes begreifen, muss man zunächst seine individuellen Exilerfahrungen und biografischen Hintergründe kennen. Dem Leser müssen zuerst die persönlichen, politischen und sozialen Umstände des Lebens eines Bertolt Brecht bewusst sein, um sein exilliterarisches Werk vollständig zu begreifen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Person Bertolt Brecht
- Lebensstationen seit der Machtergreifung Hitlers
- Exil in Dänemark
- Exil in Schweden und Finnland
- Politische Gesinnung Bertolt Brechts
- Lebensstationen seit der Machtergreifung Hitlers
- Brecht und der Nationalsozialismus
- Brechts Haltung zum Nationalsozialismus
- Wie stand Brecht zu Hitler?
- Die literarische Verarbeitung des Nationalsozialismus seit der Machtergreifung Hitlers
- Lyrik gegen die Nationalsozialisten – die Svendborger Gedichte
- Neue Lebensumstände - neuer Stil
- Zwischen Autobiografie und Rollengedicht - „An die Nachgeborenen“
- Entstehung, Form und Aufbau
- Inhaltliche Analyse
- Inhaltliche Interpretation
- Unregelmäßige Rhythmen für ein differenziertes Denken „Notwendigkeit der Propaganda“
- Entstehung, Form und Aufbau
- Inhaltliche Analyse
- Inhaltliche Interpretation
- Die Warnung im Verborgenen - „Fragen eines lesenden Arbeiters“
- Entstehung, Form und Aufbau
- Inhaltliche Analyse
- Inhaltliche Interpretation
- Zwischen Autobiografie und Rollengedicht - „An die Nachgeborenen“
- Das Exil als Garant politisch motivierter Verse größtmöglicher Eindringlichkeit
- Der exilierte „Stückeschreiber“ – exemplarische Betrachtung am Drama „Der Aufstieg des Arturo Ui“
- Episches Theater
- Wichtigste Merkmale und Neuerungen
- Unterschiede des epischen und dramatischen Theaters
- V-Effekte
- Brechts'sche Dramendialektik und damit verbundenes Geschichtsverständnis
- Brechts Parabelstücke
- Wichtigste Merkmale und Neuerungen
- „Der Aufstieg des Arturo Ui“ im Lichte Brecht'scher Theatertheorie
- Historischer Hintergrund und Entstehungsgeschichte
- Historische Quellen und Aufbau
- Epische Strukturelemente
- Basisverfremdung - Verschmelzung von deutschem Massenmörder und amerikanischem Gangsterboss in der Figur des Arturo Ui
- V-Effekte in ihrer vielfältigen Form – Werkzeuge zur Doppelverfremdung
- Figuren und Ereignisse im Drama und ihr realhistorisches Pendant
- Fünf Stationen der Machtausweitung Arturo Uis bis zur wirtschaftlichen Expansion
- Der „große Stil“
- Sprachliche Gestaltung des „großen Stils“
- Verfremdung in der Aufführungspraxis
- Knotenpunkt der Lächerlichkeit – Brechts Intention für die Darstellungsweise der Figur Arturo Ui
- Ideologiekritik und Rezeption
- Die Parabelform – ein Streitpunkt der Kritiker
- Wirtschaftsdrama kontra Hitler-Historie
- Gleicher Leitgedanke – leicht nuancierte Unterschiede in der Umsetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Exilliteratur Bertolt Brechts während der Zeit von 1933 bis 1941, dem Zeitraum, der von der Machtergreifung Hitlers bis zu Brechts Exil in den USA reichte. Der Fokus liegt auf der Analyse ausgewählter Werke, um zu untersuchen, wie Brecht in seinen Schriften den Nationalsozialismus verarbeitet und ihn kritisch hinterfragt.
- Brechts Lebensstationen im Exil und ihre Auswirkungen auf sein literarisches Werk
- Brechts politische Gesinnung und seine Kritik am Nationalsozialismus
- Die Verwendung von epischem Theater und Verfremdungseffekten als Mittel der politischen Kritik
- Die Analyse der Svendborger Gedichte und des Dramas „Der Aufstieg des Arturo Ui“
- Brechts literarische Intentionen und die Rezeption seiner Werke im Kontext des Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert den Fokus auf Bertolt Brechts Exilliteratur zwischen 1933 und 1941. Das erste Kapitel beleuchtet Brechts Lebensstationen im Exil und seine politische Gesinnung. Das zweite Kapitel widmet sich der kritischen Auseinandersetzung Brechts mit dem Nationalsozialismus. Das dritte Kapitel untersucht die Svendborger Gedichte und ihre Rolle als Mittel der antifaschistischen Lyrik. Das vierte Kapitel befasst sich mit Brechts „Der Aufstieg des Arturo Ui“ als einem Beispiel für sein episches Theater und dessen politische Intention.
Schlüsselwörter (Keywords)
Bertolt Brecht, Exilliteratur, Nationalsozialismus, Episches Theater, Verfremdungseffekte, Svendborger Gedichte, „Der Aufstieg des Arturo Ui“, Politische Kritik, Antifaschismus.
- Episches Theater
- Quote paper
- Melanie Steck (Author), 2009, Bertold Brechts Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus von 1933 bis zum Ende des finnischen Exils, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310962