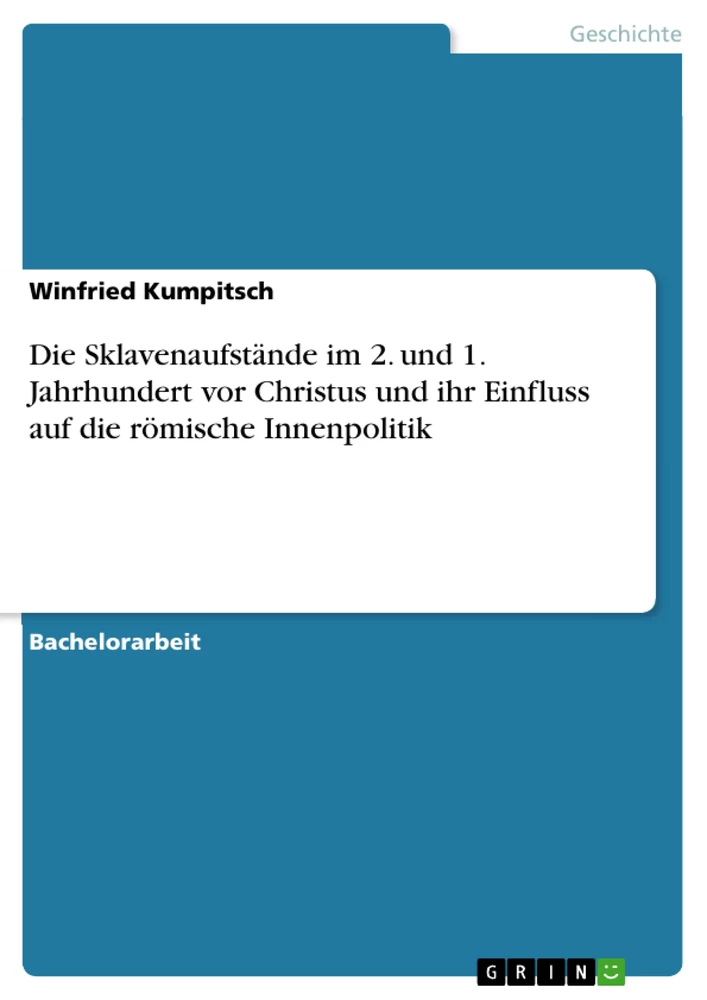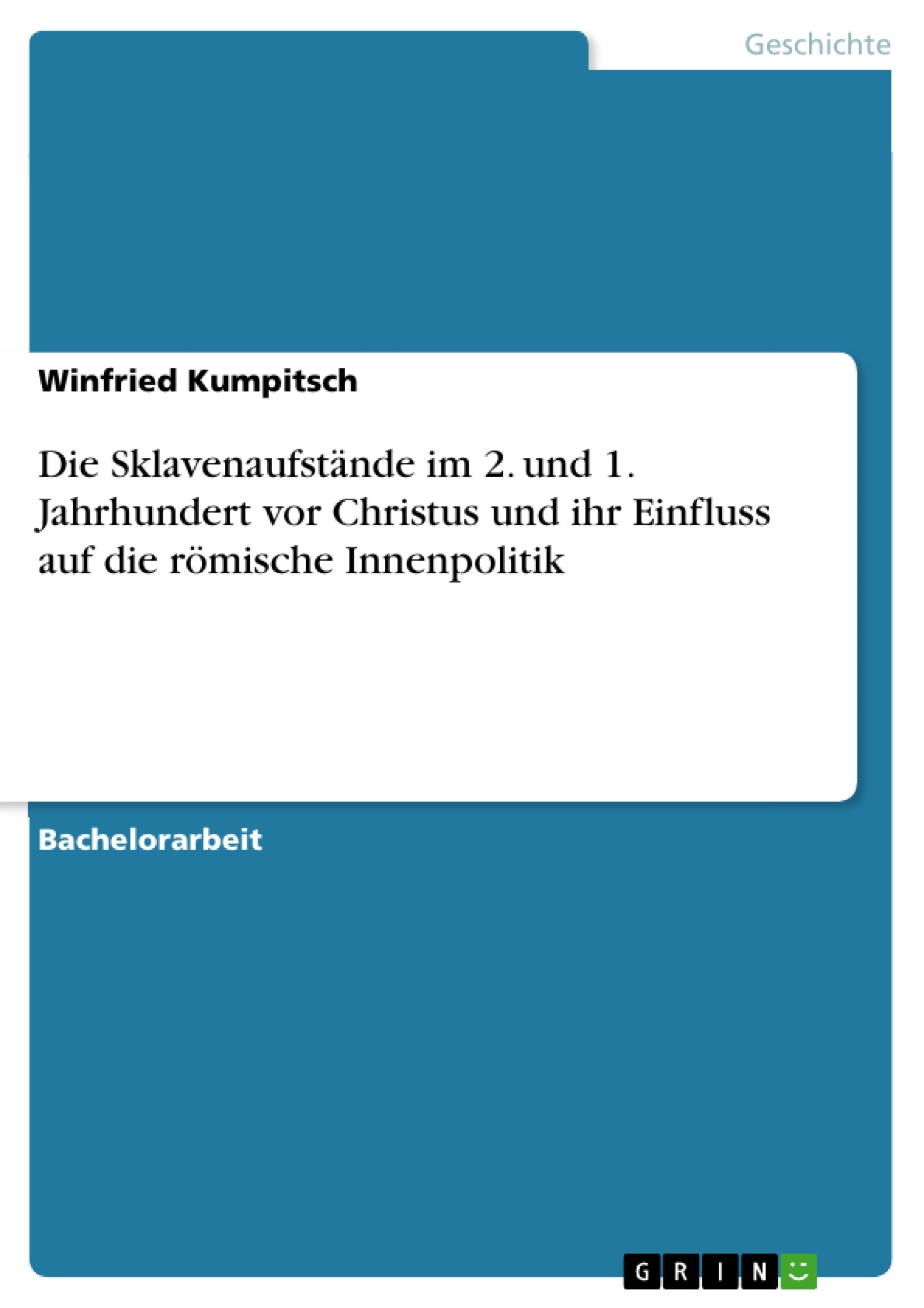Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von Ereignissen während der drei großen Sklavenaufstände des 2. und 1. Jh. v. Chr. deren Einfluss auf die römische Innenpolitik zu verdeutlichen.
Diese Arbeit wird sich mit den beiden sizilischen Sklavenaufständen und dem Spartacus-Aufstand beschäftigen. Kleinere Aufstände werden, sofern zeitgleich mit den betrachteten Ereignissen, erwähnt, aber ansonsten unbeachtet bleiben.
Dies liegt nicht so sehr an einer Geringschätzung derselbigen, sondern daran, dass sie kaum Einfluss auf die stadtrömische Tagespolitik gehabt haben dürften, und selbst wenn sie es gehabt hätten, so wird über diese meist nur in ein paar Sätzen berichtet, weshalb nichts Tiefergreifendes darüber zu sagen ist.
Ebenfalls außer Acht gelassen wird der Aristonikosaufstand in Pergamon, da es sich hierbei um einen Putschversuch unter Einbeziehung der Sklaven handelt und nicht um einen eigenen Sklavenaufstand.
Die Sklaverei, ein “gesellschaftliches“ Phänomen, vermutlich so alt wie die Menschheit selbst, war im Laufe der Zeit zahlreichen Veränderungen unterworfen. Die antike Wirtschaft beruhte in gewissen Bereichen zum Großteil auf der Tätigkeit von Sklaven, man denke nur an die Schlacht bei Issos, nach der Alexander der Große die gefangenen griechischen Söldner in die Bergwerke im Pangaion sandte. Eine Frage sorgte bei den Sklavenbesitzern für Unbehagen: „Was, wenn sich die Sklaven erheben?“
Im in Stadtstaaten zerstückelten Griechenland, aber auch in den hellenistischen Reichen des Ostens, wird kaum von größeren oder länger andauernden Sklavenaufständen berichtet. Anders sieht es im Westen, genauer in Italien und auf Sizilien, unter der römischen Herrschaft aus. Hier kam es im 2. und 1. Jh. v. Chr., wiederholt zu Sklavenaufständen, die sogarmehrere Jahren andauerten.
Wie aber konnte es zu diesen Aufständen kommen? Warum dauerte es oft mehrere Jahre bis die Ordnung in den betroffenen Gebieten wiederhergestellt und die Sklaven besiegt waren? Diese und ähnlichen Fragen werden in dieser Arbeit behandelt.
Die meisten Informationen zu diesem Thema stammen aus den Exzerpten des Diodor, den Parallelbiographien des Plutarch, der Geschichte der Bürgerkriege des Appian, und aus Livius römischer Geschichte, sowie den von diesen Autoren abhängigen Historiographen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. Quellenlage zu den Sklavenaufständen
- II. Charakteristika der römischen Sklavenhaltung in der Republik
- 1. Wie kommt man zu Sklaven?
- 2. peculium, contubernium und manumissio
- 2. 1. peculium
- 2. 2. contubernium
- 2. 3. manumissio
- 3. Tätigkeitsfelder von Sklaven und deren Behandlung
- 3. 1. Städtische Sklaven
- 3. 2. Ländliche Sklaven
- III. Erster sizilischer Sklavenaufstand (141-132 v. Chr.)
- 1. Historisches Umfeld/Kontext
- 2. Verlauf
- IV. Zweiter sizilischer Sklavenaufstand (104-101 v. Chr.)
- 1. Historisches Umfeld/Kontext
- 2. Verlauf
- V. Spartacusaufstand (74-71 v. Chr.)
- 1. Historisches Umfeld/Kontext
- 2. Verlauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Ereignisse während der drei großen Sklavenaufstände des 2. und 1. Jh. v. Chr. deren Einfluss auf die römische Innenpolitik zu verdeutlichen.
- Die Sklavenhaltung in der römischen Republik
- Die Ursachen und Hintergründe der Sklavenaufstände
- Der Verlauf und die Auswirkungen der Sklavenaufstände auf die römische Gesellschaft
- Die Rolle der römischen Politik und des Militärs in der Bekämpfung der Sklavenaufstände
- Die Quellenlage zu den Sklavenaufständen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel behandelt die Quellenlage zu den Sklavenaufständen. Es werden die wichtigsten Quellen und ihre Probleme erläutert, insbesondere die Werke von Diodor, Plutarch und Appian.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der römischen Sklavenhaltung in der Republik. Es werden die verschiedenen Wege zur Versklavung, die Lebensbedingungen der Sklaven sowie ihre Tätigkeitsfelder und Behandlung diskutiert.
Das dritte Kapitel behandelt den ersten sizilischen Sklavenaufstand (141-132 v. Chr.). Es werden das historische Umfeld, der Verlauf des Aufstandes und seine Auswirkungen auf die römische Politik beleuchtet.
Das vierte Kapitel analysiert den zweiten sizilischen Sklavenaufstand (104-101 v. Chr.). Es werden die Ursachen, der Verlauf und die Auswirkungen des Aufstandes auf die römische Gesellschaft dargestellt.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Spartacusaufstand (74-71 v. Chr.). Es werden das historische Umfeld, der Verlauf des Aufstandes und seine Auswirkungen auf die römische Politik und Gesellschaft untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Sklavenaufstände, römische Republik, Sklaverei, Sizilien, Spartacus, Diodor, Plutarch, Appian, Quellenlage, historische Kontext, römische Politik, römische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Sklavenaufstände werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die beiden sizilischen Sklavenaufstände sowie den berühmten Spartacus-Aufstand.
Welchen Einfluss hatten diese Aufstände auf die römische Innenpolitik?
Die Aufstände erschütterten die Republik, zwangen das Militär zu massiven Einsätzen und führten zu Debatten über die Sicherheit und die Struktur der Sklavenhaltung.
Was sind "peculium" und "manumissio"?
"Peculium" ist das Sondervermögen, das ein Sklave verwalten durfte, und "manumissio" bezeichnet die Freilassung eines Sklaven.
Warum kam es besonders in Sizilien zu Aufständen?
Sizilien war durch riesige Latifundien und eine große Anzahl ländlicher Sklaven geprägt, deren schlechte Behandlung und Konzentration den Boden für Revolten ebneten.
Wer sind die wichtigsten historischen Quellen für dieses Thema?
Die wichtigsten Informationen stammen von antiken Autoren wie Diodor, Plutarch, Appian und Livius.
- Citation du texte
- Winfried Kumpitsch (Auteur), 2015, Die Sklavenaufstände im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus und ihr Einfluss auf die römische Innenpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311030