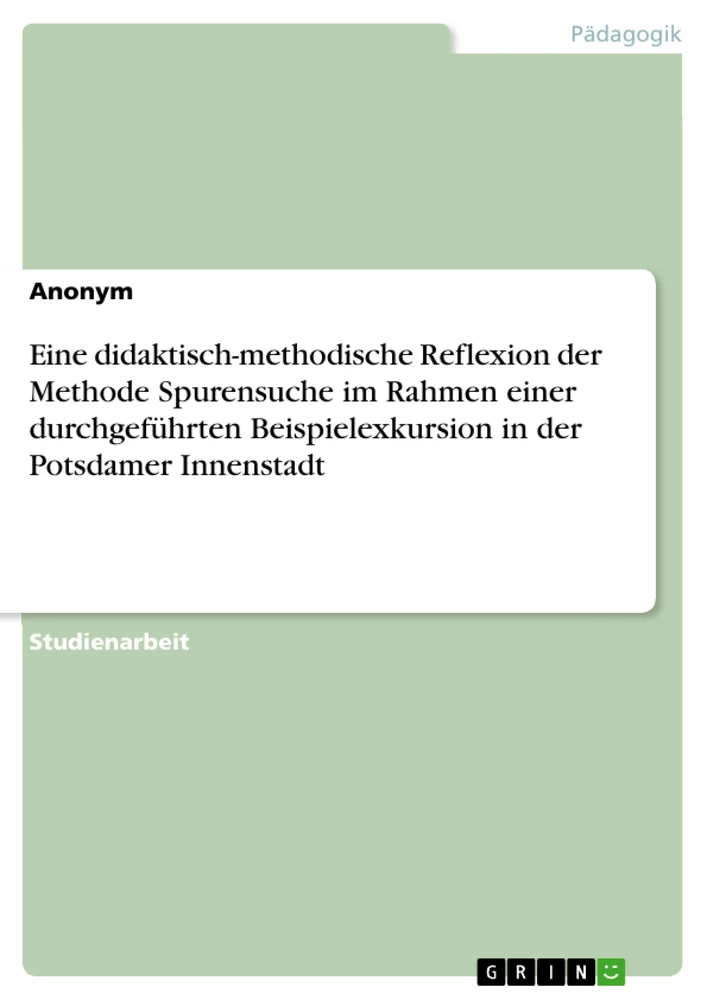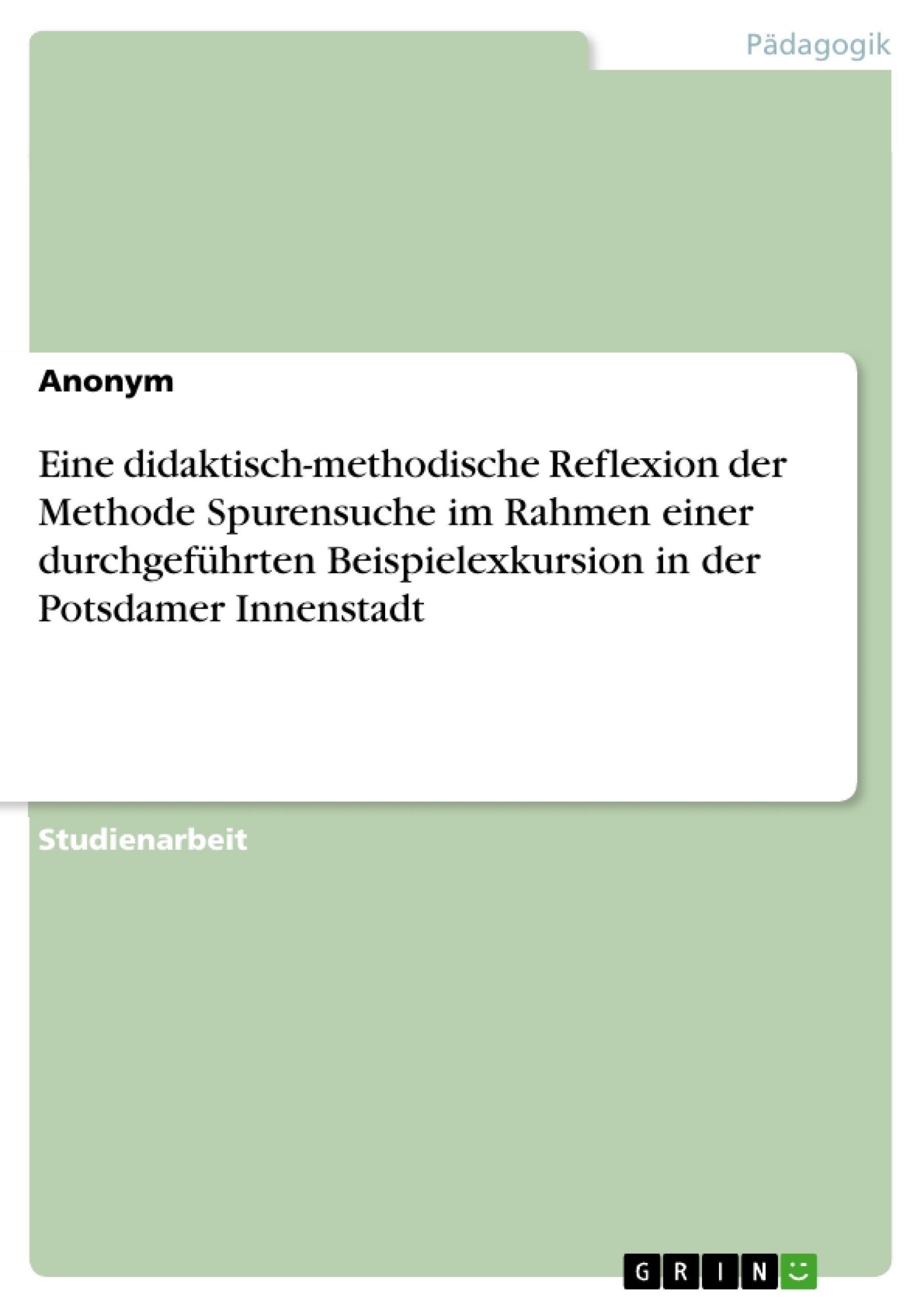Der vielzitierte Lob eines exkursionsbegleiteten Geographieunterrichts stützt sich im Wesentlichen auf die Annahme, dass durch die Eigenart der Methode Lehrinhalte für Schülerinnen und Schüler nahbarer zu erfassen wären, als es konventioneller Unterricht leisten könne. Wie Rinschede und weitere festhalten, böte der Exkursionsansatz die Möglichkeit einer unverfälschten Raumerfahrung mit unmittelbarer Empfindungsnähe zum untersuchten geographischen Lerngegenstand. Demgegenüber erscheint der Klassenraum als ein isoliertes Gefüge, in dem geographische Kompetenzen allein durch synthetische Projektion tatsächlich bestehender Räume und ihrer Wirkungsgefüge möglich ist – nicht aber durch den persönlichen Erfahrungsprozess der Schülerinnen und Schüler.
Fast scheint es daher, als bestünde die gängige Ansicht, konventioneller Schulunterricht gleiche einem Simulationsraum für die tatsächliche Welt, der im Gegensatz zur geographischen Exkursion allerdings nie den gleichen Anschauungsgrad erreichen könne. Unbestreitbar ist in jedem Fall, dass nirgendwo anders als im untersuchten Raum selbst die Wahrnehmung des Bewertenden das höchste Maß an Authentizität erreichen kann. Meyer beschreibt daher nicht ungerechtfertigt die reale Begegnung im Feld als „Herzstück geographischen Arbeitens”. Nicht unbeachtet darf bleiben, dass Exkursionen aufgrund einiger ihrer Eigenheiten nicht unerschöpflich für den Geographieunterricht zur Verfügung stehen können. Der normale Unterricht muss ohne Zweifel den größeren Teil der beiden didaktischen Grundansätze für sich reservieren.
Unter dem Titel: „Die Potsdamer Torjäger – Eine Spurensuche zur Raumnutzung und -entwicklung anhand der Potsdamer Stadttore” wurde nun eine Exkursion für studentische Exkursionsteilnehmer konzipiert, deren Planung, Durchführung und Reflexion Bestandteile der folgenden Erläuterungen sein sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Zur Rolle der Exkursion in der Geographiedidaktik
- 1.2 Die Exkursionsmethode Spurensuche
- 2. Spurensuche in der Potsdamer Innenstadt
- 2.1 Stadtentwicklungstheoretische Vorbetrachtungen und RLP
- 2.2 Planung der Beispielexkursion
- 2.3 Vorstellung der Stationen
- 2.4 Durchführung der Exkursion
- 3. Auswertung und Reflexion
- 3.1 Evaluation der Beispielexkursion
- 3.2 Zum exkursionsdidaktischen Ansatz
- 3.3 Rückschlüsse zur schulischen Anwendung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit reflektiert die Exkursionsmethode der Spurensuche anhand einer durchgeführten Beispielsexkursion in der Potsdamer Innenstadt. Ziel ist es, die didaktisch-methodischen Aspekte dieser Methode zu analysieren und ihre Anwendbarkeit im schulischen Kontext zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Exkursionen im Geographieunterricht, die verschiedenen Raumkonzepte und ihre Auswirkungen auf die Methodenauswahl sowie die konkrete Umsetzung und Auswertung der Spurensuche.
- Rolle von Exkursionen im Geographieunterricht
- Unterschiedliche Raumkonzepte und ihre Relevanz für die Exkursionsmethodik
- Didaktisch-methodische Analyse der Spurensuche
- Umsetzung der Spurensuche in der Potsdamer Innenstadt
- Übertragbarkeit der Methode auf den schulischen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die Bedeutung von Exkursionen im Geographieunterricht erörtert. Es werden verschiedene Raumkonzepte vorgestellt und ihre Auswirkungen auf die Planung und Durchführung von Exkursionen diskutiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von unmittelbarer Raumerfahrung für das geographische Lernen und die Herausforderungen, die sich aus der Planung und Durchführung von Exkursionen ergeben. Die methodische Vielfalt im Umgang mit Raumkonzepten wird betont, um die Wahl der geeigneten Exkursionsmethode zu begründen. Abschließend wird die Exkursionsmethode der "Spurensuche" als Schwerpunkt der Arbeit eingeführt.
2. Spurensuche in der Potsdamer Innenstadt: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Planung und Durchführung einer Spurensuche in der Potsdamer Innenstadt. Es beinhaltet stadtentwicklungstheoretische Vorbetrachtungen und die detaillierte Darstellung der einzelnen Stationen der Exkursion. Die Planungsphase wird ebenso beleuchtet wie die praktische Durchführung mit ihren Herausforderungen und Erfolgen. Der Fokus liegt auf der methodischen Umsetzung der Spurensuche im konkreten räumlichen Kontext.
3. Auswertung und Reflexion: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Exkursion ausgewertet und reflektiert. Es erfolgt eine Evaluation der Beispielexkursion, eine kritische Auseinandersetzung mit dem exkursionsdidaktischen Ansatz und schließlich die Ableitung von Rückschlüssen für die Anwendung der Spurensuche im schulischen Kontext. Es werden Stärken und Schwächen der Methode im Hinblick auf die Erreichung der Lernziele analysiert und Verbesserungsvorschläge für zukünftige Exkursionen formuliert.
Schlüsselwörter
Exkursionsmethode, Spurensuche, Geographiedidaktik, Raumkonzepte, Stadtentwicklung, Potsdamer Innenstadt, Raumerfahrung, methodische Reflexion, schulische Anwendung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Spurensuche in der Potsdamer Innenstadt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Exkursionsmethode der "Spurensuche" anhand einer Beispielsexkursion in der Potsdamer Innenstadt. Der Fokus liegt auf der didaktisch-methodischen Analyse dieser Methode und ihrer Anwendbarkeit im Geographieunterricht.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die didaktisch-methodischen Aspekte der Spurensuche zu untersuchen und ihre Übertragbarkeit auf den schulischen Kontext zu bewerten. Es werden die Rolle von Exkursionen im Geographieunterricht, verschiedene Raumkonzepte und deren Einfluss auf die Methodenauswahl, sowie die konkrete Umsetzung und Auswertung der Spurensuche beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Rolle von Exkursionen im Geographieunterricht, unterschiedliche Raumkonzepte und ihre Relevanz für die Exkursionsmethodik, die didaktisch-methodische Analyse der Spurensuche, die Umsetzung der Spurensuche in der Potsdamer Innenstadt und die Übertragbarkeit der Methode auf den schulischen Unterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) legt die Grundlagen und führt in die Methode der Spurensuche ein. Kapitel 2 beschreibt die Planung und Durchführung der Beispielsexkursion in Potsdam. Kapitel 3 wertet die Exkursion aus und reflektiert den exkursionsdidaktischen Ansatz. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen.
Was wird im Kapitel "Einführung" behandelt?
Die Einführung erörtert die Bedeutung von Exkursionen im Geographieunterricht, stellt verschiedene Raumkonzepte vor und diskutiert deren Auswirkungen auf die Exkursionsplanung. Es wird die methodische Vielfalt im Umgang mit Raumkonzepten betont und die Exkursionsmethode "Spurensuche" als Schwerpunkt der Arbeit eingeführt.
Was wird im Kapitel "Spurensuche in der Potsdamer Innenstadt" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Planung und Durchführung der Spurensuche in Potsdam. Es beinhaltet stadtentwicklungstheoretische Vorbetrachtungen, die detaillierte Darstellung der Exkursionsstationen und die Reflexion der praktischen Durchführung.
Was wird im Kapitel "Auswertung und Reflexion" behandelt?
Hier werden die Ergebnisse der Potsdamer Exkursion ausgewertet und reflektiert. Es erfolgt eine Evaluation der Exkursion, eine kritische Auseinandersetzung mit dem exkursionsdidaktischen Ansatz und die Ableitung von Rückschlüssen für die schulische Anwendung der Spurensuche. Stärken und Schwächen der Methode werden analysiert und Verbesserungsvorschläge formuliert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Exkursionsmethode, Spurensuche, Geographiedidaktik, Raumkonzepte, Stadtentwicklung, Potsdamer Innenstadt, Raumerfahrung, methodische Reflexion, schulische Anwendung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Eine didaktisch-methodische Reflexion der Methode Spurensuche im Rahmen einer durchgeführten Beispielexkursion in der Potsdamer Innenstadt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311049