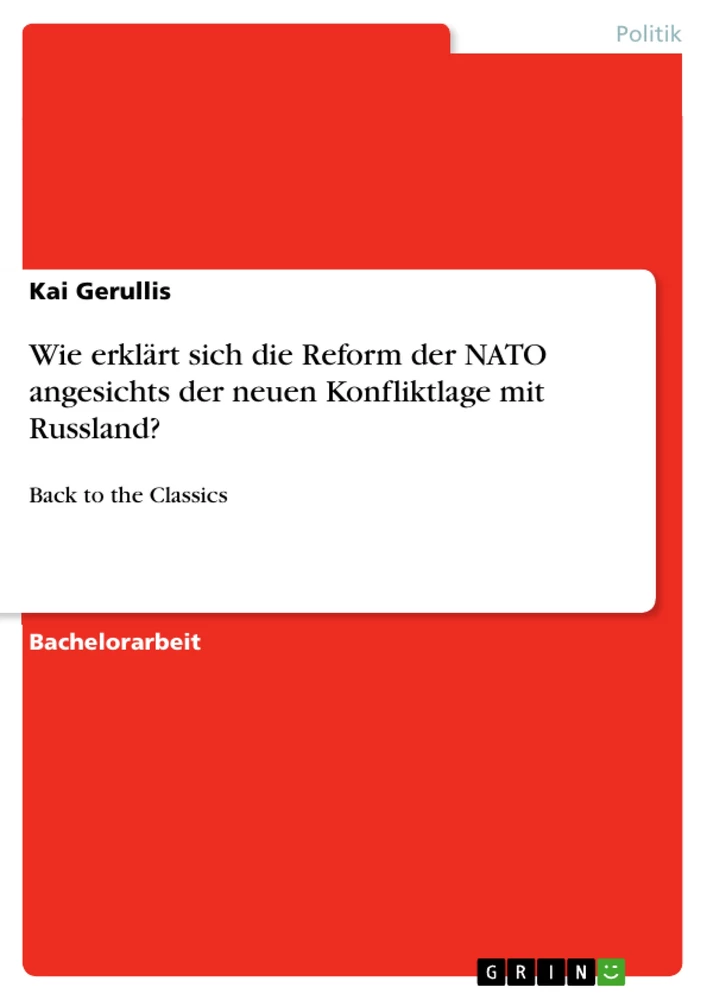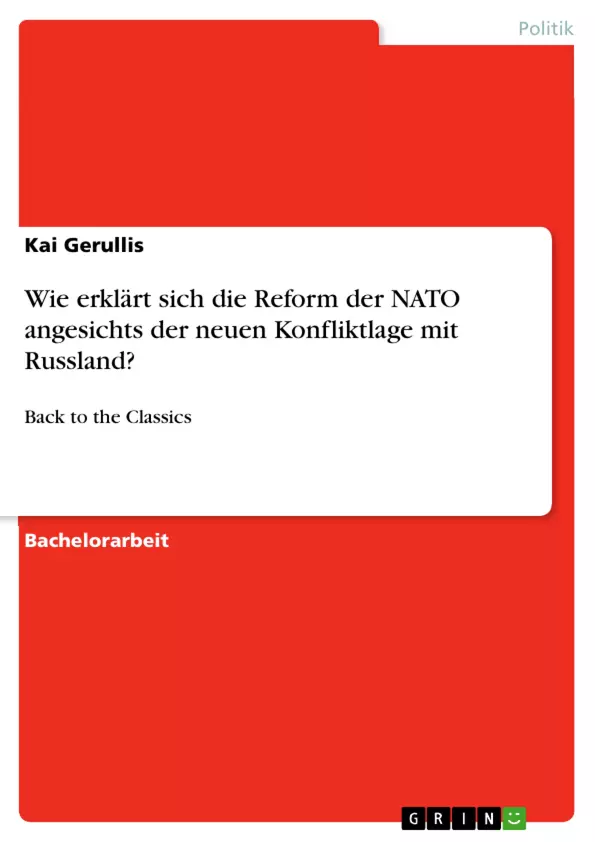Die Arbeit analysiert das veränderte Verhältnis der NATO zu Russland nach der Annexion der Krim. Untersuchungsgegenstand ist der NATO-Gipfel von Wales im September 2014. Die Arbeit untersucht, angleitet von den gängigen Großtheorien der Internationalen Beziehungen - insbesondere des Realismus und des Konstruktivismus - ob die NATO durch das veränderte Verhältnis zurück in alte Strukturen des Ost-West-Konflikts fällt.
Die Arbeit wertet die Gipfel-Erklärungen der NATO-Mitglieder aus und geht auf ihre Folgen für die Politik des Bündnisses ein. Dazu werden aktuelle Entwicklungen des Jahres 2015 ebenso aufgegriffen wie Entwicklungen aus der Geschichte der NATO, die teilweise in Form von Exkursen geschildert werden.
Kernpunkt der Arbeit ist der Nachweis einer bereits aus ihrer Geschichte bekannten Doppelstrategie der NATO aus Gesprächsbereitschaft und Verteidigungsbereitschaft, die von nun an wieder das Verhältnis mit Russland prägt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Herleitung der Leitfrage
- 1.2 Wissenschaftliche Relevanz und Forschungsstand
- 1.3 Theoriebezug
- 1.3.1 Realistische/Neorealistische Sichtweise
- 1.3.2 Konstruktivistische Sichtweise
- 1.4 Vorstellung meiner Hypothesen
- 2. Back to the Classics? Erklärung der NATO-Reform unter Rückgriff auf die politische Theorie
- 2.1 Reaktivierung der Gegenmacht: Die Neuorientierung und ihre Gründe aus Sicht des Realismus
- 2.2 Hypothese eins: Die NATO reagiert aufgrund der – insbesondere von einigen östlichen Mitgliedern wahrgenommenen – neuen Bedrohung durch Russland mit inhaltlicher Neuorientierung, nämlich einer erneuten Hinwendung zur klassischen Aufgabe der Territorialverteidigung
- 2.3 Stärke zeigen, Konfrontation vermeiden: Die Reform aus Sicht des Konstruktivismus
- 2.4 Hypothese zwei: Die NATO zeigt gegenüber Russland Stärke, will aber getreu ihres Selbstverständnisses als ein an Entspannung und Verteidigung orientiertes Bündnis eine Konfrontation durch die Neuorientierung vermeiden.
- 2.5 Methodisches Vorgehen zur Überprüfung der Hypothesen
- 3. Die Hinwendung zur klassischen Aufgabe der Territorialverteidigung als Reaktion auf die neue Bedrohung durch Russland
- 3.1 Die Entwicklung der NATO von 1949-2014
- 3.2 Der NATO-Gipfel von Wales 2014
- 3.3 Analyse der Gipfelerklärung von Wales
- 3.4 Besondere Bedrohungswahrnehmung der östlichen NATO-Mitglieder Polen und des Baltikums
- 3.5 Die Reaktionen der NATO: Luft-Einheiten im Baltikum, neue Speerspitze soll (endlich) kommen
- 3.6 Ein neues Sicherheitsdilemma an der Ostgrenze der NATO?
- 4. Stärke zeigen, Konfrontation vermeiden – Die NATO verfolgt getreu ihres Selbstverständnisses eine Politik von Entspannung und Verteidigung
- 4.1 Zwei Seiten einer Medaille – Ein Selbstverständnis mit Tradition
- 4.2 Analyse der Gipfelerklärung von Wales und der gemeinsamen Erklärung der NATO-Ukraine-Kommission
- 4.3 Politik der offenen Tür bleibt bestehen
- 4.4 Glaubhafte Stärke beweisen durch militärische Handlungsfähigkeit
- 4.5 Keine klare Absage an NATO-Mitgliedschaft der Ukraine
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der NATO-Reform im Kontext der sich verschärfenden Krise mit Russland, die durch die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 ihren Anfang nahm. Das Ziel ist, die Gründe für diese Reform zu analysieren und zu verstehen, welche Mechanismen dahinterstecken. Der Fokus liegt dabei auf dem NATO-Gipfel von Wales 2014, der als Wendepunkt in der NATO-Strategie gilt.
- Die Analyse der NATO-Reform unter Rückgriff auf die politische Theorie des Realismus und des Konstruktivismus.
- Die Untersuchung der Rolle des NATO-Gipfels von Wales 2014 als Initialzündung für eine strategische Bündnisreform.
- Die Betrachtung der neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen für die NATO, die durch das veränderte Verhältnis zu Russland entstanden sind.
- Die Analyse der strategischen Doppelstrategie der NATO, die eine starke Reaktion auf die russische Bedrohung mit einem gleichzeitigen Bestreben nach Entspannung und Verhandlungen verbindet.
- Die Bewertung der Auswirkungen der Reform auf die NATO-Strategie und ihre Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und führt in das Thema der NATO-Reform ein. Sie beschreibt die aktuelle Konfliktlage mit Russland und die Bedeutung des NATO-Gipfels von Wales 2014. Zudem werden die wissenschaftliche Relevanz und der Forschungsstand des Themas beleuchtet, sowie ein Theoriebezug auf den Realismus und den Konstruktivismus hergestellt. Abschließend werden die Hypothesen der Arbeit formuliert.
- Kapitel 2: Back to the Classics? Erklärung der NATO-Reform unter Rückgriff auf die politische Theorie: Dieses Kapitel beleuchtet die NATO-Reform aus Sicht des Realismus und des Konstruktivismus. Es wird untersucht, wie die neue Bedrohung durch Russland die NATO zur Reaktivierung ihrer klassischen Aufgaben wie der Territorialverteidigung geführt hat. Dabei werden die beiden Hypothesen der Arbeit vorgestellt und die methodische Vorgehensweise zur Überprüfung der Hypothesen erläutert.
- Kapitel 3: Die Hinwendung zur klassischen Aufgabe der Territorialverteidigung als Reaktion auf die neue Bedrohung durch Russland: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der NATO von 1949 bis 2014 und untersucht die konkrete Reaktion der NATO auf die Bedrohung durch Russland. Es werden der NATO-Gipfel von Wales, die Gipfelerklärung sowie die besondere Bedrohungswahrnehmung der östlichen NATO-Mitglieder Polen und des Baltikums betrachtet. Zudem werden die Reaktionen der NATO, wie die Stationierung von Luft-Einheiten im Baltikum, beleuchtet.
- Kapitel 4: Stärke zeigen, Konfrontation vermeiden – Die NATO verfolgt getreu ihres Selbstverständnisses eine Politik von Entspannung und Verteidigung: In diesem Kapitel wird die Doppelstrategie der NATO aus Sicht des Konstruktivismus beleuchtet. Es wird untersucht, wie die NATO trotz der neuen Bedrohung durch Russland an ihrem Selbstverständnis als ein an Entspannung und Verteidigung orientiertes Bündnis festhält. Dabei werden die Gipfelerklärung von Wales und die gemeinsame Erklärung der NATO-Ukraine-Kommission analysiert, sowie die Rolle der Politik der offenen Tür und die Bedeutung von militärischer Handlungsfähigkeit untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die NATO-Reform, die durch die neue Bedrohung durch Russland ausgelöst wurde. Zentrale Begriffe sind: NATO-Gipfel von Wales, Territorialverteidigung, Realismus, Konstruktivismus, Entspannung, Verteidigung, Russland, Ukraine, Sicherheitsdilemma, Bündnisfall, Politik der offenen Tür, militärische Handlungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum reformierte sich die NATO nach 2014?
Die Annexion der Krim durch Russland führte zu einer Neubewertung der Sicherheitslage und einer Rückbesinnung auf die klassische Territorialverteidigung.
Was war das Ergebnis des NATO-Gipfels in Wales?
Der Gipfel beschloss eine inhaltliche Neuorientierung, inklusive der Stärkung der militärischen Handlungsfähigkeit an der Ostflanke des Bündnisses.
Welche Doppelstrategie verfolgt die NATO gegenüber Russland?
Die Strategie besteht aus glaubhafter militärischer Verteidigungsbereitschaft einerseits und der Aufrechterhaltung der Gesprächsbereitschaft (Dialog) andererseits.
Wie erklären Realismus und Konstruktivismus die NATO-Reform?
Der Realismus sieht die Reaktion auf eine neue Machtbedrohung; der Konstruktivismus betont das Selbstverständnis der NATO als Wertebündnis, das Stärke zeigt, um Konfrontation zu vermeiden.
Was ist das Sicherheitsdilemma an der NATO-Ostgrenze?
Es beschreibt die Situation, in der Verteidigungsmaßnahmen einer Seite von der anderen Seite als Bedrohung wahrgenommen werden, was zu einer Eskalationsspirale führen kann.
- Quote paper
- Kai Gerullis (Author), 2015, Wie erklärt sich die Reform der NATO angesichts der neuen Konfliktlage mit Russland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311272