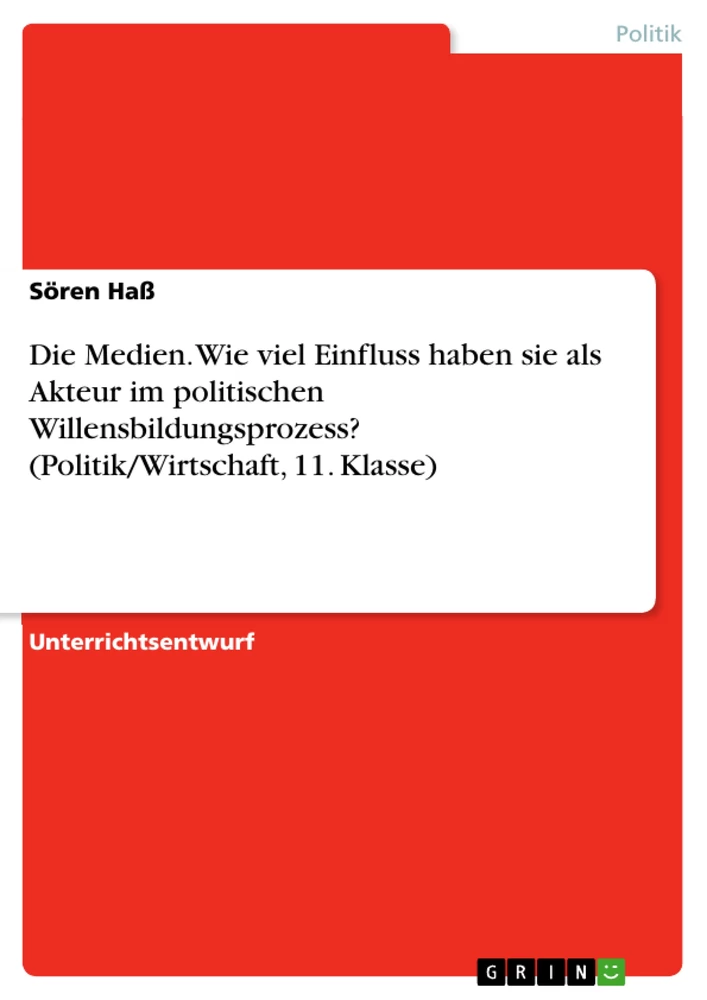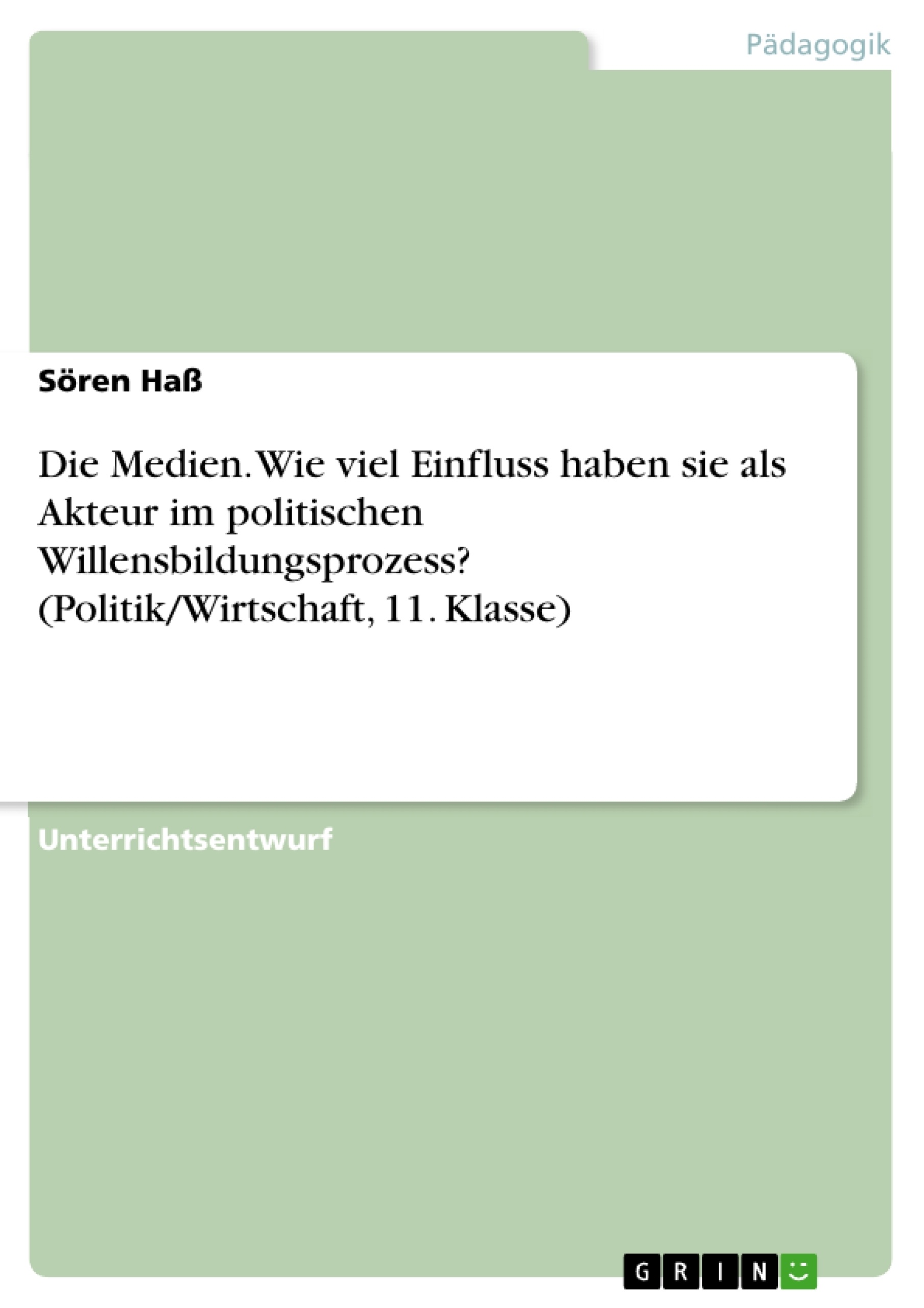Im Rahmen der Einheit „Vom Problem zum Gesetz – Der politische Entscheidungsprozess in der Bundesrepublik Deutschlands am Beispiel des Betreuungsgeld-Gesetzes“ werden entscheidende Aspekte dieses Themas anhand des konkreten Falles um die Einführung des Betreuungsgeldes bearbeitet. In den ersten Stunden ging es darum, bei den Schülern ein Verständnis für das Problem der Kinderbetreuung in Deutschland zu wecken. Aus diesem Grund betrieben die Schüler eine Genese des Falles, indem sie den demografischen Wandel anhand von Grafiken und Statistiken und seine familienpolitischen Folgen für die Gesellschaft analysierten und daraus ein politisches Problem herausgearbeitet haben. Dabei wurden auch die verschiedenen familienpolitischen Vorschläge (Betreuungsgeld vs. KITA) thematisiert. Im zweiten Schritt ging es um die Wahrnehmung der Akteure im Gesetzgebungsprozess, beginnend mit den Parteien. Die Schüler benannten dabei die unterschiedlichen Positionen der CDU/CSU und der SPD und deren Argumente und fassten sie zusammen. Eine Stunde zur Förderung der Urteilskompetenz schloss sich daran an. Im weiteren Verlauf wurden sowohl Funktionen von Parteien, als auch die Methode zum Dreischritt zur Analyse von Karikaturen thematisiert, bevor der Fokus im Fall Betreuungsgeld mit den Medien auf einen weiteren Akteur im Gesetzgebungsprozess gerichtet wurde. In diesem Zusammenhang erarbeiteten die Schüler in der vorangegangenen Stunde die Funktionen von Medien und erkannten den öffentlichen Auftrag zur Ausführung dieser Funktionen. In dieser Stunde soll es darum, gehen, das Wissen um diese Funktionen zu vertiefen und gleichzeitig das Agieren der Medien im Fall Betreuungsgeld exemplarisch zu beleuchten, bevor darauf aufbauend in der kommenden Stunde das Agenda-Setting im Zusammenhang mit Medien thematisiert wird. Im weiteren Verlauf der Einheit werden die Themen Lobbyismus, formale Aspekte der Gesetzgebung sowie die Arbeit von Ausschüssen, Fraktionen und Koalitionen erarbeitet, bevor der Fall Betreuungsgeld-Gesetz in den Kontext des Politikzyklus gesetzt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Darstellung der Unterrichtssequenz
- 2. Lerngruppenanalyse
- 3. Didaktische Erörterung
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Materialanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beschreibt den Entwurf für einen Unterrichtsbesuch im Fach Politik/Wirtschaft zum Thema des politischen Entscheidungsprozesses anhand des Betreuungsgeld-Gesetzes. Die Stunde konzentriert sich auf die Rolle der Medien im politischen Willensbildungsprozess. Ziel ist es, das Verständnis der Schüler für die Funktionen der Medien zu vertiefen und vorherrschende Fehlkonzepte bezüglich der Medienmanipulation zu relativieren.
- Der politische Entscheidungsprozess in Deutschland am Beispiel des Betreuungsgeld-Gesetzes
- Die Rolle der Medien im politischen Willensbildungsprozess
- Funktionen der Medien (Information, Meinungsbildung, Kontrolle/Kritik)
- Fehlkonzepte zum Einfluss der Medien und deren Relativierung
- Verstärkertheorie der Medienwirkung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Darstellung der Unterrichtssequenz: Dieser Abschnitt beschreibt den Kontext der Unterrichtsstunde innerhalb einer größeren Einheit zum politischen Entscheidungsprozess. Die vorherigen Stunden behandelten das Problem der Kinderbetreuung, die Positionen der Parteien und die Funktionen von Parteien. Die aktuelle Stunde fokussiert die Rolle der Medien im Fall Betreuungsgeld, als Vorbereitung auf die folgende Stunde zum Thema Agenda-Setting. Der gesamte Unterrichtsverlauf wird skizziert, wobei die Stunde zur Medienanalyse als wichtiger Schritt im Verständnis des politischen Willensbildungsprozesses dargestellt wird.
2. Lerngruppenanalyse: Die Lerngruppe besteht aus 19 Schülern, darunter ein Austauschschüler. Die Beteiligung ist generell gut, wobei in komplexeren Aufgabenphasen die aktive Mitarbeit abnimmt. Ein weitverbreitetes Fehlkonzept besteht in der negativen Konnotation der Medienwirkung, wobei Manipulation und Verzerrung der Tatsachen im Vordergrund stehen. Die Stunde zielt darauf ab, dieses Fehlkonzept durch vertiefende Auseinandersetzung mit den Funktionen der Medien zu relativieren und die positiven Aspekte der Medienwirkung herauszustellen.
3. Didaktische Erörterung: Dieser Abschnitt gliedert sich in Sachanalyse, Didaktische Analyse und Materialanalyse. Die Sachanalyse erläutert die Rolle der Massenmedien im politischen Willensbildungsprozess, einschließlich ihrer Funktionen (Information, Meinungsbildung, Kontrolle/Kritik). Die Didaktische Analyse begründet die Wahl des Themas und die didaktische Herangehensweise, u.a. die Fokussierung auf Printmedien aus Gründen der didaktischen Reduktion. Die Materialanalyse beschreibt den Einsatz eines Bild-Zeitungsartikels als Unterrichtsmaterial, um die Schüler mit einer provokanten Darstellung zu konfrontieren und die Diskussion anzuregen.
Schlüsselwörter
Politischer Entscheidungsprozess, Betreuungsgeld, Massenmedien, Meinungsbildung, Medienfunktionen, Medienwirkung, Manipulation, Verstärkertheorie, Fehlkonzepte, Printmedien, Politikzyklus, Agenda-Setting.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Politischer Entscheidungsprozess am Beispiel des Betreuungsgeld-Gesetzes
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Der Entwurf beschreibt eine Unterrichtsstunde im Fach Politik/Wirtschaft zum Thema des politischen Entscheidungsprozesses anhand des Betreuungsgeld-Gesetzes. Der Fokus liegt auf der Rolle der Medien im politischen Willensbildungsprozess und zielt darauf ab, das Verständnis der Schüler für die Funktionen der Medien zu verbessern und Fehlkonzepte zur Medienmanipulation zu relativieren.
Welche Themen werden im Unterricht behandelt?
Die Stunde behandelt den politischen Entscheidungsprozess in Deutschland, die Rolle der Medien in diesem Prozess, die Funktionen der Medien (Information, Meinungsbildung, Kontrolle/Kritik), Fehlkonzepte zum Einfluss der Medien und deren Relativierung, sowie die Verstärkertheorie der Medienwirkung. Als Beispiel dient das Betreuungsgeld-Gesetz.
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf gliedert sich in die Darstellung der Unterrichtssequenz, eine Lerngruppenanalyse und eine didaktische Erörterung (Sachanalyse, Didaktische Analyse, Materialanalyse). Es werden der Kontext der Stunde, die Schülercharakteristika, die didaktische Begründung der Methodenwahl und die verwendeten Materialien detailliert beschrieben.
Welche Lerngruppe wird angesprochen?
Die Lerngruppe besteht aus 19 Schülern, darunter ein Austauschschüler. Die Schüler beteiligen sich generell gut am Unterricht, zeigen aber in komplexeren Aufgabenphasen reduzierte Mitarbeit. Ein weitverbreitetes Fehlkonzept ist die negative Konnotation der Medienwirkung mit Fokus auf Manipulation und Verzerrung.
Welche Materialien werden verwendet?
Als Unterrichtsmaterial wird ein Artikel aus einer Bild-Zeitung verwendet. Die Wahl dieses Materials dient dazu, die Schüler mit einer provokanten Darstellung zu konfrontieren und die Diskussion anzuregen. Die didaktische Reduktion konzentriert sich auf Printmedien.
Welche Ziele werden mit der Unterrichtsstunde verfolgt?
Ziel ist es, das Verständnis der Schüler für die Funktionen der Medien im politischen Willensbildungsprozess zu vertiefen und vorherrschende Fehlkonzepte bezüglich der Medienmanipulation zu relativieren. Die Stunde dient als Vorbereitung auf eine folgende Stunde zum Thema Agenda-Setting.
Wie wird der politische Entscheidungsprozess im Unterricht dargestellt?
Der politische Entscheidungsprozess wird am Beispiel des Betreuungsgeld-Gesetzes erläutert. Vorherige Stunden behandelten bereits das Problem der Kinderbetreuung, die Positionen der Parteien und die Funktionen von Parteien. Die aktuelle Stunde fokussiert die Rolle der Medien in diesem Prozess.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für den Unterrichtsentwurf?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Politischer Entscheidungsprozess, Betreuungsgeld, Massenmedien, Meinungsbildung, Medienfunktionen, Medienwirkung, Manipulation, Verstärkertheorie, Fehlkonzepte, Printmedien, Politikzyklus, und Agenda-Setting.
- Citation du texte
- Sören Haß (Auteur), 2014, Die Medien. Wie viel Einfluss haben sie als Akteur im politischen Willensbildungsprozess? (Politik/Wirtschaft, 11. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311339