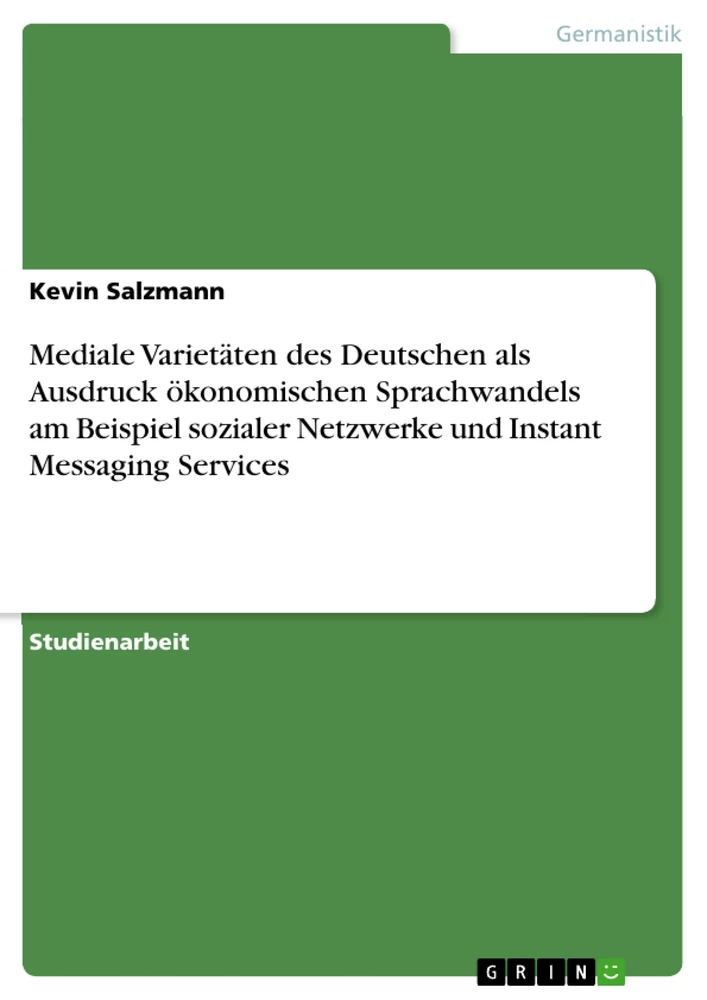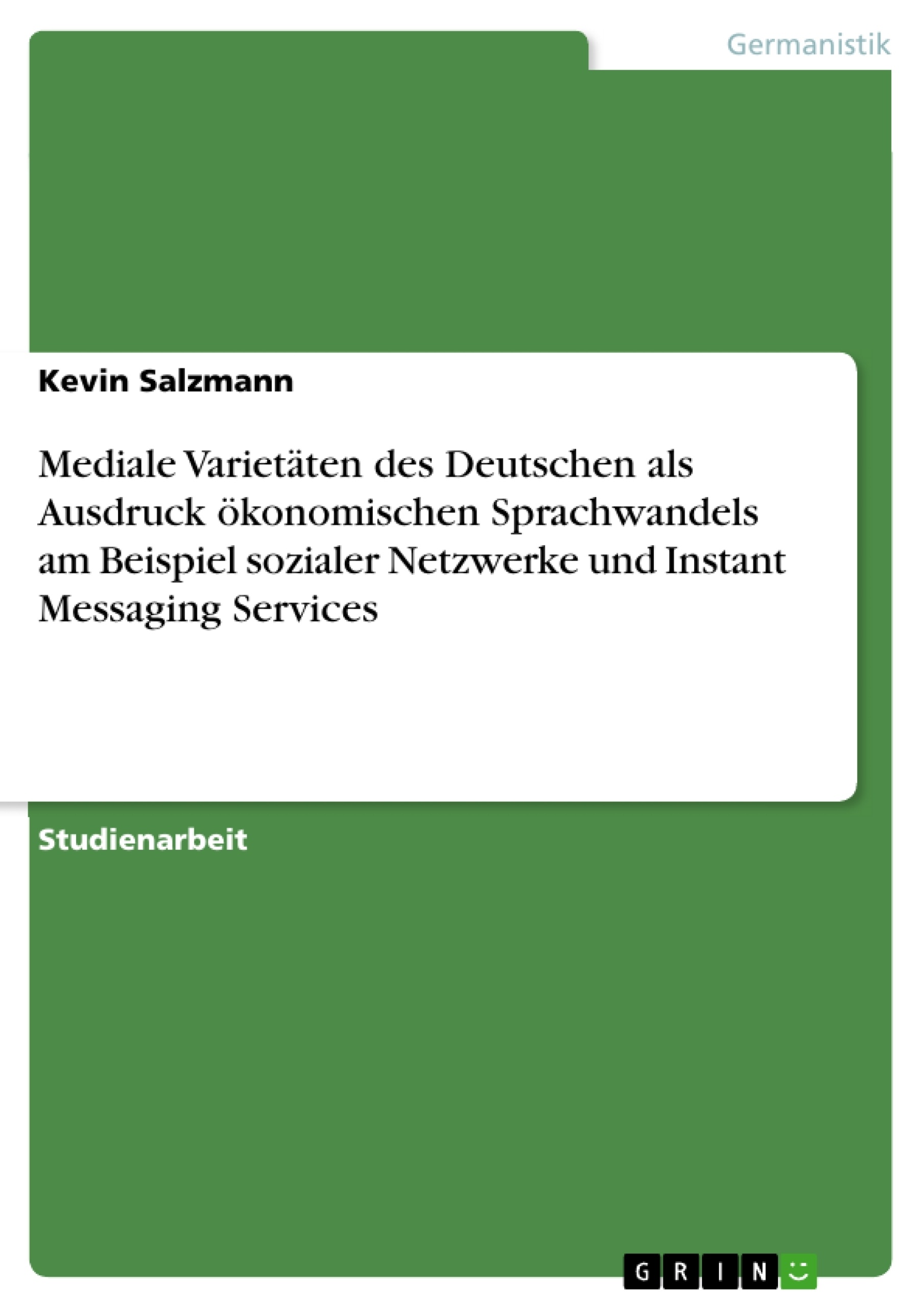In einer Zeit moderner Medien werden die Varietäten des Deutschen besonders deutlich. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter ermöglichen es jedem Nutzer, Gedanken, Erlebnisse oder andere spontane Ideen zu veröffentlichen oder die von anderen Nutzern zu kommentieren. In der vorliegenden Arbeit sollen am Beispiel des sozialen Netzwerks ‚Twitter’ sowie an Instant Messaging Services wie ‚SMS’ oder ‚WhatsApp’ mediale Varietäten des Deutschen untersucht werden, um herauszuarbeiten, inwieweit sprachliche Variationen in diesen Medienplattformen einen Beitrag zu einem ökonomischen Sprachwandel leisten.
Einleitend wird daher zunächst sprachhistorisch vorgegangen und aufgezeigt, wie sich sprachlicher Wandel vollzieht und welche grundlegenden Muster er umfasst. Anschließend wird vertiefend auf den Aspekt der Sprachökonomie eingegangen. Hierbei wird versucht, Motive und Grundtendenzen darzustellen, die unsere Sprache früher wie heute durch sprachsystematische Faktoren einfacher machen. In diesem Zusammenhang wird ebenso auf Varietäten des Deutschen eingegangen, von denen die medialen Formen im anschließenden Teil im Zentrum stehen. Am Beispiel von ‚Instant Messaging‘ und ‚Twitter‘ sollen sprachliche Phänomene veranschaulicht und analysiert werden, um abschließend auf den Begriff des Sprachwandels zurückzukehren. Wie äußert sich Sprachökonomie im medialen Kontext und warum sind die Veränderungen im Sprachgebrauch funktionale Formen sprachlichen Wandels? Im nachfolgenden Teil wird nun vertiefend auf den Aspekt des Sprachwandels eingegangen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Sprachwandel im historischen Kontext
- 2.1 Faktoren des Sprachwandels
- 2.2 Standardvarietäten
- 3. Sprachökonomie
- 4. Mediale Varietäten des Deutschen
- 4.1 Instant Messaging
- 4.2 Twitter
- 5. Analyse medialer Textformen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit medialen Varietäten des Deutschen, insbesondere in sozialen Netzwerken und Instant Messaging-Diensten, und untersucht, inwieweit diese Variationen einen Beitrag zum ökonomischen Sprachwandel leisten. Die Analyse fokussiert sich auf Twitter und Instant Messaging-Services wie SMS und WhatsApp.
- Sprachwandel und seine Faktoren
- Sprachökonomie und ihre Einflussfaktoren
- Mediale Varietäten des Deutschen in sozialen Netzwerken und Instant Messaging
- Analyse sprachlicher Phänomene in den Medien
- Zusammenhang zwischen Sprachökonomie und Sprachwandel im medialen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz von Kommunikation und Sprachwandel dar und setzt den Kontext für die Analyse von medialen Varietäten des Deutschen. Sie beleuchtet den Wandel des Deutschen im historischen Kontext und beschreibt die Entstehung neuer Lexik und morphologischer Veränderungen.
- Kapitel 2: Sprachwandel im historischen Kontext: Dieses Kapitel diskutiert den Sprachwandel in seinem historischen Kontext. Es werden die verschiedenen Ebenen des Sprachwandels sowie die Faktoren wie wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kommunikationstechnischer Fortschritt erläutert. Außerdem werden synchrone und diachrone Perspektiven auf Sprachwandel betrachtet.
- Kapitel 3: Sprachökonomie: Hier wird der Aspekt der Sprachökonomie tiefergehend beleuchtet. Es werden die Motive und Tendenzen untersucht, die unsere Sprache durch sprachsystematische Faktoren einfacher machen. Des Weiteren werden Varietäten des Deutschen betrachtet, die in der medialen Welt eine besondere Rolle spielen.
- Kapitel 4: Mediale Varietäten des Deutschen: In diesem Kapitel werden mediale Varietäten des Deutschen im Zentrum stehen. Am Beispiel von Instant Messaging und Twitter sollen sprachliche Phänomene veranschaulicht und analysiert werden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert sich auf die folgenden Schlüsselwörter und Themen: Sprachwandel, Sprachökonomie, mediale Varietäten, soziale Netzwerke, Instant Messaging, Twitter, SMS, WhatsApp, Sprachliche Phänomene, ökonomischer Sprachwandel, Analyse medialer Textformen.
- Arbeit zitieren
- Kevin Salzmann (Autor:in), 2015, Mediale Varietäten des Deutschen als Ausdruck ökonomischen Sprachwandels am Beispiel sozialer Netzwerke und Instant Messaging Services, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/311416